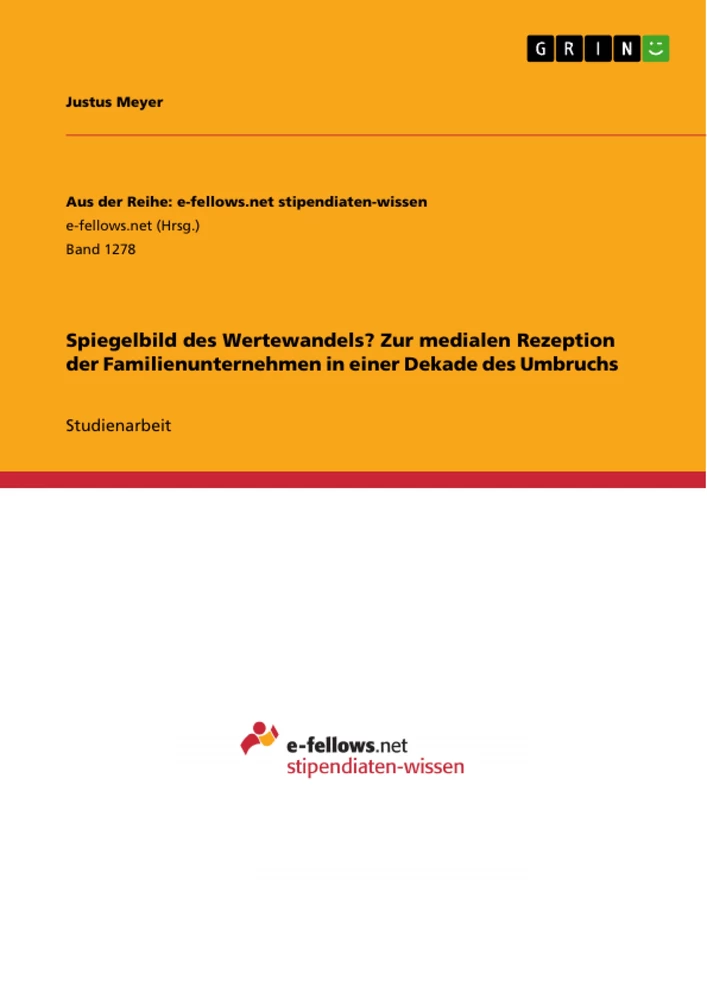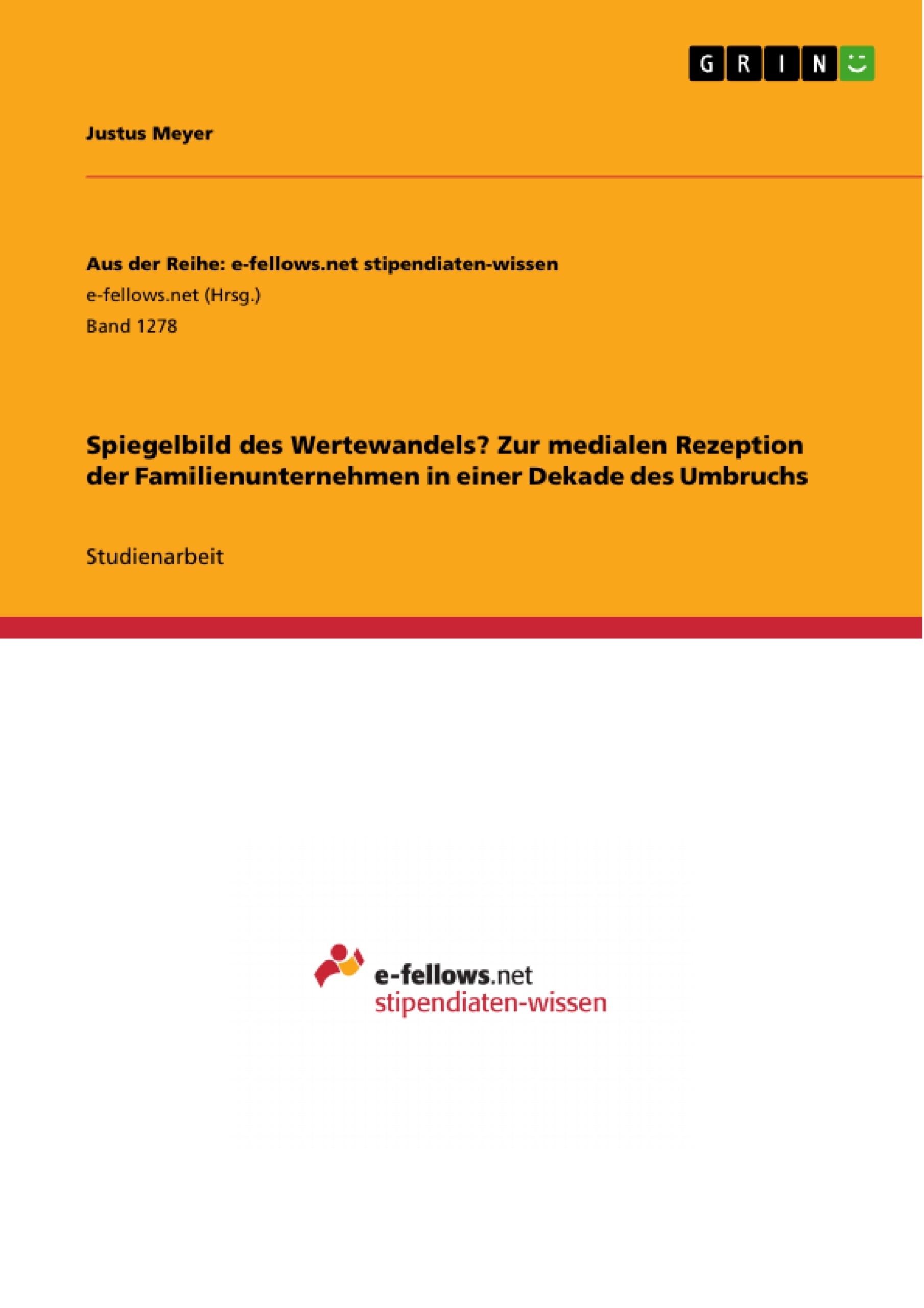Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Leitfrage: "Welche Rolle spielte der kulturelle Umbruch der 1960er und 1970er Jahre in der Bundesrepublik beim Wandel der medialen Wahrnehmung von Familienunternehmen und ihren Eigentümern?"
Die Arbeit kommt zu dem folgenden Fazit:
Im Großen und Ganzen ergibt sich für den Untersuchungszeitraum ein differenziertes Bild. Die Beurteilung der Familienunternehmen durch den Spiegel ist stark situationsabhängig und ambivalent. Zwar wandelt sich die mediale Rezeption der Familienunternehmer, ein klarer Bruch lässt sich jedoch nicht ausmachen. Zudem weist der Wandel des Unternehmerbildes nicht die eingangs erwartete Dramatik auf.
Tendenziell gerät der Stereotyp des autoritär-patriarchalen Unternehmers in Zeiten der Krise vermehrt die Kritik. Wenngleich es vor dem Hintergrund der Artikel übertrieben erscheint, von einer „Götterdämmerung“ zu sprechen, lässt sich spätestens nach 1966 ein Abgesang auf den Familienkapitalismus und seine Galionsfiguren die Unternehmer konstatieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familienunternehmen im Fokus
- Definitionsprobleme
- Deutungsmuster „Wertewandel“
- Im Spiegel der Rekonstruktion
- Krisen und Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung beleuchtet das Spannungsfeld zwischen „Wertewandel“ und Familienunternehmen anhand einer Analyse von Beiträgen in „Der Spiegel“. Ziel ist es, die Rolle des kulturellen Umbruchs der 1960er und 1970er Jahre in der Bundesrepublik beim Wandel der medialen Wahrnehmung von Familienunternehmen und ihren Eigentümern zu erforschen.
- Die mediale Darstellung von Familienunternehmen in der frühen Bundesrepublik
- Der Einfluss des „Wertewandels“ auf das Bild von Familienunternehmen
- Die Veränderung der Unternehmenskultur im Kontext des Wertewandels
- Die Rolle von „Der Spiegel“ als Meinungsbildner
- Die Verbindung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des „Wertewandels“ und seine Auswirkungen auf Familienunternehmen ein. Sie stellt die Leitfrage der Arbeit und skizziert den Forschungsstand. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Familienunternehmen und den verschiedenen Ansätzen in der Literatur. Es analysiert die Bedeutung von Eigentum, Einfluss der Familie und Unternehmenskultur für die Charakterisierung von Familienunternehmen.
Im dritten Kapitel wird das Deutungsmuster „Wertewandel“ beleuchtet. Es werden die verschiedenen Ansätze und Interpretationen des Begriffs „Wertewandel“ diskutiert und in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung der 1960er und 1970er Jahre eingeordnet.
Schlüsselwörter
Familienunternehmen, Wertewandel, Medienwahrnehmung, „Der Spiegel“, Unternehmenskultur, Corporate Governance, kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU), historische Wertewandelsforschung, deutsche Sonderkonjunktur, Wirtschaftskrisen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Familienunternehmen in den 60er Jahren medial wahrgenommen?
In der frühen Bundesrepublik dominierten oft Stereotype des autoritär-patriarchalen Unternehmers, die jedoch zunehmend in die Kritik gerieten.
Welchen Einfluss hatte der kulturelle Umbruch auf das Unternehmerbild?
Der gesellschaftliche Wertewandel führte dazu, dass traditionelle Führungsstile hinterfragt wurden und ein "Abgesang" auf den klassischen Familienkapitalismus einsetzte.
Welche Rolle spielte das Magazin "Der Spiegel" in dieser Untersuchung?
"Der Spiegel" diente als primäre Quelle, um die ambivalente und oft krisenorientierte Berichterstattung über Familienunternehmer zu analysieren.
Gab es einen plötzlichen Bruch in der medialen Rezeption?
Nein, die Untersuchung zeigt eher einen schleichenden Wandel als einen klaren Bruch; die Darstellung blieb stark situationsabhängig.
Warum standen Familienunternehmen in der Kritik?
Oft wurden sie in Zeiten wirtschaftlicher Krisen als Symbole für veraltete Strukturen und mangelnde Modernisierungsbereitschaft dargestellt.
- Quote paper
- Justus Meyer (Author), 2013, Spiegelbild des Wertewandels? Zur medialen Rezeption der Familienunternehmen in einer Dekade des Umbruchs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300440