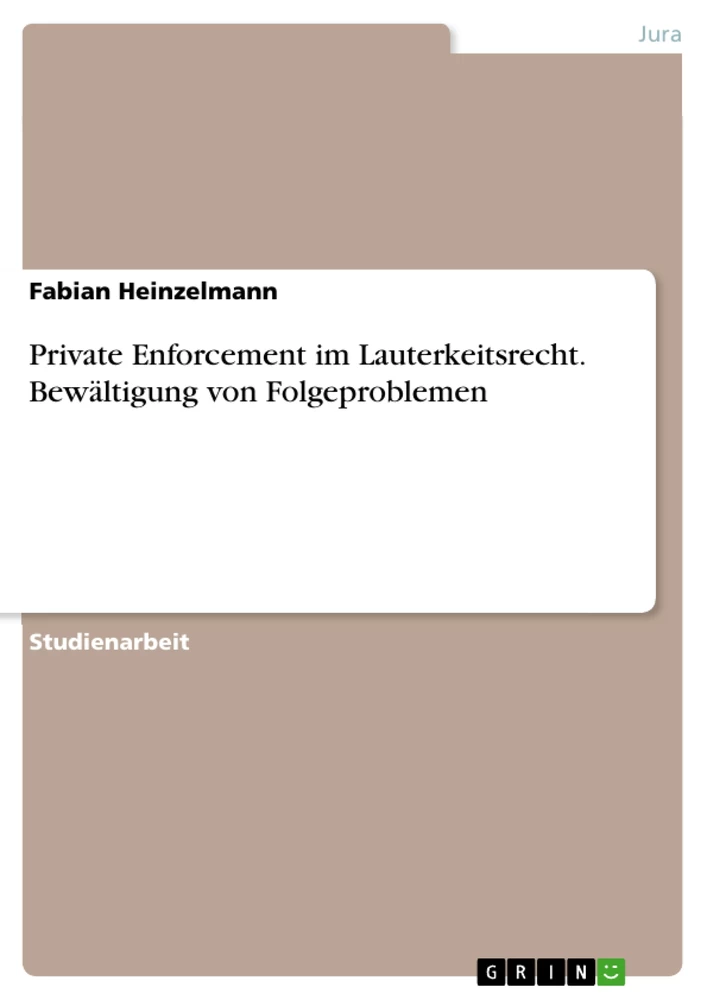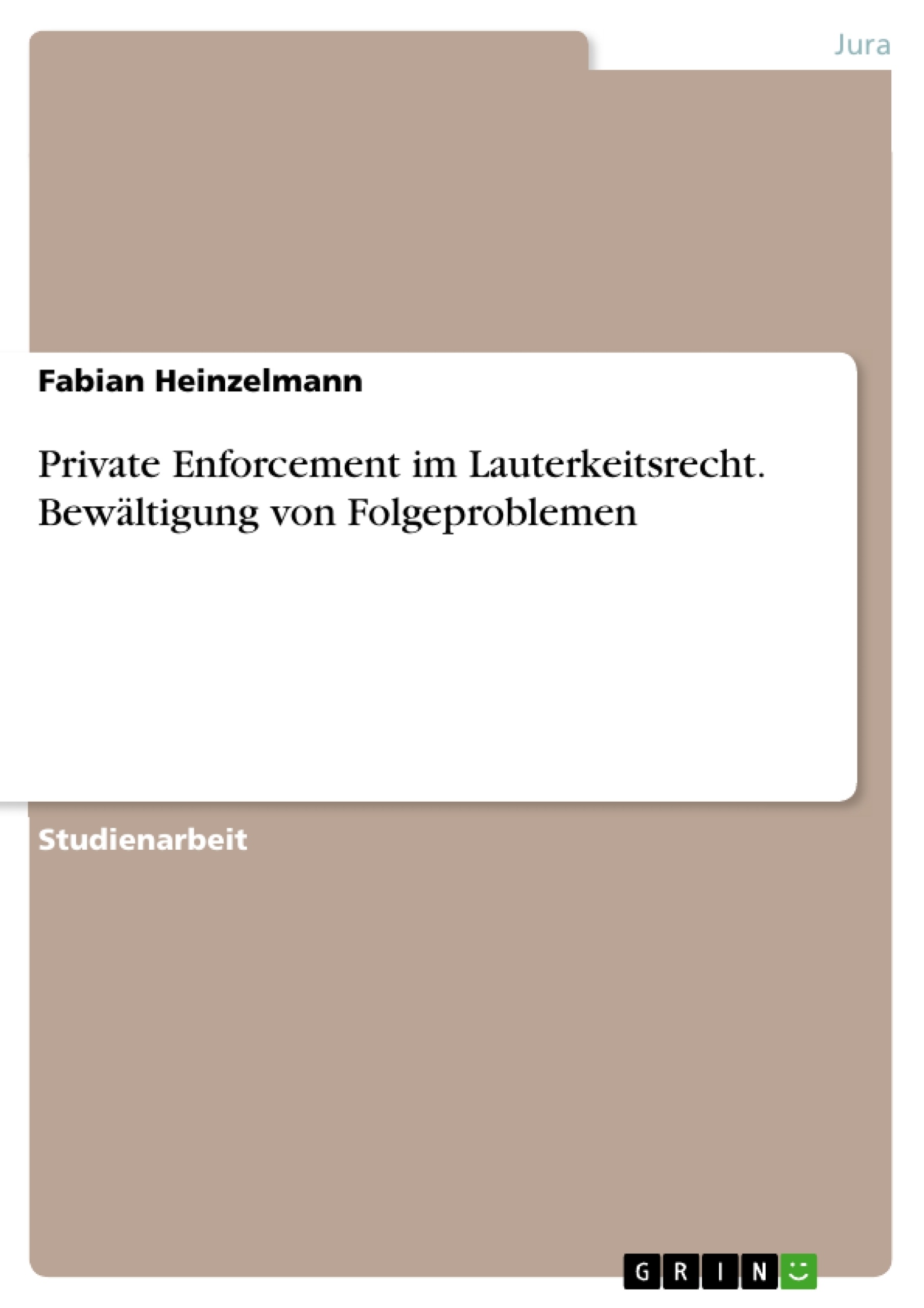Unter “private (law) enforcement” versteht man die privatrechtliche Durchsetzung von Verhaltensnormen. Diese ist seit langem ein fester Bestandteil des amerikanischen Lauterkeits- (law of unfair competition) und Kartellrechts (anti trust law), welches im Rahmen des New Deal in den 1930er Jahren entwickelte wurde. Trotz seines durchschlagenden Erfolgs für das amerikanische Rechtssystem ist eine Übernahme seiner Grundsätze in das deutsche Recht aufgrund der stark voneinander abweichenden Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich. Im Gegensatz zum Common Law tendiert das kontinentaleuropäische Recht im Allgemeinen zu einer vorwiegend öffentlich-rechtlichen Durchsetzung von Normen. Eine Ausnahme hiervon stellt das deutsche Lauterkeitsrecht dar. Dieses ist traditionell durch die privatrechtliche Durchsetzung von Verhaltensnormen geprägt. Die privatrechtliche Durchsetzung von Verhaltensnormen hat sich hier bei der Bekämpfung von Wettbewerbsverstößen als besonders wirksam erwiesen und entlastet darüber hinaus die öffentlichen Haushalte beträchtlich. Um die private Durchsetzung der Verhaltensnormen aus dem UWG zu gewährleisten, wurden vom Gesetzgeber gewisse Anreize für die Verfolgung von Lauterkeitsverstößen geschaffen. Diese Anreize können jedoch auch missbraucht werden, was zu Folgeproblemen unterschiedlichster Art führt.
In diesen Zusammenhang muss folgendes bedacht werden: ,,Freiheit ist ohne die Möglichkeit ihres Missbrauchs nicht denkbar. Wer jegliche Missbrauchsmöglichkeit beseitigt, schafft zugleich die Freiheit ab.”
Um eine effektive private Durchsetzung zu gewährleisten und damit die Lauterkeit des Wettbewerbs zu sichern, ist der Gesetzgeber gezwungen Anreize einerseits zu fördern und ihren Missbrauch andererseits zu begrenzen. Die vorliegende Arbeit beleuchtet zum einen die Missbrauchsursachen und die damit verbundenen Missbrauchsmöglichkeiten. Darauf aufbauend werden die gesetzlichen Konsequenzen des Gesetzgebers zur Bekämpfung der Missbräuche betrachtet. Darüber hinausgehende Möglichkeiten zur Verhinderung und Vermeidung der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen werden im darauffolgenden Abschnitt kritisch betrachtet. Den Abschluss findet diese Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung dieser Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das private Rechtsdurchsetzungssystem und die diesbezüglich geschaffen Anreize
- I. Das private Rechtsdurchsetzungssystem des UWG
- 1. Ansprüche
- 2. Anspruchsberechtigung
- 3. Anspruchsdurchsetzung
- a) Außergerichtliche Anspruchsverfolgung
- aa) Abmahnung und strafbewehrte Unterwerfungserklärung
- bb) Einigungsverfahren
- b) Gerichtliche Anspruchsverfolgung
- II. Anreize für die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen
- 1. Einräumung einer „weiten“ Aktivlegitimation (§ 8 Abs. 3)
- 2. Gebührenpflicht bei berechtigten Abmahnungen (§ 12 Abs. 1 S. 2)
- 3. Fliegender Gerichtsstand (§ 14)
- C. Möglichkeiten des ,,Missbrauchs" - Was ist eigentlich ,,Missbrauch"?
- I. Der Missbrauchsbegriff
- 1. Der Rechtmissbrauch nach §§ 242, 226 BGB
- 2. Der Rechtsmissbrauch nach § 8 Abs. 4
- II. Missbrauchsfälle in der Praxis
- III. Zwischenbilanz
- D. Konsequenzen des Missbrauchs der geschaffen Anreize durch die Rechtsverfolger
- I. Einführung des Missbrauchsverbots
- II. Einschränkung der Klagebefugnis
- III. Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken
- E. Kritik der Neuregelungen
- F. Möglichkeiten der Eindämmung und Verhinderung des Missbrauchs
- I. Anwendung Bagatellklausel gem. § 3
- II. Einwendungen über § 242 BGB
- III. Unentgeltlichkeit der ersten Abmahnung
- IV. Einrichtung von Koordinationsstellen
- V. Begrenzung des Fliegenden Gerichtsstands
- VI. Zwischenbilanz
- G. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das private Enforcement im Lauterkeitsrecht und befasst sich insbesondere mit der Bewältigung von Folgeproblemen, die durch den Missbrauch der eingeräumten Anreize entstehen. Im Fokus steht die Analyse der Möglichkeiten und Folgen von Missbrauch im System der privaten Rechtsdurchsetzung.
- Das private Rechtsdurchsetzungssystem des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
- Anreize für die private Durchsetzung von Wettbewerbsansprüchen (z.B. Aktivlegitimation, Gebührenpflicht, fliegender Gerichtsstand)
- Begriff und Erscheinungsformen des Missbrauchs dieser Anreize
- Konsequenzen des Missbrauchs und mögliche Maßnahmen zur Eindämmung
- Bewertung aktueller Gesetzesreformen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der privaten Rechtsdurchsetzung im Lauterkeitsrecht ein und skizziert den Forschungsgegenstand der Arbeit: die Problematik des Missbrauchs der eingeräumten Anreize. Es wird die zentrale Forschungsfrage formuliert und der Aufbau der Arbeit erläutert.
B. Das private Rechtsdurchsetzungssystem und die diesbezüglich geschaffen Anreize: Dieses Kapitel beschreibt das System der privaten Rechtsdurchsetzung im UWG, detailliert die Ansprüche, die Anspruchsberechtigung und die Möglichkeiten der gerichtlichen und außergerichtlichen Anspruchsdurchsetzung. Es werden die Anreize für die private Verfolgung von Wettbewerbsverstößen analysiert, wie die weite Aktivlegitimation, die Gebührenpflicht bei berechtigten Abmahnungen und der fliegende Gerichtsstand. Die Darstellung legt den Grundstein für die spätere Analyse des Missbrauchspotenzials.
C. Möglichkeiten des ,,Missbrauchs" - Was ist eigentlich ,,Missbrauch"? : Dieses Kapitel beleuchtet den zentralen Begriff des "Missbrauchs" im Kontext der privaten Rechtsdurchsetzung. Es differenziert zwischen verschiedenen Missbrauchsformen, beispielsweise dem Missbrauch aus Gebührenerzielungsinteresse oder Schädigungsabsicht, und analysiert anhand praktischer Fälle die verschiedenen Ausprägungen des Missbrauchs. Die juristische Diskussion um den Missbrauchsbegriff wird eingehend dargestellt und differenziert.
D. Konsequenzen des Missbrauchs der geschaffen Anreize durch die Rechtsverfolger: Das Kapitel untersucht die Konsequenzen des Missbrauchs der im UWG vorgesehenen Anreize. Es analysiert das Missbrauchsverbot, die Einschränkungen der Klagebefugnis und die Relevanz des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Die Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Regulierung des privaten Enforcement.
E. Kritik der Neuregelungen: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit den aktuellen Gesetzesreformen im Bereich des privaten Enforcement. Es bewertet die Neuregelungen in Bezug auf ihre Wirksamkeit und ihre Auswirkungen auf die Praxis der privaten Rechtsdurchsetzung. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Reformen werden diskutiert und bewertet.
F. Möglichkeiten der Eindämmung und Verhinderung des Missbrauchs: Hier werden verschiedene Möglichkeiten zur Eindämmung und Verhinderung des Missbrauchs im privaten Enforcement vorgestellt und diskutiert. Es werden Maßnahmen wie die Anwendung der Bagatellklausel, Einwendungen über § 242 BGB, die Unentgeltlichkeit der ersten Abmahnung, die Einrichtung von Koordinationsstellen und die Begrenzung des fliegenden Gerichtsstands erörtert und bewertet. Das Kapitel bietet einen praxisorientierten Lösungsansatz zur Problematik.
Schlüsselwörter
Private Enforcement, Lauterkeitsrecht, UWG, Wettbewerbsrecht, Abmahnung, Missbrauch, Gebührenerzielungsinteresse, Schädigungsabsicht, fliegender Gerichtsstand, Rechtsmissbrauch, Gesetzesreformen, Anreizgestaltung, Rechtsdurchsetzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum privaten Enforcement im Lauterkeitsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das private Enforcement im Lauterkeitsrecht, insbesondere die Probleme, die durch den Missbrauch der eingeräumten Anreize entstehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten und Folgen von Missbrauch im System der privaten Rechtsdurchsetzung.
Welches Rechtssystem wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das deutsche Lauterkeitsrecht, speziell das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
Welche Anreize für private Rechtsverfolgung werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert Anreize wie die weite Aktivlegitimation (§ 8 Abs. 3 UWG), die Gebührenpflicht bei berechtigten Abmahnungen (§ 12 Abs. 1 S. 2 UWG) und den fliegenden Gerichtsstand (§ 14 UWG).
Was versteht die Arbeit unter „Missbrauch“?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Formen des Missbrauchs, z.B. den Missbrauch aus Gebührenerzielungsinteresse oder Schädigungsabsicht. Sie analysiert den Missbrauchsbegriff anhand praktischer Fälle und der juristischen Diskussion um §§ 242, 226 BGB und § 8 Abs. 4 UWG.
Welche Konsequenzen hat der Missbrauch der Anreize?
Die Arbeit untersucht Konsequenzen wie das Missbrauchsverbot, Einschränkungen der Klagebefugnis und die Relevanz des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken.
Wie werden aktuelle Gesetzesreformen bewertet?
Die Arbeit beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Gesetzesreformen im Bereich des privaten Enforcement, bewertet deren Wirksamkeit und Auswirkungen auf die Praxis und diskutiert Stärken und Schwächen der einzelnen Reformen.
Welche Möglichkeiten zur Eindämmung des Missbrauchs werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Maßnahmen vor, darunter die Anwendung der Bagatellklausel (§ 3 UWG), Einwendungen nach § 242 BGB, die Unentgeltlichkeit der ersten Abmahnung, die Einrichtung von Koordinationsstellen und die Begrenzung des fliegenden Gerichtsstands.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das private Rechtsdurchsetzungssystem und die Anreize, Möglichkeiten des Missbrauchs, Konsequenzen des Missbrauchs, Kritik der Neuregelungen, Möglichkeiten der Eindämmung und Verhinderung des Missbrauchs, Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Private Enforcement, Lauterkeitsrecht, UWG, Wettbewerbsrecht, Abmahnung, Missbrauch, Gebührenerzielungsinteresse, Schädigungsabsicht, fliegender Gerichtsstand, Rechtsmissbrauch, Gesetzesreformen, Anreizgestaltung, Rechtsdurchsetzung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, beschreibt dann das System des privaten Enforcement und die relevanten Anreize. Anschließend wird der Missbrauch definiert und analysiert, die Konsequenzen beleuchtet und Möglichkeiten zur Eindämmung diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
- Citar trabajo
- Fabian Heinzelmann (Autor), 2014, Private Enforcement im Lauterkeitsrecht. Bewältigung von Folgeproblemen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300512