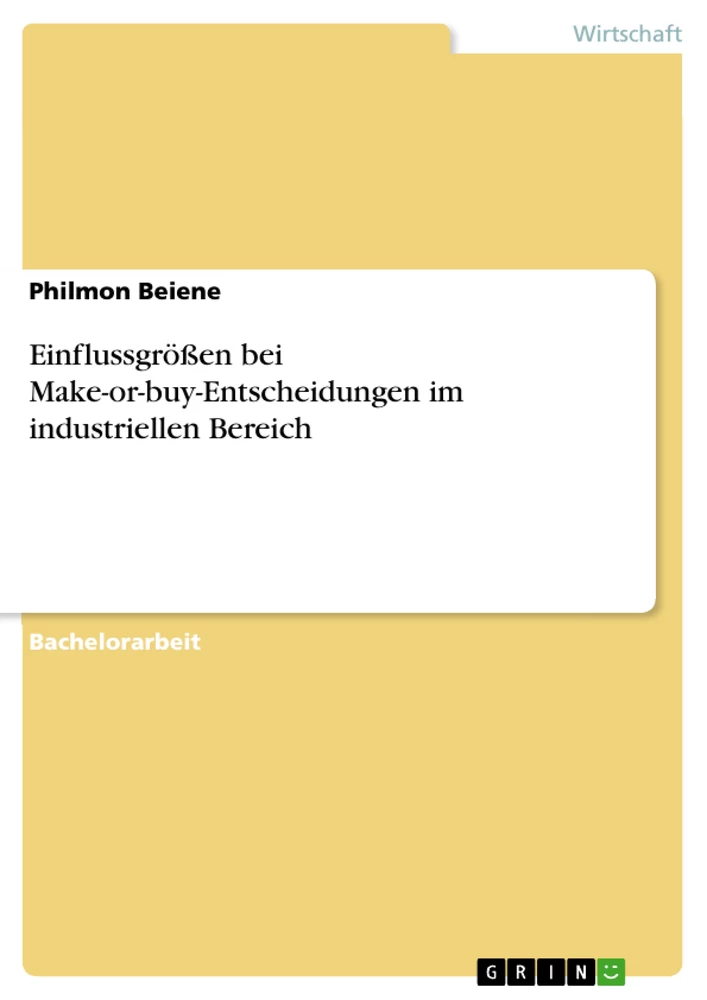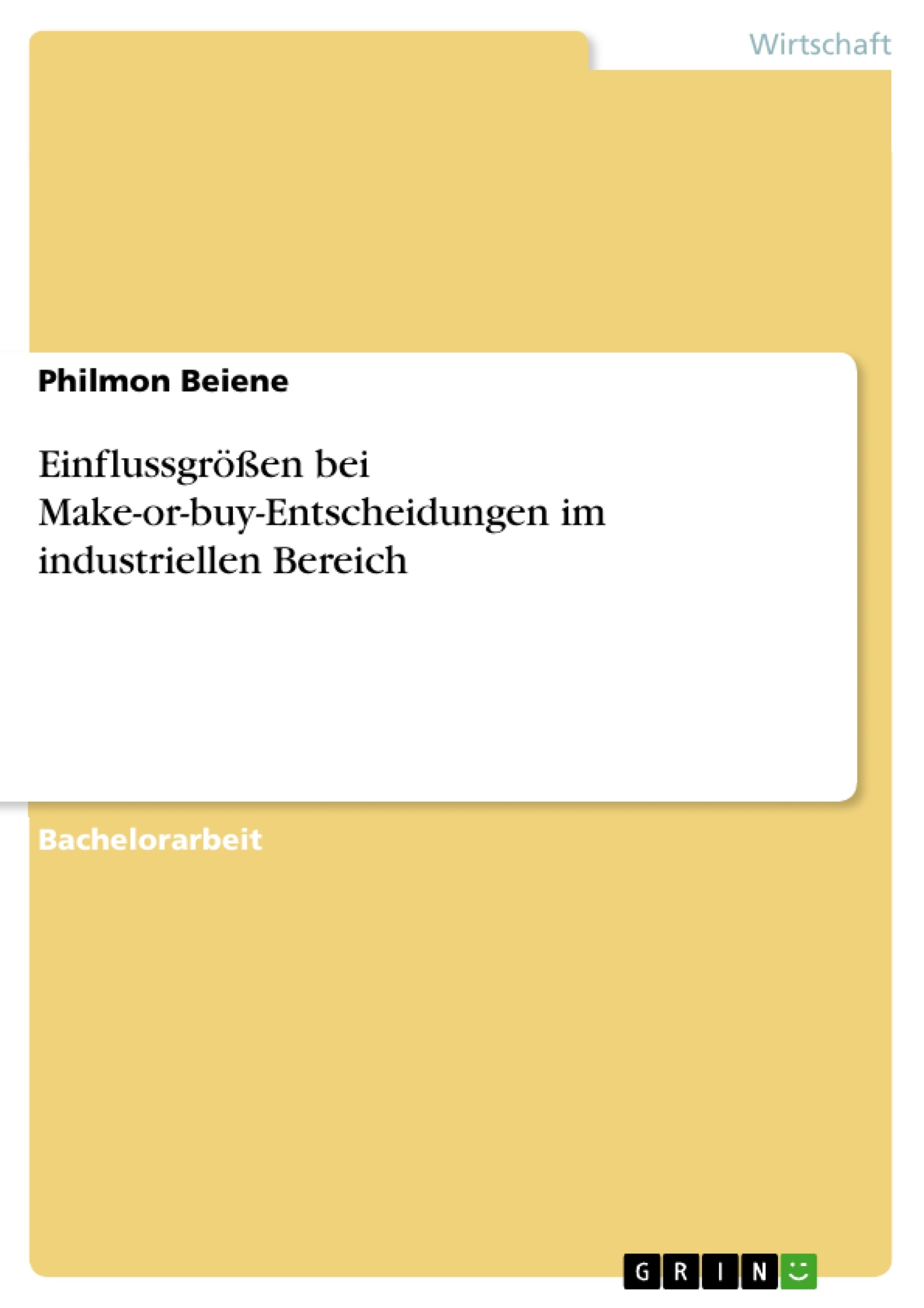Durch die stetig expandierende Weltwirtschaft und der zeitgleich stattfindenden Reduzierung von Produktzyklen leiden immer mehr Unternehmen unter hohem Konkurrenz- und Leistungsdruck. Die aktuelle Liberalisierung des Welthandels in Form neuer internationaler Freihandelsabkommen wie bspw. das seit Juni 2013 geplante transatlantische Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU, auch bekannt als TTIP, sorgt für einen rasant zunehmende Wettbewerbsdichte. Während sich zum einen neue Märkte für den Absatz der hergestellten Produkte aufzeigen, müssen Unternehmen gleichzeitig ihre Flexibilität bewahren und kontinuierlich in Forschung und Weiterentwicklung investieren, um innovativ zu bleiben und neue Produkte auf dem Markt zu bringen oder bestehende zu auf dem Markt zu stabilisieren. Insbesondere für kleine und mittelständische Industriebetriebe wird dabei die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit verstärkt in den Vordergrund gestellt, da diese durch den Markteintritt internationaler Konkurrenten gefährdet wird.
Die eben genannten ökonomischen Gegebenheiten fordern vor allem das Management heraus. Dieses muss versuchen die Prozesskosten im Betrieb zu minimieren, um weiterhin auf dem internationalen Markt bestehen zu können. Dazu gehören Kosten für die Forschung und Entwicklung von Produkten, der Produktion und weitere mit der Herstellung verknüpfte Tätigkeiten. Die klassische Problemstellung, ob Produkte in der Eigenfertigung hergestellt, oder fremdbezogen werden sollen, gerät somit immer mehr in den Mittelpunkt der strategischen Unternehmensplanung.
Ziel dieser Arbeit ist es, entscheidungsrelevante Einflussgrößen für Make-or-Buy-Entscheidungen darzulegen. Dabei wird zuerst der Begriff Make-or-Buy definiert, von verwandten Thematiken abgegrenzt und die verschieden Arten und Verwendungsmöglichkeiten differenziert. Anschließend werden die Vor-und Nachteile der jeweiligen Bereitstellungsalternative geprüft.
Im Hauptteil werden die relevanten Einflussgrößen für jeweilige Make-or-Buy-Entscheidungen verschiedener Planungsebenen erläutert und den jeweiligen in Betracht kommenden Instrumenten zur Entscheidungsfindung zugeordnet. Da die Make-or-Buy-Problematik in so gut wie allen Wirtschaftszweigen thematisiert werden kann, beschränkt sich diese Arbeit auf Make-or-Buy-Entscheidungen im industriellen Bereich. Nachdem insbesondere Werkzeuge für industrielle MoB-Entscheidungen erläutert werden, wird das Make-or-Buy-Verfahren mit Hilfe eines Beispiels beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Aufgabenentwicklung des Controllings
- 2.2 Begriff Controlling
- 3. Charakterisierung von Make-or-Buy-Entscheidungen
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Abgrenzung von weiteren Bereitstellungsbegriffen
- 3.2.1 Fertigungstiefe
- 3.2.2 Vertikale Integration
- 3.2.3 Outsourcing und Insourcing
- 3.3 Unternehmensbereiche mit MoB-Entscheidungsbedarf
- 3.3.1 Entscheidungsobjekte
- 3.3.2 MoB im Produktionsbereich
- 3.3.3 MoB im Bereich Forschung und Entwicklung
- 3.3.4 MoB in weiteren Unternehmensbereichen
- 3.4 Differenzierung von Make-or-Buy-Entscheidungen
- 3.5 Wirkung von MoB-Entscheidungen
- 3.6 Anlässe für eine MoB-Entscheidung
- 3.7 Vor- und Nachteile im Falle des „Make“ oder „Buy“
- 3.7.1 Vor- und Nachteile einer Eigenfertigung
- 3.7.2 Vor- und Nachteile eines Fremdbezugs
- 3.7.3 Gegenüberstellung von „Make“ und „Buy“
- 4. Einflussgrößen und Instrumente der operativen Make-or-Buy-Entscheidungsfindung
- 4.1 Bestimmung der operativen MoB-Einflussfaktoren und Zielgrößen
- 4.2 Kostenrechnerische Ansätze und Bewertungsprobleme
- 4.2.1 Quantitative Kostenvergleichsrechnung
- 4.2.2 Prozesskostenrechnung
- 4.2.3 Deckungsbeitragsrechnung und Break-Even-Analyse
- 4.2.4 Investitionsrechnung
- 4.2.5 Bewertungskonflikte bei Zwischenformen des Make-or-Buy
- 4.3 Überleitung zu strategischen Bestimmungsfaktoren
- 5. Einflussgrößen und Modelle strategischer Make-or-Buy-Entscheidungen
- 5.1 Zielgrößen der strategischen Planung
- 5.2 Qualitative Einflussfaktoren der strategischen Make-or-Buy-Entscheidung
- 5.2.1 Transaktionskostentheorie
- 5.2.2 Ressourcenorientierter Ansatz
- 5.2.3 Ansatz von Porter
- 5.2.4 Ansatz von Harrigan
- 5.3 Instrumente der qualitativ strategischen Make-or-Buy-Entscheidung
- 5.3.1 Make-or-Buy-Portfolio
- 5.3.2 Nutzwertanalyse
- 5.3.3 Zusätzliche Instrumente
- 6. Vorgehensweise am Beispiel der Fraunhofer IPA
- 7. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einflussgrößen bei Make-or-Buy-Entscheidungen im industriellen Bereich. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der relevanten Faktoren – sowohl operativer als auch strategischer Natur – zu entwickeln und verschiedene Entscheidungsmodelle zu analysieren. Die Arbeit betrachtet sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte.
- Operative und strategische Einflussfaktoren bei Make-or-Buy-Entscheidungen
- Kostenrechnerische Ansätze zur Entscheidungsfindung
- Qualitative Modelle und Ansätze (Transaktionskostentheorie, Ressourcenorientierter Ansatz etc.)
- Anwendung der Modelle und Ansätze in der Praxis
- Fallstudie am Beispiel der Fraunhofer IPA
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Make-or-Buy-Entscheidungen ein und beschreibt die Problemstellung. Es legt die Zielsetzung der Arbeit dar und skizziert den Aufbau.
2. Theoretische Grundlagen: Hier werden die grundlegenden Konzepte des Controllings und dessen Rolle im Entscheidungsprozess erläutert. Der Fokus liegt auf der Aufgabenentwicklung des Controllings und seiner Bedeutung für fundierte Make-or-Buy-Entscheidungen.
3. Charakterisierung von Make-or-Buy-Entscheidungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Make-or-Buy und grenzt ihn von verwandten Begriffen wie Fertigungstiefe, vertikaler Integration, Outsourcing und Insourcing ab. Es werden Unternehmensbereiche identifiziert, in denen Make-or-Buy-Entscheidungen relevant sind, sowie die verschiedenen Arten von Make-or-Buy-Entscheidungen differenziert. Die Auswirkungen von Make-or-Buy-Entscheidungen auf das Unternehmen werden analysiert, ebenso wie typische Anlässe für solche Entscheidungen. Schließlich werden die Vor- und Nachteile sowohl der Eigenfertigung als auch des Fremdbezugs detailliert dargestellt und gegenübergestellt.
4. Einflussgrößen und Instrumente der operativen Make-or-Buy-Entscheidungsfindung: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der operativen Entscheidungsfindung. Es werden die wichtigsten Einflussfaktoren und Zielgrößen identifiziert und verschiedene kostenrechnerische Ansätze wie die Kostenvergleichsrechnung, Prozesskostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung und Investitionsrechnung vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für Make-or-Buy-Entscheidungen bewertet. Probleme bei der Bewertung von Zwischenformen des Make-or-Buy werden thematisiert, und eine Überleitung zu strategischen Aspekten erfolgt.
5. Einflussgrößen und Modelle strategischer Make-or-Buy-Entscheidungen: Dieses Kapitel widmet sich den strategischen Aspekten der Make-or-Buy-Entscheidung. Es werden qualitative Einflussfaktoren wie die Transaktionskostentheorie, der ressourcenorientierte Ansatz, der Ansatz von Porter und der Ansatz von Harrigan vorgestellt und analysiert. Zusätzlich werden verschiedene Instrumente zur qualitativen strategischen Entscheidungsfindung, wie z.B. das Make-or-Buy-Portfolio und die Nutzwertanalyse, behandelt.
6. Vorgehensweise am Beispiel der Fraunhofer IPA: In diesem Kapitel wird die praktische Anwendung der im vorherigen Kapitel beschriebenen theoretischen Konzepte und Methoden anhand eines konkreten Beispiels aus der Praxis, der Fraunhofer IPA, illustriert. Dies erlaubt eine Veranschaulichung der Vorgehensweise und Anwendung der vorgestellten Ansätze.
Schlüsselwörter
Make-or-Buy, Controlling, Kostenrechnung, strategische Planung, operative Planung, Transaktionskostentheorie, Ressourcenorientierter Ansatz, Porter, Harrigan, Outsourcing, Insourcing, vertikale Integration, Fertigungstiefe, Entscheidungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Make-or-Buy-Entscheidungen im industriellen Bereich"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit Make-or-Buy-Entscheidungen im industriellen Kontext. Sie analysiert die relevanten Einflussfaktoren, sowohl operativer als auch strategischer Natur, und untersucht verschiedene Entscheidungsmodelle zur optimalen Wahl zwischen Eigenfertigung ("Make") und Fremdbezug ("Buy").
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition und Abgrenzung von Make-or-Buy-Entscheidungen, die Rolle des Controllings, operative und strategische Einflussfaktoren, quantitative und qualitative Entscheidungsansätze (Kostenrechnung, Transaktionskostentheorie, Ressourcenorientierter Ansatz, Porter, Harrigan), und die Anwendung der Modelle in der Praxis anhand eines Fallbeispiels.
Welche Arten von Einflussfaktoren werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen operativen und strategischen Einflussfaktoren. Zu den operativen Faktoren gehören vor allem kostenrechnerische Aspekte wie Kostenvergleichsrechnung, Prozesskostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung und Investitionsrechnung. Strategische Faktoren umfassen qualitative Aspekte wie die Transaktionskostentheorie, der ressourcenorientierte Ansatz, der Ansatz von Porter und der Ansatz von Harrigan.
Welche Methoden und Modelle werden angewendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Methoden und Modelle zur Entscheidungsfindung, darunter quantitative Ansätze wie die Kostenvergleichsrechnung und qualitative Ansätze wie die Transaktionskostentheorie und den ressourcenorientierten Ansatz. Zusätzlich werden Instrumente wie das Make-or-Buy-Portfolio und die Nutzwertanalyse vorgestellt.
Wie wird die praktische Anwendung der Modelle veranschaulicht?
Die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte und Methoden wird anhand eines Fallbeispiels der Fraunhofer IPA illustriert. Dieses Beispiel dient dazu, die Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung zu veranschaulichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Charakterisierung von Make-or-Buy-Entscheidungen, Einflussgrößen und Instrumente der operativen Entscheidungsfindung, Einflussgrößen und Modelle strategischer Entscheidungen, Vorgehensweise am Beispiel der Fraunhofer IPA, und Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Make-or-Buy-Entscheidung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter, die die Arbeit charakterisieren, umfassen: Make-or-Buy, Controlling, Kostenrechnung, strategische Planung, operative Planung, Transaktionskostentheorie, Ressourcenorientierter Ansatz, Porter, Harrigan, Outsourcing, Insourcing, vertikale Integration, Fertigungstiefe, Entscheidungsmodelle.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Make-or-Buy-Entscheidungen im industriellen Umfeld auseinandersetzen. Sie bietet ein umfassendes Verständnis der relevanten Faktoren und Methoden zur Entscheidungsfindung.
- Quote paper
- Philmon Beiene (Author), 2014, Einflussgrößen bei Make-or-buy-Entscheidungen im industriellen Bereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300517