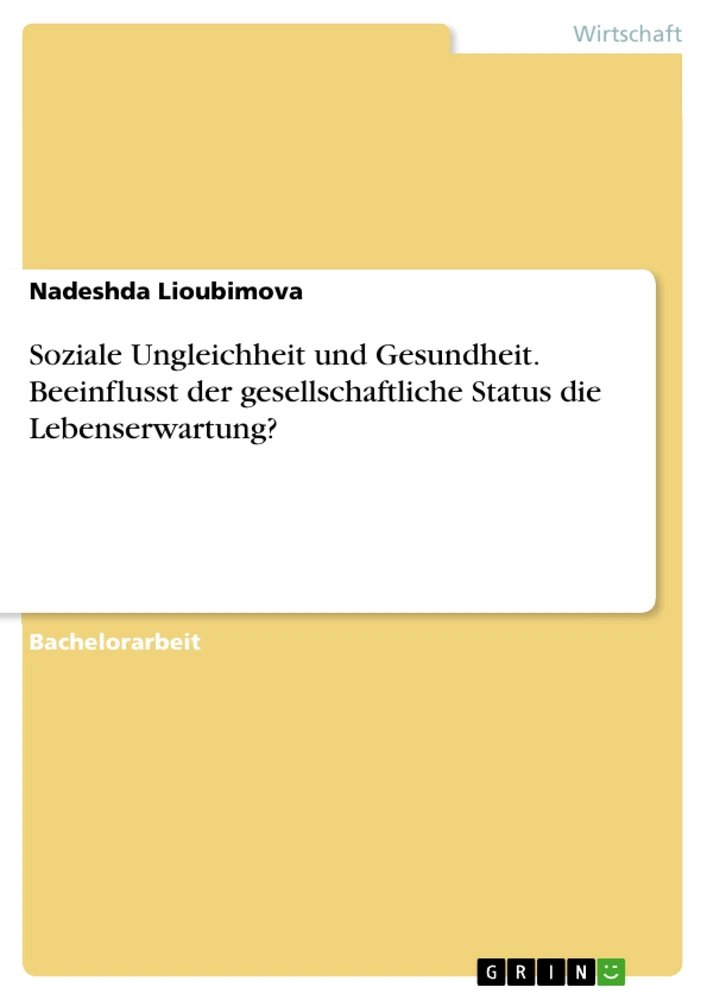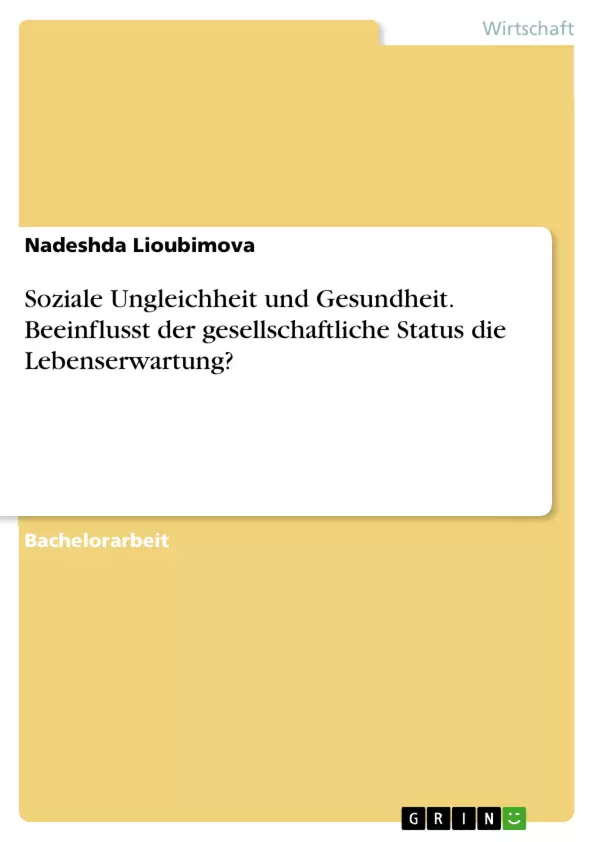In der Vergangenheit hat man das Thema „soziale Ungleichheit“ als einen Erklärungsfaktor der Mortalität und Morbidität weitgehend ignoriert und versuchte, die Lebenserwartung der Bevölkerung durch einen besseren Zugang zu medizinischen Leistungen zu erhöhen. Mehrere Studien zeigen, dass die Effizienz dieser Methode mit der steigenden Versorgung sinkt.
Wenn man heute die häufigsten Todesursachen in den OECD-Ländern anschaut, wird einem schnell klar, dass die Medizin an ihre Grenzen stößt und eine weitere Ausweitung der medizinischen Leistung nicht unbedingt die beste Lösung ist. Viele chronische Krankheiten können nur symptomatisch behandelt und nie vollständig auskuriert werden. Die Behandlung ist meistens sehr zeit- und kostenintensiv, was zu einer Belastung des Staatshaushalts führt.
In dieser Arbeit untersucht die Autorin die folgenden Fragestellugen: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der Gesundheit? Und wird unsere Gesundheit von unserem sozialen Status beeinflusst oder unser sozialer Status von der körperlichen Fitness?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialer Status und Lebenserwartung
- Sozialer Status und Morbidität
- Herzkreislauf-Erkrankungen
- Diabetes melitus
- Krebserkrankungen
- Psychische Morbidität
- Erklärungsansätze
- Soziale Kontakte
- Einkommensungleichverteilung
- Angst
- Drogenkonsum
- Störung des Essverhaltens
- Vertrauen
- Gewalt
- Mangel an öffentlichen Gütern
- Einkommenspolarisation
- Macht uns die Armut krank oder die Krankheit arm?
- Übermäßiges Alkoholkonsum
- Ernährung
- Einkommen der Eltern bei der Geburt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheit. Sie verfolgt das Ziel, aufzuzeigen, ob und in welcher Weise der soziale Status die Gesundheit beeinflusst. Hierbei werden sowohl die Lebenserwartung als auch die Morbidität in den Fokus genommen.
- Zusammenhang zwischen sozialem Status und Lebenserwartung
- Status-spezifische Krankheiten und deren Einfluss auf die Gesundheit
- Erklärungsansätze für die Verbindung von sozialem Status und Gesundheit
- Mögliche Kausalität: Macht die Armut krank oder die Krankheit arm?
- Bedeutung des sozialen Status für die Gesundheit im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des sozialen Status als Erklärungsfaktor für Gesundheit und Lebenserwartung und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel werden Studien zur Korrelation von Lebenserwartung und sozialem Status analysiert, während im dritten Kapitel verschiedene status-spezifische Krankheiten und deren Einfluss auf die Gesundheit erläutert werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit Erklärungsansätzen für die beobachteten Zusammenhänge. Im fünften Kapitel wird die Frage nach der Kausalität untersucht, d. h. ob die Armut krank macht oder die Krankheit arm.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit widmet sich den zentralen Themenbereichen soziale Ungleichheit, Gesundheit, Lebenserwartung, Morbidität, sozialer Status, Einkommensungleichverteilung, Einkommenspolarisation, Gesundheitsverhalten und gesellschaftliche Determinanten der Gesundheit. Die Arbeit analysiert die Forschungsliteratur zu diesem Themenkomplex und untersucht empirische Studien, die den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheit beleuchten.
- Citar trabajo
- Nadeshda Lioubimova (Autor), 2013, Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Beeinflusst der gesellschaftliche Status die Lebenserwartung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300529