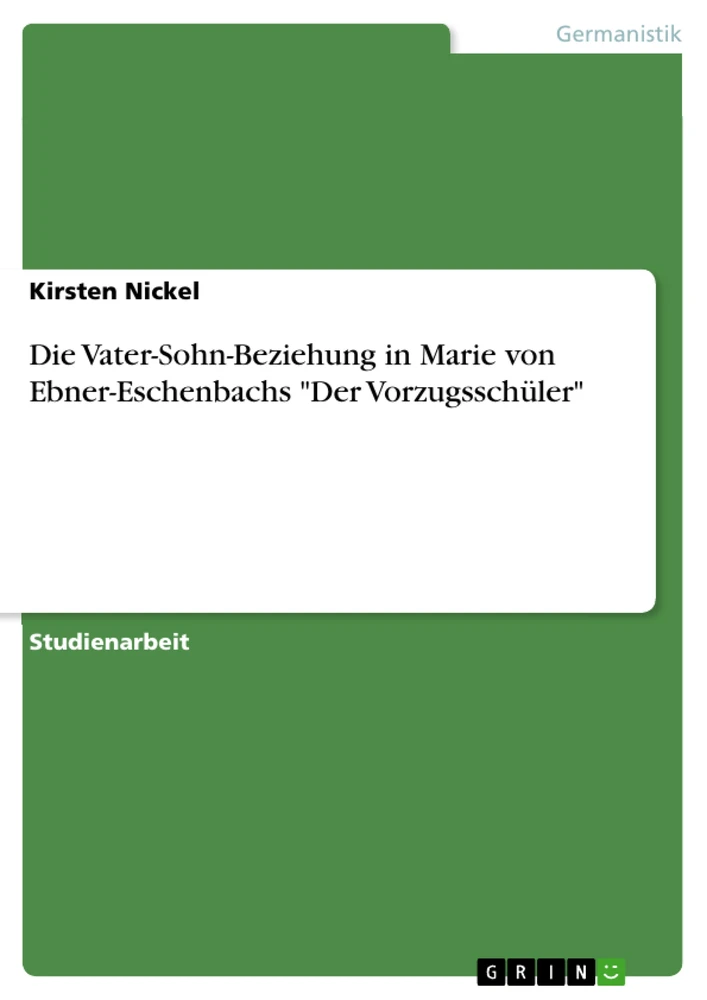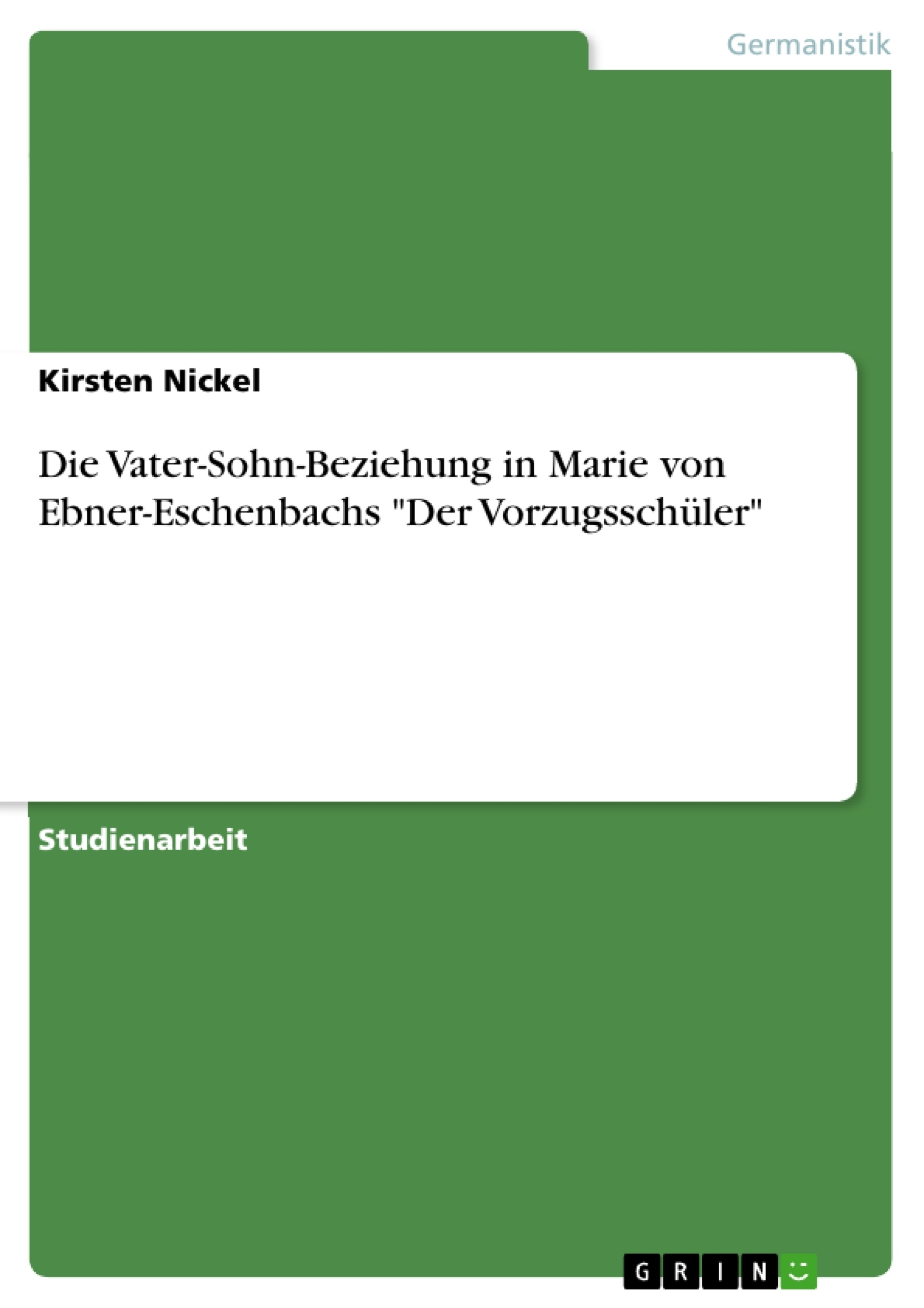An der Schwelle zum 20. Jahrhundert beschäftigten sich viele namhafte Schriftsteller in ihren Werken mit dem Schülerselbstmord. Dazu gehören unter anderem Marie von Ebner-Eschenbachs (1830 – 1916) "Der Vorzugsschüler" (1898), "Frühlings Erwachen" (1891) von Frank Wedekind, "Die Turnstunde" (1902) von Rainer Maria Rilke, "Freund Hein" (1902) von Emil Strauß und "Unterm Rad" (1906) von Hermann Hesse.
Die Besonderheit von Schülerselbstmord in der Literatur der Jahrhundertwende im Falle von Marie Ebner-Eschenbachs "Der Vorzugsschüler" ist nun, dass gerade nicht das Schulsystem angeklagt wird, ein junges Leben zu zerstören, sondern dass als Quelle des Leistungsdrucks einzig der Vater beschrieben wird.
Die Arbeit beleuchtet, wie Ebener-Eschenbach über die Darstellung der Vater-Sohn-Beziehung die bestehende kleinbürgerliche Gesellschaft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in den Blick nimmt und kritisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Erzählung
- Die Figur des Sohnes Georg
- Die Figur des Vaters Offizial Pfanner
- Zur Beziehung von Vater und Sohn
- Die Figuren als Funktionsträger für Gesellschaftskritik
- Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Erzählung "Der Vorzugsschüler" von Marie von Ebner-Eschenbach befasst sich mit der komplexen Vater-Sohn-Beziehung im Kontext kleinbürgerlicher Lebensentwürfe am Ende des 19. Jahrhunderts. Der Text untersucht die Auswirkungen von Leistungsdruck und dem unerbittlichen Streben nach sozialem Aufstieg auf die Psyche des Sohnes.
- Die zerstörerische Kraft von elterlichem Druck
- Die Rolle der kleinbürgerlichen Lebensentwürfe
- Die Überforderung des Sohnes durch die Erwartungen des Vaters
- Die Grenzen der Leistungsfähigkeit und die Folgen der Überforderung
- Die Funktion der Figuren als Repräsentanten gesellschaftlicher Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext von Schülerselbstmord in der Literatur der Jahrhundertwende dar und hebt die Besonderheit von Ebner-Eschenbachs "Der Vorzugsschüler" hervor. Im Gegensatz zu anderen Werken, die das Schulsystem als Verursacher des Leistungsdrucks anklagen, fokussiert Ebner-Eschenbach auf die destruktive Rolle des Vaters.
Zur Erzählung
Die Erzählung schildert einige Wochen im Leben der Familie Pfanner, deren Lebensentwurf vom unbändigen Aufstiegswillen des Vaters geprägt ist. Der auktoriale Erzähler legt den Fokus auf die Handlung, die sich um den Leistungsdruck dreht, der auf den Sohn Georg ausgeübt wird.
Die Figur des Sohnes Georg
Georg ist ein 13-jähriger Schüler, der unter dem enormen Druck steht, als "Vorzugsschüler" hervorzustechen. Die Erzählung zeichnet ein Bild von Georgs zunehmender Überforderung und seinem Kampf gegen die Erwartungen des Vaters.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema in "Der Vorzugsschüler"?
Das zentrale Thema ist die destruktive Vater-Sohn-Beziehung, geprägt durch extremen Leistungsdruck und den Aufstiegswillen des Vaters.
Warum unterscheidet sich Ebner-Eschenbachs Werk von Zeitgenossen?
Während andere Autoren (z.B. Hesse oder Wedekind) das Schulsystem anklagen, sieht Ebner-Eschenbach die Ursache für das Leid des Schülers primär in der Familie.
Welche Rolle spielt der Vater, Offizial Pfanner?
Er fungiert als Repräsentant einer kleinbürgerlichen Gesellschaft, die sozialen Status über das Wohlbefinden des Individuums stellt.
Wie wird der Sohn Georg charakterisiert?
Georg ist ein 13-jähriger Junge, der an den unerfüllbaren Erwartungen zerbricht und dessen psychische Überforderung im Fokus der Erzählung steht.
Was kritisiert die Autorin an der Gesellschaft der Jahrhundertwende?
Sie kritisiert die unerbittlichen Leistungsnormen und die Unterdrückung von Individualität zugunsten eines äußeren Scheins von Erfolg.
- Citar trabajo
- Kirsten Nickel (Autor), 2014, Die Vater-Sohn-Beziehung in Marie von Ebner-Eschenbachs "Der Vorzugsschüler", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300541