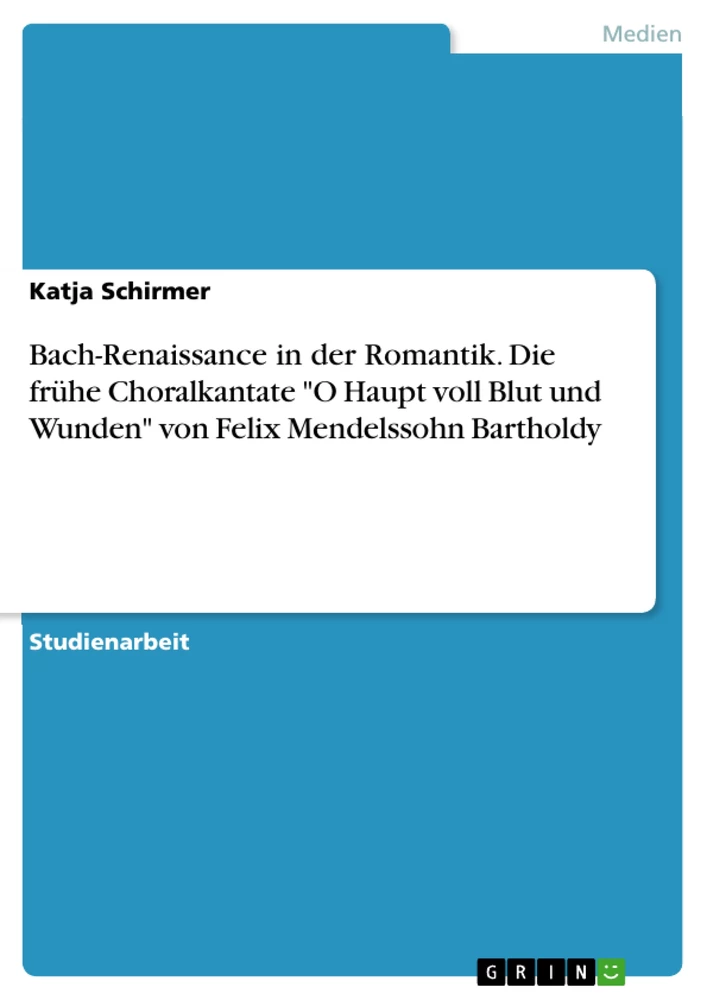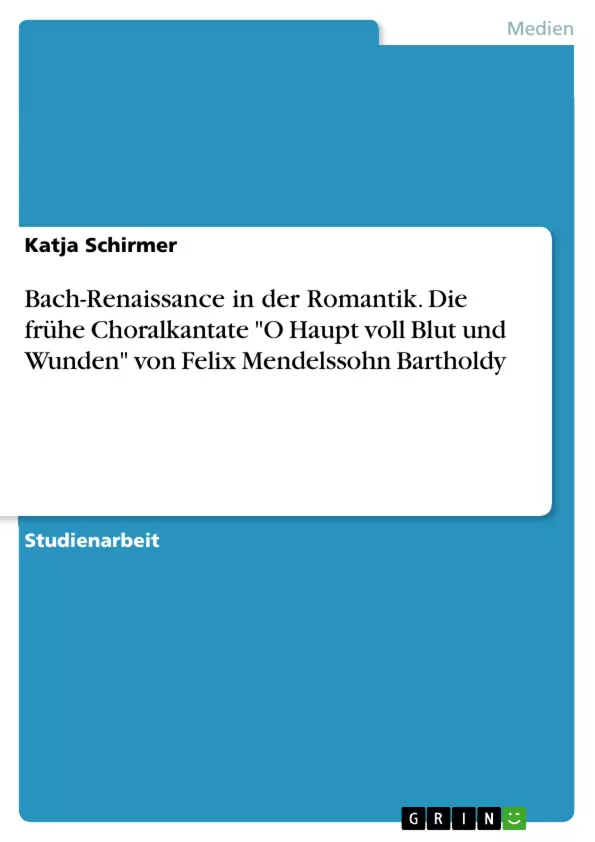Der Protestantismus hatte seit der Reformation bis zu Johann Sebastian Bach eine vielgestaltige Kirchenmusik hervorgebracht, die mehr von der weltlichen als von der katholischen Musik beeinflusst wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts verfiel die Bedeutung und das Niveau der evangelischen Kirchenmusik. Die Kantaten von Johann Sebastian Bach wurden schon bald nach seinem Tod nicht mehr aufgeführt, denn man kritisierte ihre Kompliziertheit. Auch die Kirchenkantate als eine speziell evangelische Musikgattung fiel den geänderten Umständen zum Opfer. Zwischen 1750 und 1790, also in der vorklassischen Epoche, klafft eine große Lücke in den musikgeschichtlichen Darstellungen über evangelische Kirchenmusik. Der Text wird zu einer allgemein frommen Betrachtungsweise und löst sich mehr und mehr vom liturgischen Sujet des Tages.
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Beginn der Romantik und des Historismus nimmt auch die Bedeutung von Kirchenmusik wieder zu. Die alte Musik von Palestrina bis Bach wird neu entdeckt und viele Musiker versuchen wieder, Kirchenmusik zu schreiben und zur Aufführung zu bringen: meist jedoch im Konzertsaal. Doch Kirchenmusik bleibt eine Randerscheinung und wird von den Musikkritikern der Zeit entweder belächelt oder mit einer gewissen Sorge betrachtet, da sich die Komponisten der Funktion von Kirchenmusik im Gottesdienst gar nicht bewusst waren und diese ihrer Funktion beraubten.
Die vorliegende Hausarbeit versucht diesbezüglich zu klären, warum die Kirchenmusik im beginnenden
19. Jahrhundert kaum Beachtung fand und trotzdem heute wie damals kontrovers diskutiert wird und
wurde. Es soll versucht werden, die problematische Stellung der Kirchenmusik Anfang des 19. Jahrhunderts zu verdeutlichen und zu klären, welche Rolle Felix Mendelssohn - Bartholdy in diesem Zusammenhang spielte. Wo war Mendelssohn ein Kind seiner Zeit, wo griff er auf Vergangenes zurück? Und ist Mendelssohns kirchenmusikalisches Frühwerk als so unbedeutend zu werten, wie es wahrgenommen wird?
Anhand der Choralkantate „O Haupt voll Blut und Wunden“, welche Mendelssohn nach intensiver Beschäftigung mit Werken von Johann Sebastian Bach schon 1830 komponierte, soll versucht werden die musikalische Beziehung Mendelssohns zu seinem großen Vorbild Bach zu analysieren. Außerdem soll die Hausarbeit zeigen, dass Mendelssohn in seinem kirchenmusikalischen Schaffen schon relativ früh ganz eigene Wege beschritt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Voraussetzungen für Mendelssohns kirchenmusikalisches Schaffen
- 2.1. Die ästhetische Problematik geistlicher Musik im 19. Jahrhundert
- 2.2. Der romantische Historismus oder die „Wiedererweckung Bachs“
- III. Felix Mendelssohn Bartholdy – Traditionalist oder Erneuerer?
- 3.1. Mendelssohns kirchenmusikalisches Schaffen - ein Überblick
- 3.2. Mendelssohns Frühwerk im Zusammenhang mit der Wiederaufführung der Matthäuspassion 1829
- IV. Johann Sebastian Bach und die evangelische Kirchenmusik
- 4.1. Die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik vor Bach
- 4.2. Die Bedeutung von Kontrafaktur in der evangelischen Kirchenmusik
- 4.3. Die besondere Stellung des Chorals in der evangelischen Kirchenmusik
- 4.4. Die Entstehungsgeschichte der Kantate
- 4.4.1. Die Kantatenentwicklung vor Bach
- 4.4.2. Die Choralkantate
- 4.4.3. Das Kantatenschaffen Bachs
- 4.5. Der II. Leipziger Jahrgang 1724/1725 und die späten Kantaten Bachs
- 4.5.1. Das „Choralkantatenjahr“ 1724/1725
- 4.5.2. Bachs Rückkehr zur älteren Kantatenform und seine deutliche Distanzierung von den Gattungsnormen der Zeit
- V. Analyse
- 5.1. Die Entstehungsgeschichte des Kirchenliedes „O Haupt voll Blut und Wunden“
- 5.2. Harmonische Analyse der Bach'schen Choräle auf das Kirchenlied „O Haupt voll Blut und Wunden“
- 5.2.1. Die Verwendung des Kirchenliedes in der Matthäuspassion
- 5.2.1.1. „Befiehl du deine Wege“ (Matthäuspassion)
- 5.2.1.2. „O Haupt voll Blut und Wunden“ (Matthäuspassion)
- 5.2.1.3. „Wenn ich einmal soll scheiden“ (Matthäuspassion)
- 5.2.2. Choral: „Wie soll ich dich empfangen“ (Weihnachtsoratorium)
- 5.2.3. Choral: „Der Leib zwar in der Erden“ (Kantate BWV 161)
- 5.2.4. Arie „Ich folge dir nach“ mit dem Choral „Ich will hier bei dir stehen“ (Kantate BWV 159)
- 5.2.5. Eingangschor „Ach Herr mich armen Sünder“ (Kantate BWV 135)
- 5.2.1. Die Verwendung des Kirchenliedes in der Matthäuspassion
- 5.3. Ein Vergleich der Choräle in Bezug auf Bachs Verhältnis zwischen Kontrapunktik und Harmonie
- 5.4. Die Choralkantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy
- 5.4.1. Die Entstehung der „Choralkantate“
- 5.4.2. Der allgemeine Aufbau des Werkes
- 5.4.3. 1. Chor. Andante
- 5.4.4. 2. Aria. Andante con moto
- 5.4.5. 3. Choral. Allegro moderato
- 5.5. Bach und Mendelssohn - ein Vergleich der Werke
- VI. Zusammenfassung
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der problematischen Stellung der Kirchenmusik im frühen 19. Jahrhundert und der Rolle, die Felix Mendelssohn Bartholdy in diesem Zusammenhang spielte. Die Arbeit untersucht die Gründe für die geringe Bedeutung der Kirchenmusik Anfang des 19. Jahrhunderts und die kontroversen Diskussionen, die sie hervorrief. Sie beleuchtet, inwiefern Mendelssohn ein Kind seiner Zeit war und gleichzeitig auf vergangene Traditionen zurückgriff. Die Arbeit stellt die Frage, ob Mendelssohns kirchenmusikalisches Frühwerk, das oft als unbedeutend angesehen wird, tatsächlich so unbedeutend ist.
- Die ästhetische Problematik geistlicher Musik im 19. Jahrhundert
- Die Wiedererweckung Bachs im Kontext des romantischen Historismus
- Mendelssohns kirchenmusikalisches Schaffen im Kontext seiner Zeit
- Der Einfluss Bachs auf Mendelssohns Kompositionsweise
- Analyse der Choralkantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Mendelssohn
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I bietet eine Einleitung zum Thema, beleuchtet den historischen Hintergrund der evangelischen Kirchenmusik und stellt die zentrale Forschungsfrage der Hausarbeit vor. Kapitel II erörtert die ästhetischen Herausforderungen, vor denen die geistliche Musik im 19. Jahrhundert stand, sowie den Einfluss des romantischen Historismus auf die Wiederentdeckung Bachs. Kapitel III widmet sich dem kirchenmusikalischen Schaffen von Mendelssohn Bartholdy, untersucht sein Verhältnis zu Bach und stellt die Frage, ob er ein Traditionalist oder ein Erneuerer war. Kapitel IV beleuchtet die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik vor Bach und fokussiert auf die Bedeutung von Kontrafaktur und Chorälen sowie die Entwicklung der Kantate. Kapitel V analysiert die Choralkantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Mendelssohn und vergleicht sie mit den Chorälen Bachs, um den Einfluss des großen Vorbilds auf Mendelssohns Kompositionsweise aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die evangelische Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, den Einfluss Bachs auf Mendelssohn Bartholdy, die Choralkantate als Gattung, die ästhetische Problematik geistlicher Musik im Kontext des Historismus, sowie die musikalische Analyse der Choralkantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Mendelssohn.
- Citar trabajo
- Katja Schirmer (Autor), 2003, Bach-Renaissance in der Romantik. Die frühe Choralkantate "O Haupt voll Blut und Wunden" von Felix Mendelssohn Bartholdy, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30061