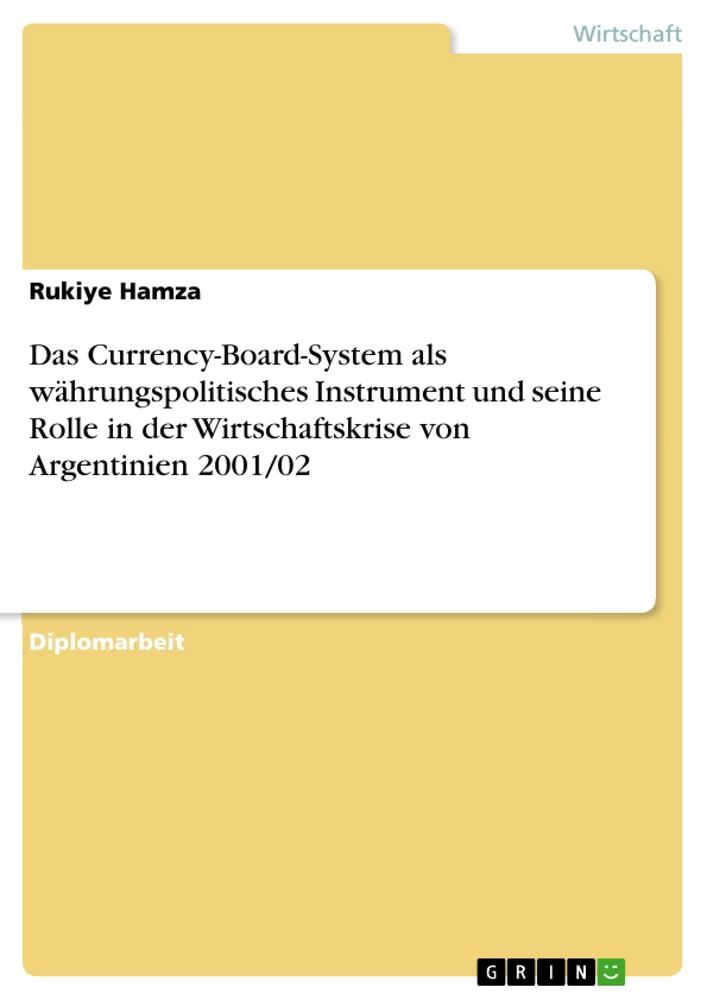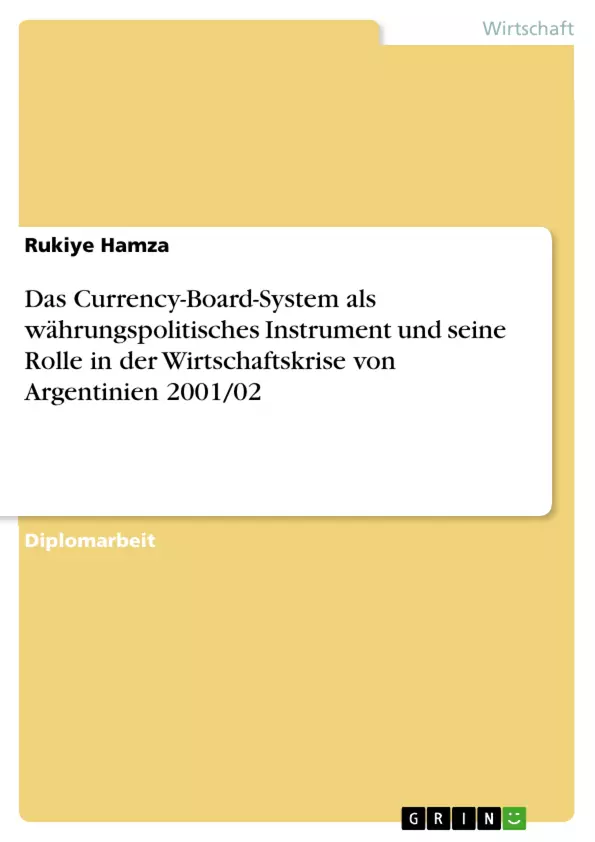Nachdem Currency-Board-Systeme lange Zeit von der wirtschaftspolitischen Agenda verschwanden, hat ihre Bedeutung in den 1990er Jahren sowohl in der ökonomischen Theorie als auch in der Wirtschaftspolitik wieder zugenommen. Das Currency-Board stammt ursprünglich aus der Kolonialzeit und wurde erstmals 1849 in der damaligen britischen Kolonie Mauritius eingeführt. Empirische Studien zeigen, dass Currency-Boards in inflationären Ökonomien, die durch eine instabile Währung und eine vertrauensunwürdige Geldpolitik geprägt sind, umgehend monetäre Stabilisierung hervorrufen können. Diese Eigenschaft macht sie gegenüber anderen Festkurssystemen überlegen. Da hohe Inflationsraten mit Wachstumsverlusten und realwirtschaftlichen Kosten verbunden sind, zielen Volkswirtschaften darauf ab, ihre Makroökonomie zu stabilisieren. In diesem Zusammenhang erhält die Wechselkurs- politik einen großen Stellenwert, da sie zentrales Element der Stabilitätspolitik ist und ohne monetäre Stabilität kein dauerhaftes Wachstum möglich ist.
So führte die Rezession in Argentinien Ende der 1980er Jahre, die durch eine Hyperinflation und negative Wachstumsraten gekennzeichnet war, dazu, dass die Regierung im Jahre 1991 den Plan-Cavallo mit dem „Currency-Board“ als Kernbestandteil einführte. Durch die Bindung der Landeswährung an den stabilen US-Dollar sollte zum einen das Preisniveau stabilisiert und zum anderen das Vertrauen in die nationale Währung hergestellt werden. Der wesentliche Erfolg des „Currency-Board“ war, dass bis Mitte der 1990er Jahre die Inflationsrate auf unter 4% sank und durchschnittlich eine Wachstumsrate von 8% erzielt wurde. Die Inflationsbekämpfung geschah jedoch zu hohen Kosten. Der Plan-Cavallo führte zu einem Prozess der Auslandsverschuldung und scheiterte an der Unfähigkeit der Regierung, das Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu halten. Durch die feste Bindung des Wechselkurses an den US-Dollar verlor die Zentralbank ihre geldpolitische Autonomie und somit die Kontrolle über die makroökonomische Entwicklung. Das monetäre System erwies sich als nicht souverän genug, um reale Wechselkurs- ungleichgewichte auszugleichen und ökonomische Schocks zu absorbieren. Im Januar 2002 schließlich wurde der Peso abgewertet und das „Currency-Board“ aufgelöst....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil: Das Currency-Board als währungspolitisches Instrument zur makroökonomischen Stabilisierung
- Konzept des Currency-Board
- Definition orthodoxer und moderner Currency-Boards
- Institutionelle Grundzüge eines Currency-Board
- Currency-Board versus Zentralbank
- Currency-Board und Trilemma-Modell: Aufgabe der autonomen Geldpolitik – um welchen Preis?
- Funktionsweise eines Currency-Board
- Konvergenz der Zinssätze nach der Zinsparitätentheorie
- Angleichung der Preisniveaus nach der Kaufkraftparitätentheorie
- Einhaltung des Wechselkursziels
- Optimale Voraussetzungen für die Einführung eines Currency-Board
- Für welche Ökonomien eignet sich das Currency-Board?
- Adäquate Wahl der Ankerwährung: Theorie der Optimalen Währungsräume
- Flexible Faktor- und Gütermärkte: Das „Standard Dependent Economy Model“
- Anpassungsprozesse beim Currency-Board bei inflexiblen Güterpreisen
- Anpassungsprozesse beim Currency-Board bei flexiblen Güterpreisen
- Anpassungsmechanismen bei flexiblen Faktormärkten
- Monetäre Disziplin und Glaubwürdigkeit
- Stabiles Banken- und Finanzsystem
- Fiskaldisziplin
- Vor- und Nachteile eines Currency-Board
- Zwischenergebnisse
- Konzept des Currency-Board
- II. Teil: Die Rolle des „Currency-Board“ in der Argentinienkrise 2001/02
- Die wirtschaftliche Ausgangslage in Argentinien (1989-91)
- Das argentinische „Currency-Board“ im Rahmen des Plan-Cavallo
- Das argentinische „Currency-Board”-Modell
- War das „Konvertibilitätssystem“ tatsächlich ein Currency-Board?
- Verletzung der institutionellen Grundzüge
- Geldpolitischer Spielraum
- Waren die klassischen Kriterien für ein Currency-Board erfüllt?
- Größe und Offenheit der Ökonomie
- Hatte Argentinien den richtigen Peg?
- Flexibilität der Güter- und Faktormärkte
- Stabilität des Banken- und Finanzsystems
- Fiskaldisziplin
- Effekte auf die makroökonomische Entwicklung
- Der Weg zu Prosperität: 1991-94
- Rezession und Aufschwung: 1995-98
- Rezession und Krise: 1998-2002
- Die Rolle des „Currency-Board“ in der Argentinienkrise
- Dollarisierung als währungspolitische Alternative
- III. Gesamtergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Currency-Board-System als währungspolitisches Instrument und dessen Rolle in der Wirtschaftskrise Argentiniens in den Jahren 2001/02. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise und die Vor- und Nachteile eines Currency-Boards im Kontext der makroökonomischen Stabilisierung. Darüber hinaus untersucht sie die Anwendung des Currency-Board-Systems in Argentinien, die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Bedeutung des Systems für die Krise.
- Das Konzept des Currency-Board und seine Funktionsweise
- Die optimalen Voraussetzungen für die Einführung eines Currency-Boards
- Die Rolle des Currency-Boards in der Argentinienkrise 2001/02
- Die Auswirkungen des Currency-Boards auf die makroökonomische Entwicklung Argentiniens
- Die Analyse der Ursachen für die argentinische Wirtschaftskrise im Kontext des Currency-Board-Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Currency-Board-Systems ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel.
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Currency-Boards als währungspolitisches Instrument zur makroökonomischen Stabilisierung. Er definiert verschiedene Arten von Currency-Boards, erläutert die institutionellen Grundzüge und die Funktionsweise des Systems. Außerdem werden die Vor- und Nachteile eines Currency-Boards sowie die optimalen Voraussetzungen für dessen Einführung diskutiert.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Rolle des Currency-Boards in der Argentinienkrise 2001/02. Er analysiert die wirtschaftliche Ausgangslage Argentiniens vor der Einführung des Currency-Boards im Jahr 1991 und untersucht die Auswirkungen des Systems auf die makroökonomische Entwicklung des Landes. Darüber hinaus wird die Frage behandelt, ob das argentinische Currency-Board tatsächlich den klassischen Kriterien entsprach und welche Rolle das System für die Krise gespielt hat.
Der dritte Teil der Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Currency-Board, Argentinien, Wirtschaftskrise, Makroökonomische Stabilisierung, Wechselkurs, Inflation, Zinssätze, Fiskalpolitik, Monetäre Politik, Finanzsystem, Dollarisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Currency-Board-System?
Ein Currency-Board ist ein festes Wechselkurssystem, bei dem die heimische Währung zu 100% durch Reserven einer stabilen Ankerwährung (z.B. US-Dollar) gedeckt ist.
Warum scheiterte das Currency-Board in Argentinien 2001/02?
Das System scheiterte an mangelnder Fiskaldisziplin, einer hohen Auslandsverschuldung und der Unfähigkeit, auf externe ökonomische Schocks flexibel zu reagieren.
Was war der „Plan-Cavallo“?
Der Plan-Cavallo war das 1991 eingeführte Reformpaket in Argentinien, das die Hyperinflation durch die Bindung des Peso an den Dollar beenden sollte.
Welche Vorteile bietet ein Currency-Board?
Es schafft sofortige monetäre Stabilität, senkt die Inflationsraten drastisch und erhöht das Vertrauen internationaler Investoren in die Währung.
Was ist der Unterschied zwischen einem Currency-Board und einer Zentralbank?
Ein Currency-Board hat keine geldpolitische Autonomie; es kann die Geldmenge nicht unabhängig steuern oder als „Lender of Last Resort“ fungieren.
- Quote paper
- Diplom-Volkswirtin Rukiye Hamza (Author), 2007, Das Currency-Board-System als währungspolitisches Instrument und seine Rolle in der Wirtschaftskrise von Argentinien 2001/02, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300666