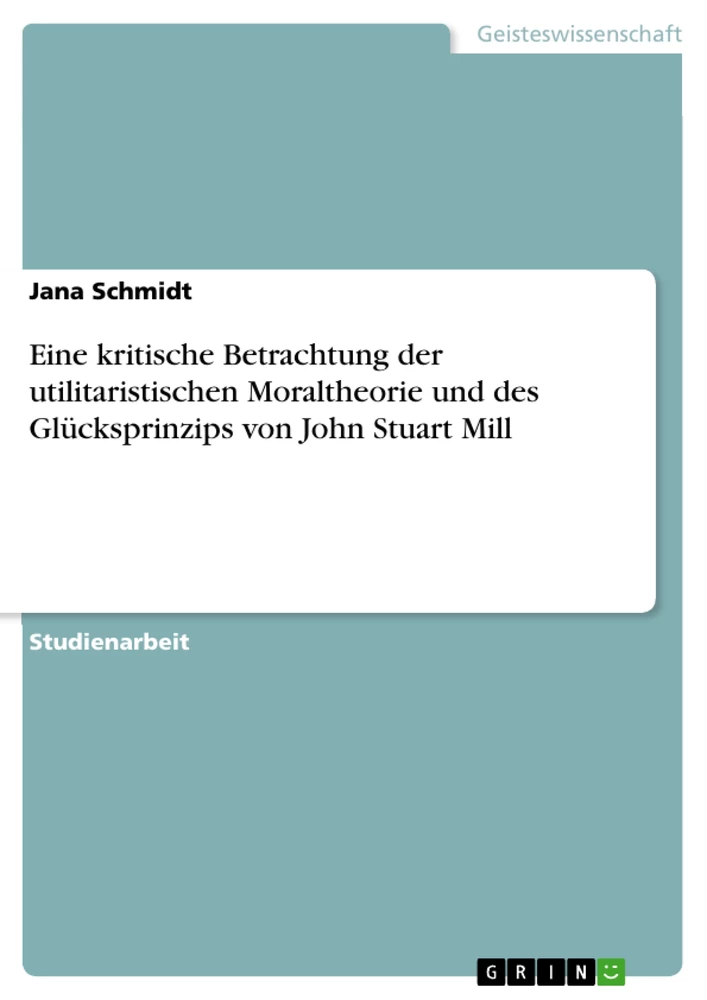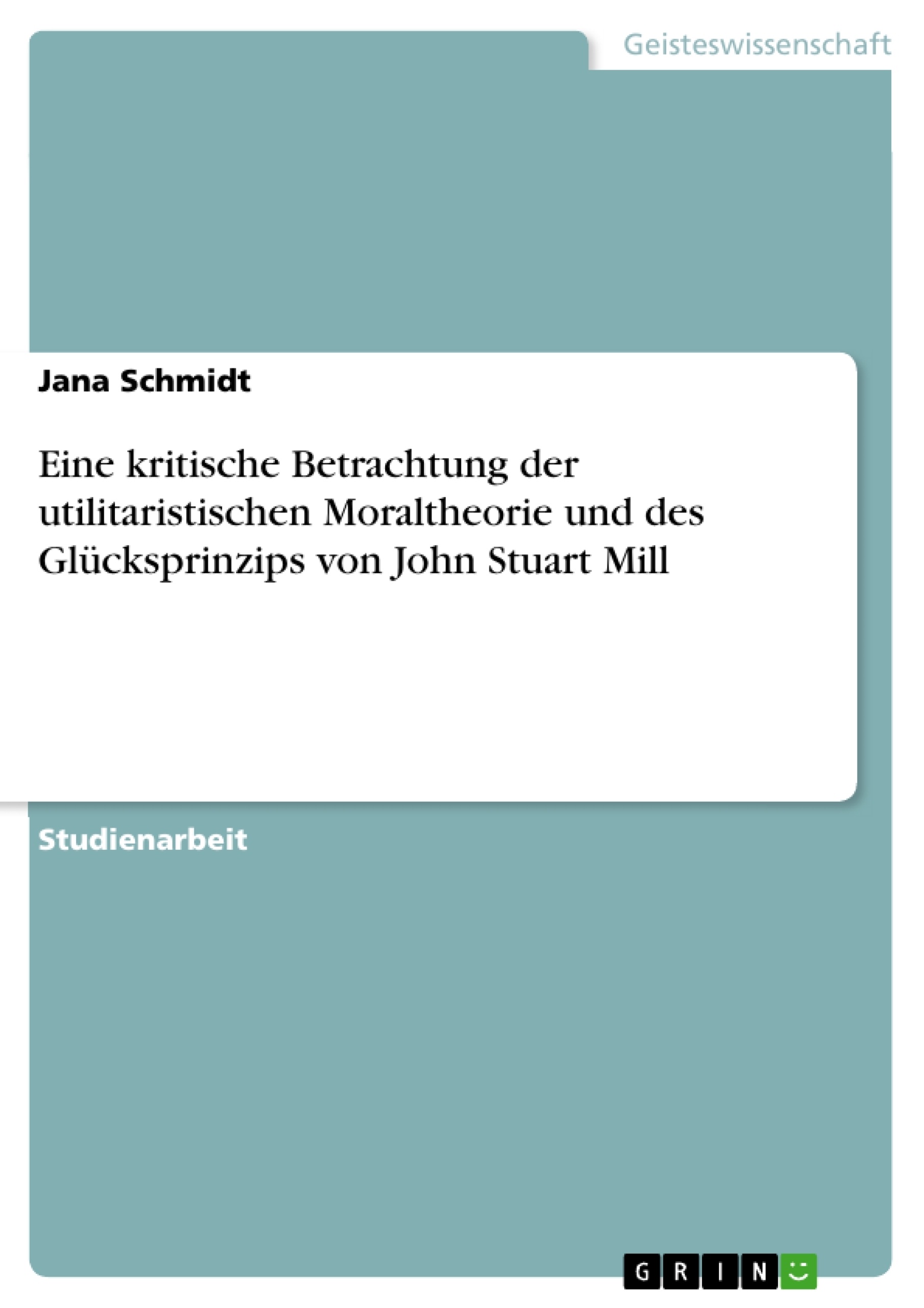John Stuart Mill war ein bedeutender Vertreter des Utilitarismus. In seinem Werk "Der Utilitarismus" erläutert er seine Auffassung der utilitaristischen Moraltheorie, verteidigt sie gegenüber Kritikern und versucht ihren Beweis darzustellen. In dieser Arbeit möchte ich Bezug auf sein zweites Kapitel "Was heißt Utilitarismus?" nehmen.
Der Utilitarismus hat die Nutzenmaximierung zum Ziel. Mill ist nicht Neubegründer dieser philosophischen Richtung. Er folgt damit seinem direkten Vorreiter Bentham. Er verteidigt die utilitaristische Grundidee gegenüber Einwänden und entwirft neue Aspekte, die bedeutsam für die heutige Auffassung der
utilitaristischen Moraltheorie sind. Mill stellt im zweiten Kapitel von "Der Utilitarismus" seine Moraltheorie dar und bezieht Stellung zu bereits voran gegangener Kritik. Die Moraltheorie und ihr auf Glück basierendes Prinzip sind eng miteinander verknüpft und die Abgrenzung daher nicht immer deutlich zu ziehen. Jedoch halte ich diese Abgrenzung für wichtig, da beide in ihrer Funktion unterschiedlich zu bewerten sind.
Um den Inhalt Mills utilitaristischer Theorie zu verdeutlichen, möchte ich demnach zunächst das Glücksprinzip versuchen darzustellen, das den Kern seiner Moraltheorie bildet um anschließend mit einer Darstellung der Moraltheorie fortzufahren. Während dieser Darstellungen möchte ich problematische Stellen bereits kritisch betrachten, da sie Probleme aufwerfen und Fragen hinterlassen. Im den Kapiteln 3 und 4 möchte ich spezielle Punkte aufgreifen, die im Rahmen dieser Arbeit noch einmal ausführlicher behandelt werden sollen. Diese Kritikpunkte drehen sich zunächst um das Erreichen der Nutzenmaximierung, bei der Probleme der Klassifizierung des Glücks und ihrer Umsetzung deutlich werden. Mill stellt mit seiner Moral hohe Ansprüche an die Menschen, von denen vor allem die Bewertung der Art des Glücks und der Anspruch einer unparteiischen Bewertung behandelt werden. Diese im Glücksprinzip auftretenden Probleme stehen im Zusammenhang mit der Frage nach der Integrität der Individuen, was im Anschluss diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was heißt Utilitarismus?
- Das Glücksprinzip
- Das Moralprinzip
- Einwände gegen die Glückstheorie - Das Überforderungsproblem
- Mills Ansprüche an die Menschen
- Die Unparteilichkeit als Problem
- Einwand gegen Mills Moralprinzip - Die Integrität der Individuen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert John Stuart Mills utilitaristische Moraltheorie, insbesondere sein Konzept des Glücks und seine Argumente für die Nutzung von Glück als Grundlage für moralische Entscheidungen. Die Arbeit untersucht, wie Mill den Utilitarismus verteidigt und neue Aspekte einführt, die für die heutige Auffassung dieser Moraltheorie relevant sind.
- Das Glücksprinzip im Utilitarismus: Mills Definition von Glück als Lust und das Fehlen von Unlust, sowie seine Argumentation für die Unterscheidung zwischen qualitativ hochwertigen und lediglich quantitativ hochwertigen Freuden.
- Die Kritik an Mills Glücksprinzip: Die Frage, ob diese Moraltheorie nur für Schweine geeignet sei, und die Herausforderung, die Unterscheidung zwischen sinnlichen und geistigen Freuden zu treffen.
- Mills Moralprinzip: Die Verbindung von Glück und moralischen Handlungen, und die Frage, wie die Tendenz zur Glücksbeförderung das moralische Handeln prägt.
- Die Überforderung des Einzelnen: Die Schwierigkeiten, die mit Mills anspruchsvollen Anforderungen an die Menschen verbunden sind, insbesondere die Bewertung von Glück und die Notwendigkeit unparteiischer Urteile.
- Die Integrität des Individuums: Die Frage, ob Mills Moralprinzip die Integrität des Einzelnen respektiert oder ob es zu einer Vernachlässigung individueller Bedürfnisse und Werte führt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt John Stuart Mill als Vertreter des Utilitarismus vor. Sie erklärt den Fokus auf Mills Werk "Der Utilitarismus" und insbesondere auf das zweite Kapitel "Was heißt Utilitarismus?".
Kapitel 2.1 "Das Glücksprinzip" beschreibt Mills Definition von Glück als Lust und das Fehlen von Unlust. Es beleuchtet die Kritik an dieser Definition, die darin besteht, dass sie nur für Schweine geeignet sei. Mill kontert diese Kritik, indem er zwischen sinnlichen und geistigen Freuden unterscheidet. Er argumentiert, dass höhere Fähigkeiten, wie der Verstand, die Empfindung und die Vorstellungskraft, zu qualitativ hochwertigeren Freuden führen, die denen von Tieren überlegen sind.
Kapitel 2.2 "Das Moralprinzip" stellt das Prinzip des größten Glücks vor, das die Grundlage von Mills utilitaristischer Moral bildet. Dieses Prinzip besagt, dass Handlungen insoweit moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern. Die Arbeit beleuchtet die beiden Ebenen des Prinzips: die Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Handlungen und die Proportionalität des moralischen Wertes mit dem Grad der Glücksbeförderung.
Kapitel 3 "Einwände gegen die Glückstheorie - Das Überforderungsproblem" untersucht die Kritik an Mills Glückstheorie, die darin besteht, dass sie zu hohe Ansprüche an die Menschen stellt. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit der Klassifizierung des Glücks und der Umsetzung des Prinzips des größten Glücks verbunden sind. Sie diskutiert die Probleme, die mit der Bewertung der Art des Glücks und mit dem Anspruch auf unparteiliche Bewertung verbunden sind.
Kapitel 4 "Einwand gegen Mills Moralprinzip - Die Integrität der Individuen" beleuchtet die Frage, ob Mills Moralprinzip die Integrität des Einzelnen respektiert. Es diskutiert die möglichen Konflikte zwischen dem Streben nach dem größten Glück für die Gesamtheit und den Bedürfnissen und Werten des Einzelnen.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Glücksprinzip, Moralprinzip, Lust, Unlust, höhere Fähigkeiten, niedere Fähigkeiten, geistige Freuden, sinnliche Freuden, Überforderungsproblem, Integrität, Unparteilichkeit, John Stuart Mill, Jeremy Bentham.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Grundprinzip von John Stuart Mills Utilitarismus?
Das Prinzip besagt, dass Handlungen moralisch richtig sind, wenn sie dazu tendieren, das größte Glück für die größte Zahl von Menschen zu befördern.
Wie definiert Mill den Begriff "Glück"?
Mill definiert Glück als Lust (pleasure) und das Freisein von Unlust (pain), wobei er zwischen qualitativen Stufen der Lust unterscheidet.
Was ist der Unterschied zwischen geistigen und sinnlichen Freuden?
Mill argumentiert, dass geistige Freuden (Verstand, Vorstellungskraft) qualitativ höherwertig sind als rein sinnliche (tierische) Freuden.
Was versteht man unter dem "Überforderungsproblem" im Utilitarismus?
Es beschreibt die Kritik, dass Mills Moraltheorie zu hohe Ansprüche an das Individuum stellt, stets unparteiisch zum Wohle der Allgemeinheit zu entscheiden.
Wie wird die Integrität des Individuums bei Mill kritisiert?
Kritiker hinterfragen, ob der Utilitarismus die persönlichen Projekte und Werte eines Menschen verletzt, wenn diese dem Gesamtnutzen untergeordnet werden müssen.
- Citation du texte
- Jana Schmidt (Auteur), 2012, Eine kritische Betrachtung der utilitaristischen Moraltheorie und des Glücksprinzips von John Stuart Mill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300768