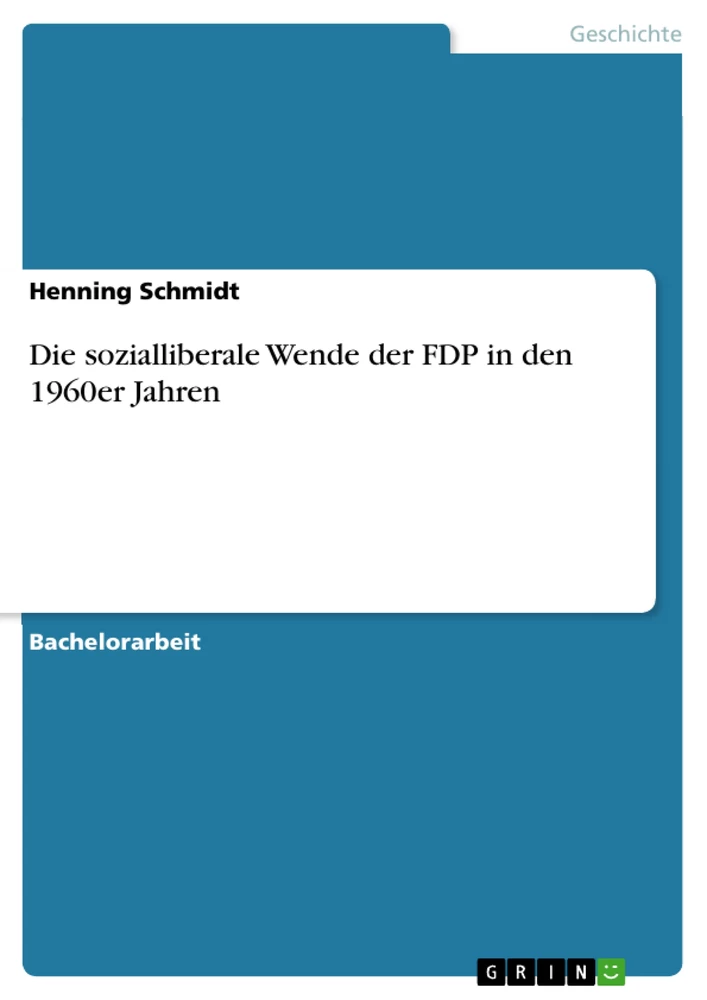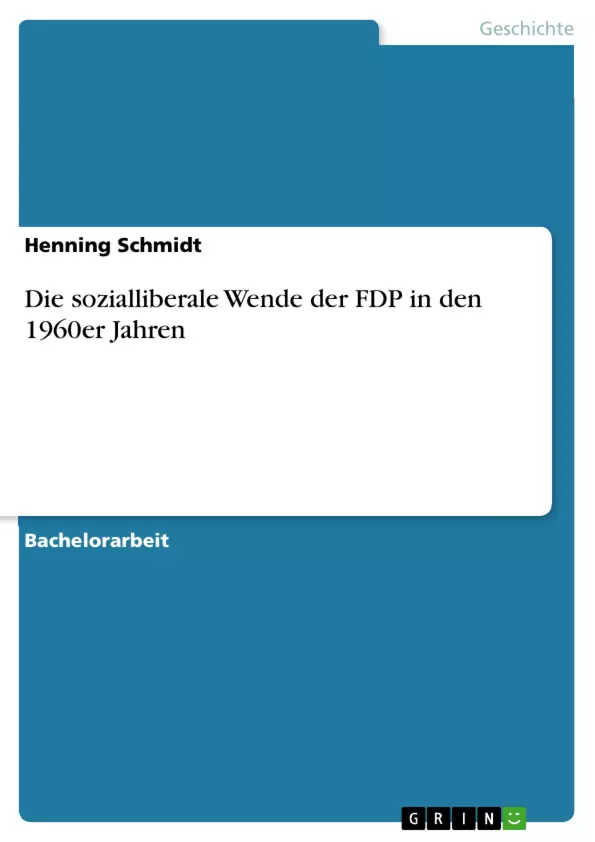Wer zu den jüngeren Zeitgenossen gehört, bringt mit der Freien Demokratische Partei wohl in erster
Linie Forderungen nach einem „niedrigeren, gerechteren und einfacheren“ Steuersystem in
Verbindung. Gefordert von einem Parteivorsitzenden namens Guido Westerwelle, der seine Partei
über fast ein Jahrzehnt hinweg auf dieses eine Ziel als absolute Prioritär einschwor. Einmal an der
Regierung und gestärkt von einem historischen Wahlerfolg, meldete Westerwelle Anspruch auf das
Außenministerium an. Das wichtigste Ministerium für eine Partei, die das Steuersystem radikal
umbauen möchte, das Finanzministerium, überließ man hingegen dem Koalitionspartner.
Als Konsequenz änderte sich am Steuersystem nichts Grundlegendes, während Westerwelle sich als
Außenminister nicht sonderlich gut schlug. Was nun offenkundig wurde: Die FDP hatte sich über
viele Jahre hinweg zu einer „Ein-Themen-Partei“ entwickelt und war für dieses eine Thema gewählt
worden. Mit der ausgebliebenen Reform wurde die Partei Opfer ihrer konsequent selbstgewählten
Entwicklung. Thematische Impulse konnte man – abgesehen vom durchaus erfolgreichen Einsatz
gegen die Vorratsdatenspeicherung und einem Anschließen an den Acta-Protest (2011) – nicht setzen.
Im Wahljahr 2013 wurde die FDP schließlich vernichtend abgestraft. Doch: Wenn davon gesprochen
wird, dass die FDP sich zu einer Ein-Themen-Partei entwickelt hat, impliziert es, dass sie dies eben
nicht immer war. Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll daher eine andere Entwicklung der FDP stehen:
Die Entwicklung der FDP zu einer sozialliberalen Partei in den 1960er Jahren.
In den vergangenen Jahrzehnten ist viel über die Ära erste Große Koalition sowie der sozialliberalen
Koalition geschrieben worden. Der Übergang von der einen zur anderen Koalition wurde bisher stark
aus einer Außenperspektive betrachtet. Mit dieser Arbeit soll begonnen werden, die Lücke zu
schließen, indem die Reden zusammenhängend analysiert werden, die auf den drei FDP-Parteitagen
von 1967 bis 1969 gehalten wurden. Anhand der Reden sollen die Wegmarken nachgezeichnet und
Gründe aufgezeigt werden, welche die FDP dazu bewegten, im Jahre 1969 eine Koalition mit der SPD
– dem einstigen „Klassenfeind“ – einzugehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Der FDP-Bundesparteitag 1967
- 2.1.1 Einleitender Teil
- 2.1.2 Analyse der Reden
- 2.2 Der FDP-Bundesparteitag 1968
- 2.2.1 Einleitender Teil
- 2.2.2 Analyse der Reden
- 2.3 Der FDP-Bundesparteitag 1969
- 2.3.1 Einleitender Teil
- 2.3.2 Analyse der Reden
- 2.1 Der FDP-Bundesparteitag 1967
- 3 Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der FDP zu einer sozialliberalen Partei in den 1960er Jahren, indem sie die Reden auf den FDP-Parteitagen von 1967 bis 1969 analysiert. Ziel ist es, die Wegmarken dieses Wandels nachzuzeichnen und die Gründe für die Koalition mit der SPD 1969 aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Parteitagsreden, um den ideologischen Wandel und die strategischen Entscheidungen der FDP zu verstehen.
- Wandel der FDP von einer nationalliberal-bürgerlichen zu einer sozialliberalen Partei
- Analyse der Reden auf den FDP-Parteitagen 1967-1969 als Indikatoren des Wandels
- Die Bedeutung des „befähigenden Liberalismus“ und die Relativierung abwehrender Freiheitsrechte
- Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Ralf Dahrendorf und Walter Scheel auf die politische Entwicklung
- Die ideologischen Grundlagen der sozialliberalen Koalition mit der SPD
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der FDP-Wahrnehmung in der jüngeren Vergangenheit hin zu einer „Ein-Themen-Partei“ (Steuern) im Gegensatz zu ihrer sozialliberalen Entwicklung in den 1960er Jahren. Sie begründet die Notwendigkeit, die Reden der FDP-Parteitage von 1967 bis 1969 zu analysieren, um diesen Wandel zu verstehen und die Gründe für die Koalition mit der SPD zu beleuchten. Die Arbeit untersucht den Übergang von alten Positionen zu neuen Rahmenbedingungen und definiert die Begriffe „Wende“ und „Sozialliberalismus“ zur präziseren Fragestellung.
2 Hauptteil: Der Hauptteil analysiert die Reden der FDP-Parteitage von 1967 bis 1969. Er untersucht die Entwicklung des Programms, die Veränderungen in der Rhetorik und die Verschiebungen innerhalb der Partei. Jede Analyse umfasst einleitende Informationen zum Parteitag, einen Überblick über die analysierten Reden, und eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Reden unter Berücksichtigung diskurstheoretischer Aspekte nach Foucault. Es werden die Hauptredner vorgestellt und der Einfluss der Reden auf die Parteitagsentscheidungen, die Strategie und die Programmatik der Partei bewertet.
Schlüsselwörter
FDP, Sozialliberalismus, Nationalliberalismus, 1960er Jahre, Große Koalition, Sozialliberale Koalition, Parteitage, Redenanalyse, Diskursanalyse, Ralf Dahrendorf, Walter Scheel, Erich Mende, befähigender Liberalismus, Koalitionsstrategie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der FDP-Parteitage 1967-1969
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der FDP zu einer sozialliberalen Partei in den 1960er Jahren anhand der Reden auf den Bundesparteitagen von 1967 bis 1969. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des ideologischen Wandels und der strategischen Entscheidungen der FDP, die zur Koalition mit der SPD 1969 führten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit sind die Reden auf den FDP-Bundesparteitagen der Jahre 1967, 1968 und 1969. Diese Reden werden diskurstheoretisch nach Foucault analysiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der FDP von einer nationalliberal-bürgerlichen zu einer sozialliberalen Partei. Es werden die Veränderungen in der Programmatik, Rhetorik und den strategischen Entscheidungen der Partei untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird dem „befähigenden Liberalismus“ und der Relativierung abwehrender Freiheitsrechte gewidmet. Der Einfluss wichtiger Persönlichkeiten wie Ralf Dahrendorf und Walter Scheel wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Die Einleitung beschreibt den Kontext und die Forschungsfrage. Der Hauptteil analysiert die Reden der drei Parteitage, jeweils mit einleitenden Informationen, Überblick über die analysierten Reden und einer detaillierten Auseinandersetzung mit den einzelnen Reden. Der Schlussteil bietet eine abschließende Bewertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselpersonen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von wichtigen Persönlichkeiten wie Ralf Dahrendorf, Walter Scheel und Erich Mende auf die politische Entwicklung der FDP.
Welche Konzepte werden verwendet?
Die Analyse verwendet diskurstheoretische Ansätze nach Foucault. Die Begriffe „Wende“ und „Sozialliberalismus“ werden präzise definiert und im Kontext der Untersuchung verwendet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wegmarken des Wandels der FDP zu einer sozialliberalen Partei nachzuzeichnen und die Gründe für die Koalition mit der SPD 1969 aufzuzeigen. Die detaillierte Analyse der Parteitagsreden soll Aufschluss über den ideologischen Wandel und die strategischen Entscheidungen der FDP geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
FDP, Sozialliberalismus, Nationalliberalismus, 1960er Jahre, Große Koalition, Sozialliberale Koalition, Parteitage, Redenanalyse, Diskursanalyse, Ralf Dahrendorf, Walter Scheel, Erich Mende, befähigender Liberalismus, Koalitionsstrategie.
- Quote paper
- Henning Schmidt (Author), 2014, Die sozialliberale Wende der FDP in den 1960er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300814