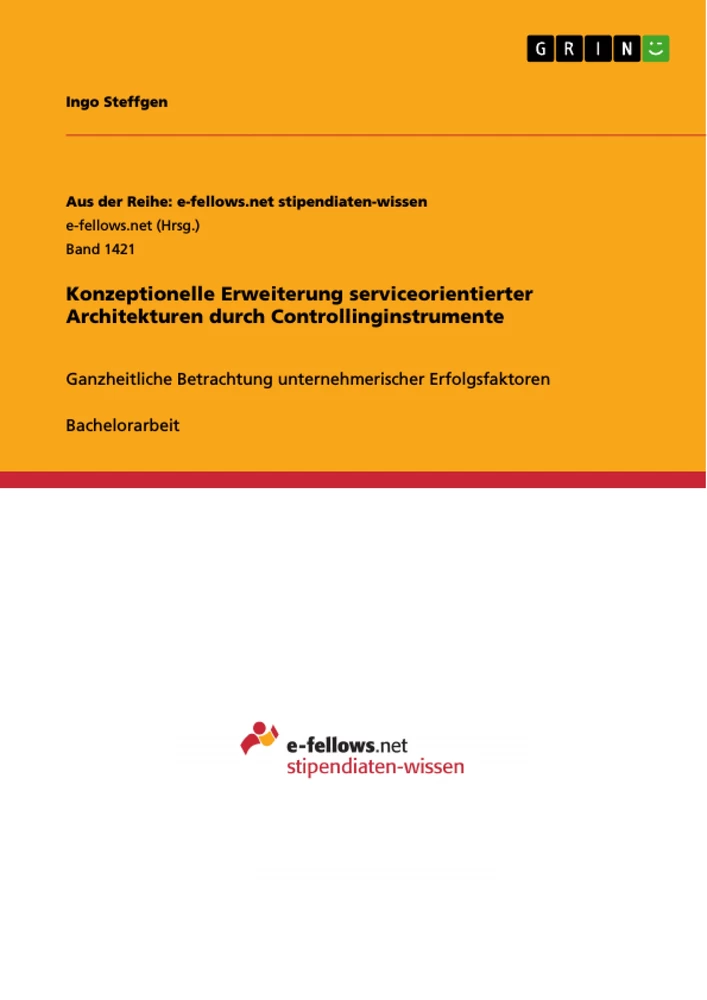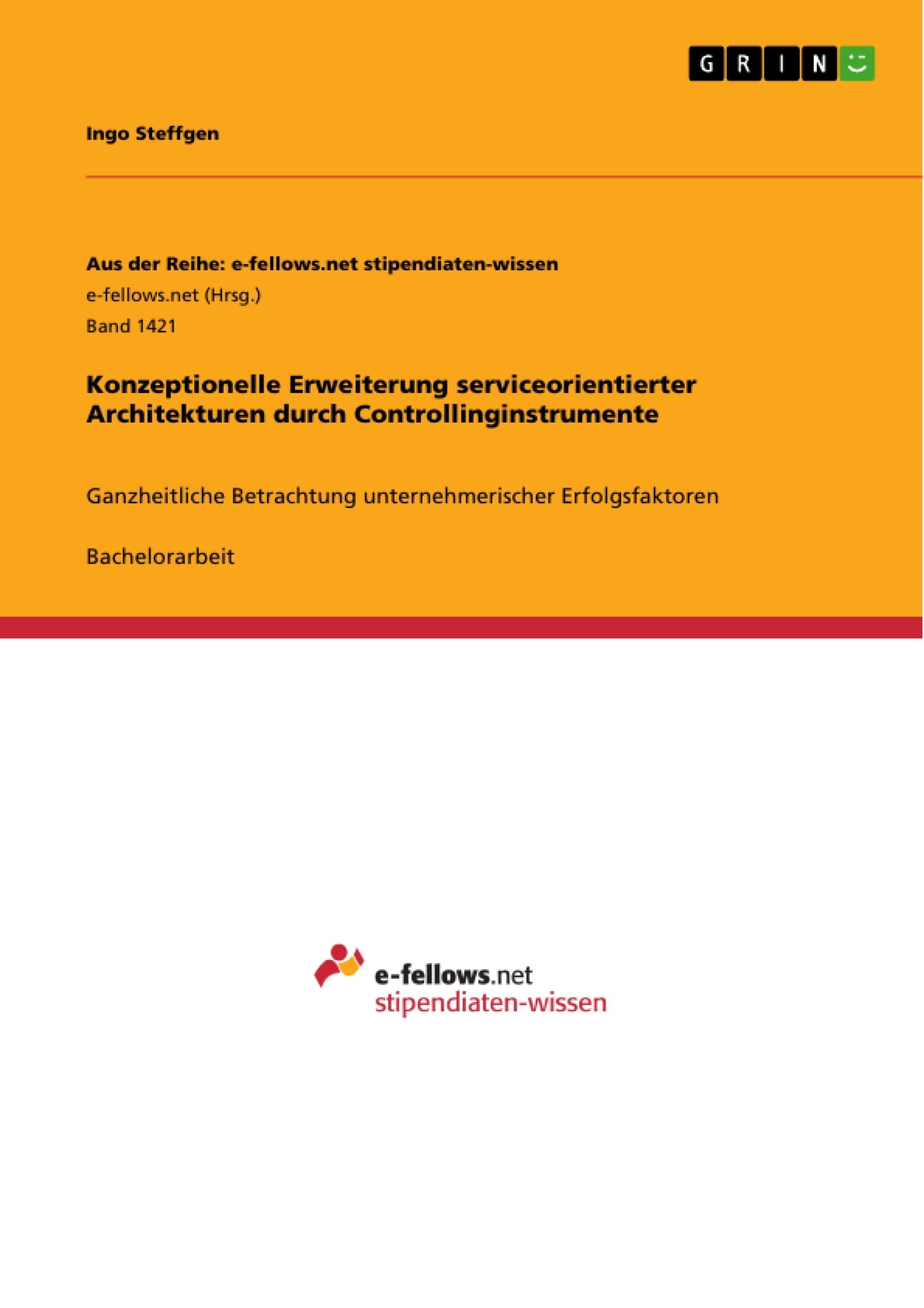Die konzeptionelle Zusammenführung serviceorientierter Architekturen (SOA) mit Instrumenten des Controllings schafft eine ganzheitliche Sicht auf alle unternehmerischen Erfolgsfaktoren der Neuzeit. Zu den bekannten Größen – Kosten, Qualität und Zeit – haben sich in den 90er Jahren die Flexibilität, und seit der Jahrtausendwende, die Information als eigenständige Faktoren herausgebildet. Mit Hilfe des einheitlichen Betrachtungselements – dem Service – wird Transparenz geschaffen und damit Flexibilität gewährleistet. Dies unterstützt wiederum einen ungehinderten Informationsfluss, der Wissen unternehmensweit verfügbar macht.
Das aus der Prozesskostenrechnung abgeleitete vertikale Verrechnungssystem, erlaubt es Kernkompetenzen bezüglich der Leistungsindikatoren Kosten, Qualität und Zeit vergleichbar zu machen, wenn dieses mit einem horizontalen Kennzahlensystem kombiniert wird. Die Prozesskostenrechung bietet den Vorteil, dass versteckte Verluste und Gewinne transparent werden. Eine konzeptionelle Zusammenführung der Modelle erfüllt somit alle oben genannten Anforderungen, welche durch die Globalisierung und den Regionalismus getrieben werden.
Zur Implementierung dieses Modells müssen zunächst entscheidungsrelevante Kennzahlen des Unternehmens erhoben werden. Im Unternehmen selbst ist der Servicegedanke zu implementieren. Ein Service beschreibt dabei eine Funktion, welche über eine standardisierte Schnittstelle jederzeit in Anspruch genommen werden kann und von dieser eindeutig beschrieben wird. Die Realisierung eines Service ist für den Service Nutzer dabei nicht sichtbar, dessen Güte jedoch innerhalb von Service Levels vereinbart und messbar. Die Umwandlung der Unternehmensarchitektur hin zu einer Servicebetrachtung schafft die Voraussetzung einer ebenenübergreifenden Verdichtung der zuvor erhobenen Indikatoren.
Inhaltsverzeichnis
- Executive Summary
- Deutsch
- English
- Einleitung
- Aufbau und Zielsetzung
- Problemstellung und Wertschöpfungspotentiale
- Motivation und Leitgedanke
- Das Konzept der Serviceorientierung
- Begriffsabgrenzung
- Ebenensicht eines Unternehmens
- Service Modell
- Services im Alltag
- Kernaussagen zur Serviceorientierung
- Ansätze der vertikalen Verrechnung
- Auswirkungen der Globalisierung
- Auswirkungen moderner Geschäftsanforderungen
- Horizontale vs. vertikale Verrechnung
- Ansätze zur Schaffung vertikaler Transparenz
- Kernaussagen zur vertikalen Verrechnung
- Horizontales Kennzahlenmodell
- Organisationsebene
- Prozessebene
- Anwendungsebene
- Infrastrukturelle Ebenen
- Konzeptionelle Zusammenführung
- Erweiterungen zur Gesamtsicht
- Vorgehensweise
- Fallbeispiel
- Betrachtungsfokus definieren
- Definition der Betrachtungsobjekte als Service
- Ausgangssituation und Fragestellung
- Beschreibung der Rahmenarchitektur
- Festlegung der mathematischen Zusammenhänge
- Schlussbetrachtung
- Evolutionäre Betrachtung der Serviceorientierung
- Kritische Erfolgsfaktoren
- Empfehlungen und Stellungnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der konzeptionellen Erweiterung serviceorientierter Architekturen durch Controllinginstrumente. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung unternehmerischer Erfolgsfaktoren im Kontext der Serviceorientierung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Integration von Controlling-Instrumenten in serviceorientierte Architekturen zu entwickeln und damit die Effizienz und Effektivität von Unternehmen zu steigern.
- Serviceorientierung als zentrales Konzept für Unternehmenserfolg
- Integration von Controlling-Instrumenten in serviceorientierte Architekturen
- Vertikale Verrechnung als Ansatz zur Steigerung der Transparenz und Effizienz
- Entwicklung eines horizontalen Kennzahlenmodells für die Messung von Erfolgsparametern
- Fallbeispiel zur Anwendung der entwickelten Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der serviceorientierten Architekturen und deren Erweiterung durch Controllinginstrumente ein. Sie definiert die Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit sowie die Motivation und den Leitgedanken. Kapitel 2 beleuchtet das Konzept der Serviceorientierung und erläutert die verschiedenen Ebenen und Dimensionen. Kapitel 3 untersucht die Ansätze der vertikalen Verrechnung, die eine wichtige Rolle bei der Integration von Controlling-Instrumenten spielen. Kapitel 4 stellt ein horizontales Kennzahlenmodell vor, das die Messung von Erfolgsparametern in serviceorientierten Architekturen ermöglicht. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der konzeptionellen Zusammenführung der entwickelten Ansätze und erläutert die Vorgehensweise bei der Integration von Controlling-Instrumenten. Kapitel 6 präsentiert ein Fallbeispiel, das die praktische Anwendung der entwickelten Konzepte veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Serviceorientierung, Controlling, vertikale Verrechnung, horizontales Kennzahlenmodell, Erfolgsfaktoren, Geschäftsanforderungen, Transparenz, Effizienz, Effektivität, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine serviceorientierte Architektur (SOA)?
SOA ist ein Architekturkonzept, das Geschäftsfunktionen als wiederverwendbare Dienste (Services) über standardisierte Schnittstellen bereitstellt.
Wie können Controllinginstrumente SOA unterstützen?
Durch Kennzahlensysteme und Verrechnungsmodelle wird die Leistung der Services in Bezug auf Kosten, Qualität und Zeit transparent und steuerbar.
Was bedeutet vertikale Verrechnung?
Es ist ein System, das Kosten von der IT-Infrastruktur bis hin zu den Geschäftsprozessen zuordnet, um die Wertschöpfung sichtbar zu machen.
Welche Rolle spielt die Prozesskostenrechnung in diesem Modell?
Sie hilft dabei, versteckte Kosten aufzudecken und Leistungsindikatoren ebenenübergreifend vergleichbar zu machen.
Was ist ein horizontales Kennzahlenmodell?
Es misst Erfolgsparameter auf verschiedenen Ebenen wie Organisation, Prozess, Anwendung und Infrastruktur.
- Citation du texte
- Ingo Steffgen (Auteur), 2007, Konzeptionelle Erweiterung serviceorientierter Architekturen durch Controllinginstrumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300890