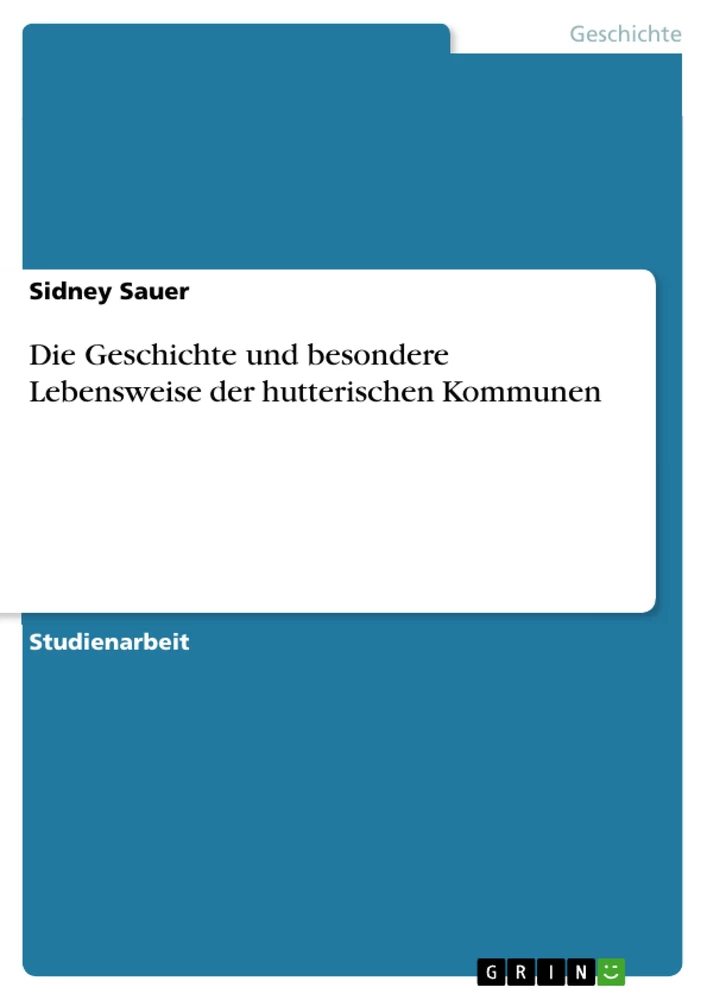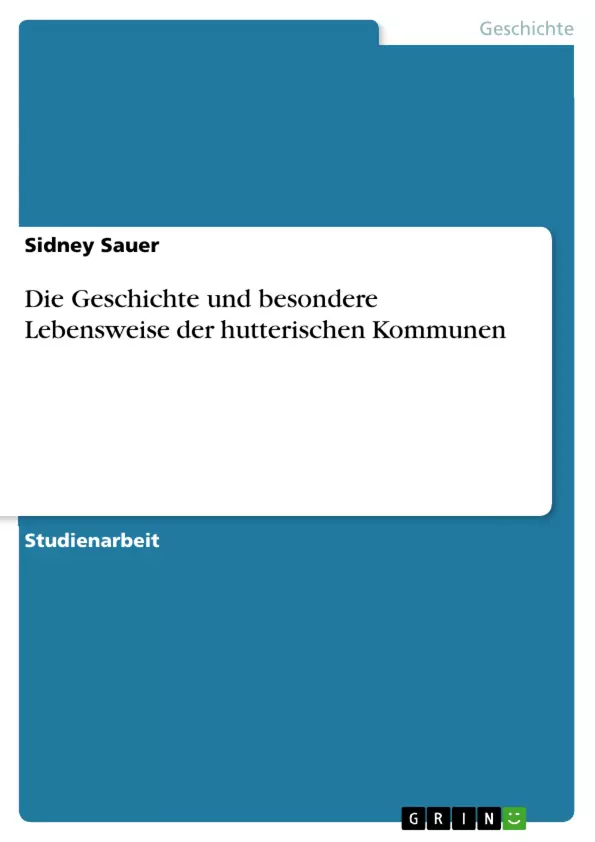Zur Zeit der Reformation entstanden auch die deutlich radikaleren Täuferbewegungen. Für kurze Zeit konnten sie sogar ein eigenes Reich, nämlich das Täuferreich von Münster, ihr Eigen nennen. Eine dieser Täuferbewegungen waren die Hutterer, die vornehmlich aus der Schweiz und Tirol kamen und sich in Mähren niederließen. Für fast hundert Jahre stellten sie dort einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, auf den kein Landesherr gerne verzichten wollte. Obwohl sie ein Teil der Täuferbewegung waren und damit religiösen Ursprungs, verfügten sie über ausgeprägte soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte. So stellte das Leben der Hutterer in der Gütergemeinschaft für viele verarmte Angehörige des dritten Standes, unabhängig ihrer religiösen Überzeugung, eine willkommene soziale Anlaufstelle dar. Auch aus diesem Grund wurden ebendiese weltlichen Aspekte zu den zentralen Inhalten.
Daher wird die folgende Arbeit zeigen, dass die Gemeinschaft der Hutterer in erster Linie eine weltliche und erst in zweiter Linie eine religiöse Bewegung darstellte. Zu diesem Zweck wird zunächst der historische Hintergrund erläutert. Die beiden ersten Kapitel gehen auf die Entstehung der Gemeinde der Hutterer sowie die theologischen und gesellschaftlichen Grundsätze dieser und der Täuferbewegung ein. Nur vor diesem Hintergrund sind die Erläuterungen der darauf folgenden Kapitel nachvollziehbar. In diesen wird jeweils die besondere Lebensweise der Hutterer in den unterschiedlichen Bereichen dargestellt. Um das zu verdeutlichen, ist dieser Arbeit ein Kapitel hinzugefügt, welches einen Überblick über das heutige Leben der Hutterer bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der Hutterergemeinde
- Grundsätze der Täufer und der Hutterer
- Alltags- und Gemeindeleben
- Güter- und Produktionsgemeinschaft
- Erziehungs- und Bildungswesen
- Die Hutterer in Nordamerika
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hutterergemeinde, eine Täuferbewegung aus der Schweiz und Tirol, die sich im 16. Jahrhundert in Mähren niederließ. Sie zeigt, dass die Hutterergemeinschaft in erster Linie eine weltlich-soziale und erst in zweiter Linie eine religiöse Bewegung war.
- Die Entstehung und Entwicklung der Hutterergemeinde
- Die Grundsätze und Lehren der Täufer und der Hutterer
- Das Alltags- und Gemeindeleben der Hutterer
- Die Gütergemeinschaft und das wirtschaftliche Leben der Hutterer
- Die Hutterer in Nordamerika und die heutige Situation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Entstehung der Hutterergemeinde im Kontext der Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts. Es werden die verschiedenen Strömungen innerhalb der Täuferbewegung und die Gründe für die Abwanderung der Hutterer aus Tirol nach Mähren erläutert.
Das zweite Kapitel widmet sich den Grundsätzen der Täufer und der Hutterer, insbesondere der Ablehnung des Klerus, der Gewaltlosigkeit und der Gütergemeinschaft. Es werden die Unterschiede zwischen den Hutterern und anderen Täufergruppen herausgestellt.
Das dritte Kapitel beschreibt das Alltagsleben der Hutterer in ihren Siedlungen. Es werden die Prinzipien der Gütergemeinschaft, die Organisation der Arbeit, die Erziehung und Bildung sowie die sozialen Beziehungen innerhalb der Gemeinde erläutert.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Gütergemeinschaft der Hutterer und die damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten. Es werden die Produktionsweisen, die Organisation der Arbeit und die Rolle der Handwerker und Bauern innerhalb der Gemeinde beschrieben.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Hutterergemeinde in Nordamerika. Es wird die Geschichte der Auswanderung, die Anpassung an die neuen Lebensbedingungen und die heutige Situation der Hutterer in Nordamerika beschrieben.
Schlüsselwörter
Täuferbewegung, Hutterer, Gütergemeinschaft, christliche Urgemeinde, Reformation, Mähren, Nordamerika, weltlich-soziale Bewegung, religiöse Bewegung, Antiklerikalismus, Gewaltlosigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Hutterer und woher stammen sie?
Die Hutterer sind eine radikale Täuferbewegung, die zur Zeit der Reformation in der Schweiz und Tirol entstand und später nach Mähren auswanderte.
Was ist das Besondere an der hutterischen Gütergemeinschaft?
Die Hutterer lehnen Privateigentum ab und leben in einer vollständigen Produktions- und Konsumgemeinschaft, in der alle Güter geteilt werden.
War die hutterische Bewegung eher religiös oder sozial motiviert?
Die Arbeit argumentiert, dass sie in erster Linie eine weltlich-soziale Anlaufstelle für Verarmte war und erst in zweiter Linie eine religiöse Bewegung darstellte.
Welche Grundsätze vertreten die Hutterer?
Zu ihren wichtigsten Grundsätzen gehören die Erwachsenentaufe, strikte Gewaltlosigkeit, die Ablehnung des Klerus und das Leben in der Gütergemeinschaft.
Wo leben die Hutterer heute?
Heute leben die meisten Hutterer-Gemeinden in Nordamerika (USA und Kanada), wo sie ihre traditionelle Lebensweise weitgehend beibehalten haben.
- Citation du texte
- Sidney Sauer (Auteur), 2012, Die Geschichte und besondere Lebensweise der hutterischen Kommunen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300992