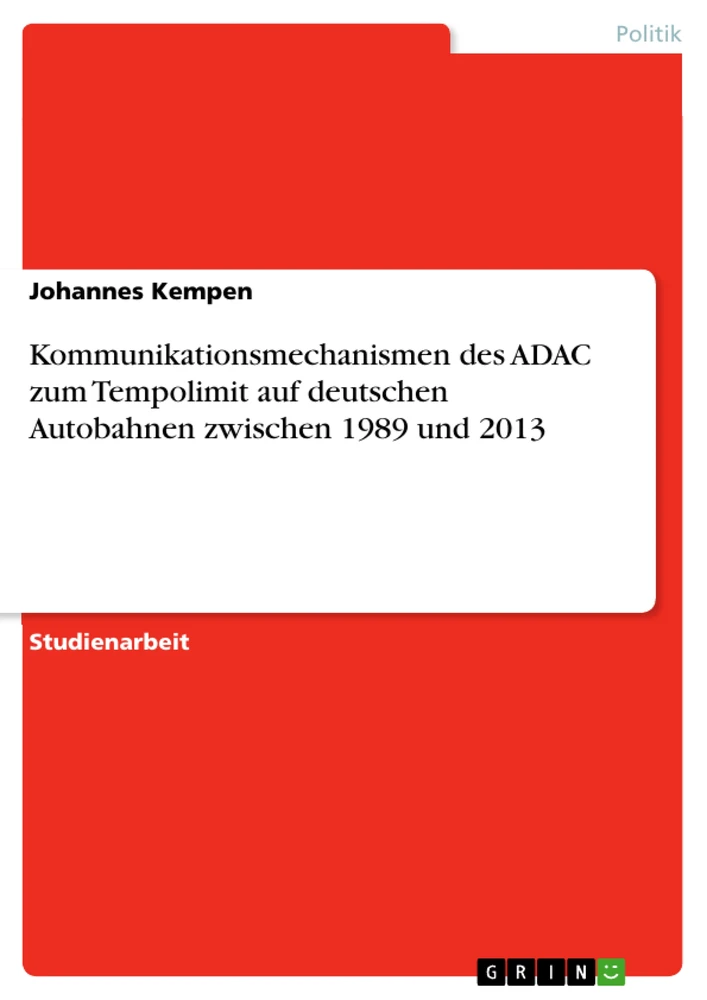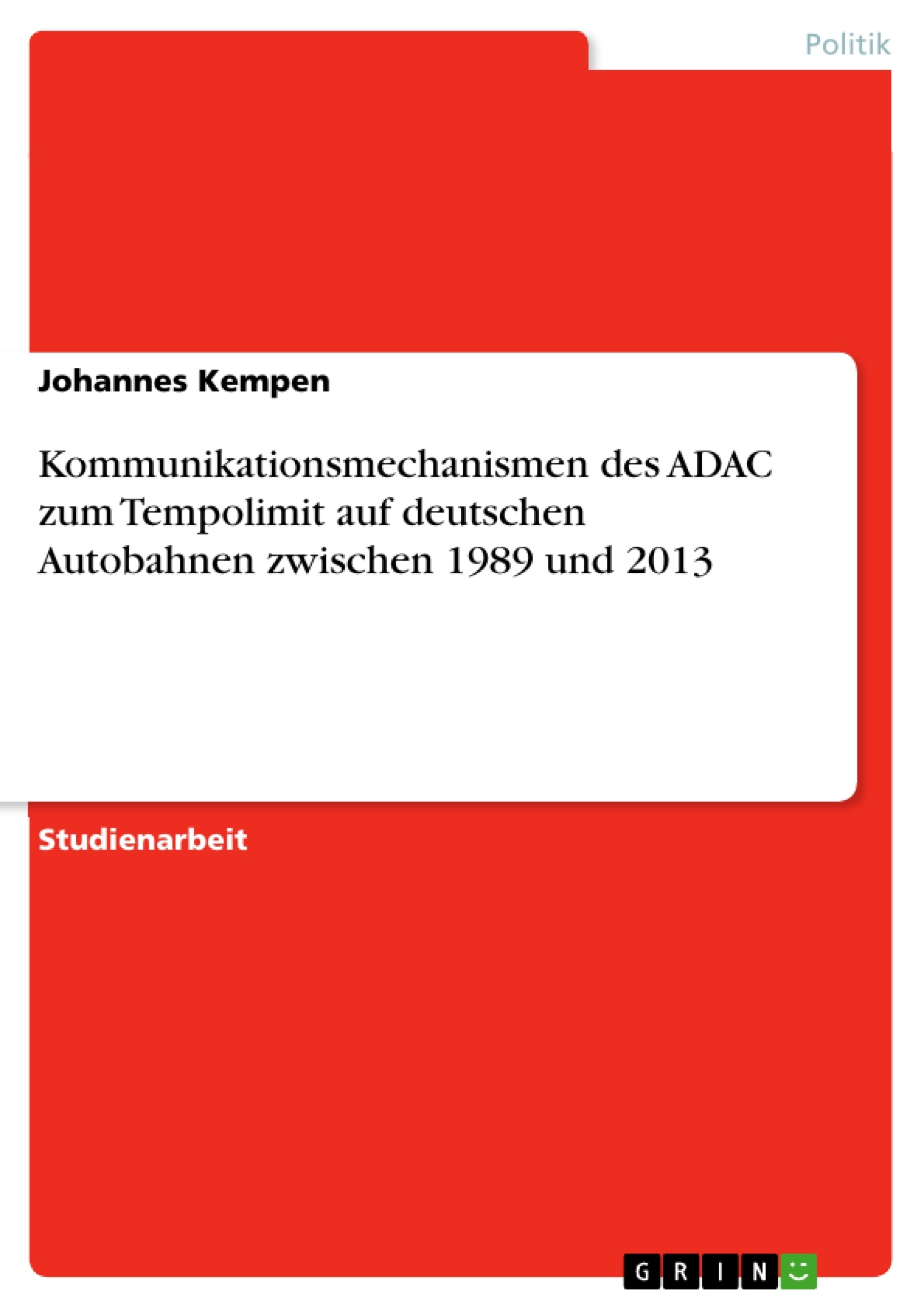Die freie Fahrt gilt als deutsche Besonderheit. Kein vergleichbar entwickeltes Land der Welt verzichtet auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung für seine Autobahnen und alle bisherigen Vorstöße für ein dauerhaftes Tempolimit scheiterten. Entsprechend ist die Diskussion ein ständiges Thema der Verkehrspolitik. Eine Konstante im Widerstand gegen ein Tempolimit ist der ADAC, der sich mit Vehemenz und nicht immer sachlich gegen eine Regulierung wehrt: So erhebt der zum geflügelten Wort gewordene Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ aus den 1970er Jahren das unbeschränkte Autofahren kurzerhand zum Grundrecht. Nach eigener Aussage kämpft der ADAC für die Interessen seiner Mitglieder, suggerierend, dass die deutliche Mehrheit der deutschen Autofahrer ein Tempolimit ablehnt.
Der ADAC ist ohnehin ein Akteur, dem bisher wenig Aufmerksamkeit seitens der Wissenschaft zukam, der sie aber verdient. Dies ist durch drei Aspekte herauszustellen: Der Struktur des Clubs, seiner Funktion und seiner Strategie. Strukturell bemerkenswert ist bereits die Größe: Seit der deutschen Wiedervereinigung konnte der Club seine Mitgliederzahl von etwa neun auf über 18 Millionen verdoppeln. Wenn der Club politische Forderungen äußert, wird diese große Mitgliederbasis stets betont. Von vielen Seiten wird dem ADAC dabei eine Doppelfunktion als Verein und als Verband zugestanden. Als Verein kommt dem ADAC in erster Linie eine Dienstleistungsfunktion gegenüber seinen Mitgliedern zu. Die klassischen Dienstleistungen bestehen dabei aus Pannen- und Unfallhilfe – was auch für einen Beitritt das wesentliche Motiv sein wird. Der ADAC strebt nach Expansion und baut entsprechend seine Anreize für Mitglieder immer weiter aus.
In Abgrenzung zu anderen Vereinen kommt dem ADAC auch eine Funktion als Verband zu. Als solcher – so sei hier knapp definiert – agiert der Club immer dann, wenn er versucht, politischen Einfluss zu nehmen. Diese Dienstleistung des Mitregierens sollte dagegen kein Beitrittsmotiv sein, unterstellt wird vielmehr, dass sie den Eigeninteressen des Clubs dient.
Einflussnahme, so die grundlegende These dieser Arbeit, erfolgt sowohl gegenüber der Politik als auch den eigenen Mitgliedern. Bezogen auf die Diskussion um ein Tempolimit auf Autobahnen führt dies zu folgender Fragestellung: Mittels welcher Mechanismen kommuniziert der ADAC zwischen der Wiedervereinigung und der Bundestagswahl 2013 seine Ablehnung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Auswahl eines theoretischen Zugangs
- 2.2 Untersuchungszeitraum
- 2.3 Operationalisierung
- 3 Analytischer Teil
- 3.1 Politische Ausgangslage
- 3.2 1990-1998: Schwarz-Gelbe Koalition unter Kohl
- 3.3 1998–2005: Rot-Grüne Koalition unter Schröder
- 3.4 2005-2009: Große Koalition unter Merkel
- 3.5 2009-2013: Schwarz-Gelbe Koalition unter Merkel
- 3.6 Bundestagswahl 2013 und Regierungsbildung
- 4 Fazit
- 5 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kommunikationsmechanismen des ADAC im Widerstand gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen zwischen 1989 und 2013. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie der ADAC seine Ablehnung eines Tempolimits gegenüber der Politik und seinen Mitgliedern kommuniziert. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des ADAC als sowohl Verein als auch Verband und analysiert seine Strategien der Einflussnahme.
- Der ADAC als Akteur in der Verkehrspolitik
- Kommunikationsstrategien des ADAC im Hinblick auf ein Tempolimit
- Die Doppelfunktion des ADAC als Verein und Verband
- Der Einfluss der Mitgliederzahl auf die politische Einflussnahme des ADAC
- Die Rolle der Medienberichterstattung in der Debatte um ein Tempolimit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die andauernde Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Sie hebt den ADAC als zentralen Akteur im Widerstand hervor und stellt dessen Argumentationslinien, den Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“, sowie dessen Größe und Einfluss dar. Die Arbeit fokussiert sich auf die Kommunikationsmechanismen des ADAC in diesem Kontext und skizziert den Forschungsansatz, wobei die eingeschränkte Materiallage im Bereich der Verbändeforschung betont wird.
2 Theoretischer Teil: Dieser Teil legt die theoretische Grundlage der Arbeit dar, definiert relevante Begriffe und operationalisiert die Forschungsfrage. Er beschreibt den gewählten theoretischen Ansatz, den Untersuchungszeitraum (1989-2013) und wie die Kommunikationsmechanismen des ADAC in der Analyse untersucht werden. Der Abschnitt bereitet den methodischen Rahmen für die nachfolgende Analyse des politischen Handelns des ADAC vor.
3 Analytischer Teil: Der analytische Teil untersucht die Kommunikationsstrategien des ADAC während verschiedener Regierungsperioden zwischen 1990 und 2013. Er analysiert die politische Ausgangslage und die Rolle des ADAC in den jeweiligen Koalitionen (Schwarz-Gelb unter Kohl, Rot-Grün unter Schröder, Große Koalition und Schwarz-Gelb unter Merkel). Dieser Teil wird eine zeitliche Abfolge der politischen Entwicklung und das darauf reagierende Verhalten des ADAC beleuchten, ohne dabei die konkreten Inhalte der einzelnen Regierungsperioden im Detail wiederzugeben. Der Fokus liegt auf der Kommunikation des ADAC in Bezug auf die Tempolimit-Debatte.
Schlüsselwörter
ADAC, Tempolimit, Autobahn, Verkehrspolitik, Kommunikationsstrategien, Lobbyismus, Verbändeforschung, Politische Einflussnahme, Vereine, Verbände, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kommunikationsmechanismen des ADAC im Widerstand gegen ein Tempolimit
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kommunikationsstrategien des ADAC im Widerstand gegen die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen zwischen 1989 und 2013. Der Fokus liegt auf der Analyse der Methoden, mit denen der ADAC seine Ablehnung eines Tempolimits gegenüber Politik und seinen Mitgliedern kommuniziert hat.
Welche Zeitspanne wird in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Zeitraum von 1989 bis 2013. Dieser Zeitraum umfasst verschiedene Regierungskoalitionen in Deutschland und erlaubt es, die Reaktion des ADAC auf unterschiedliche politische Konstellationen zu untersuchen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Rolle des ADAC als Akteur in der Verkehrspolitik, seine Kommunikationsstrategien bezüglich des Tempolimits, seine Doppelfunktion als Verein und Verband, der Einfluss seiner Mitgliederzahl auf seine politische Macht und die Rolle der Medien in der Tempolimit-Debatte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen analytischen Teil, ein Fazit und ein Quellenverzeichnis. Der theoretische Teil legt den methodischen Rahmen fest, während der analytische Teil die Kommunikationsstrategien des ADAC in verschiedenen Regierungsperioden untersucht.
Welche Regierungsperioden werden im analytischen Teil untersucht?
Der analytische Teil betrachtet die Regierungszeiten der Schwarz-Gelben Koalition unter Kohl (1990-1998), der Rot-Grünen Koalition unter Schröder (1998-2005), der Großen Koalition und der Schwarz-Gelben Koalition unter Merkel (2005-2013). Dabei wird der Fokus auf die Kommunikation des ADAC in Bezug auf die Tempolimit-Debatte gelegt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit enthält ein detailliertes Quellenverzeichnis (siehe Kapitel 5), welches die Grundlage der Analyse bildet. Die Einleitung erwähnt explizit die eingeschränkte Materiallage im Bereich der Verbändeforschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: ADAC, Tempolimit, Autobahn, Verkehrspolitik, Kommunikationsstrategien, Lobbyismus, Verbändeforschung, politische Einflussnahme, Vereine, Verbände, Deutschland.
Welchen theoretischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Der theoretische Teil (Kapitel 2) beschreibt den gewählten theoretischen Ansatz, der die Grundlage für die Analyse der Kommunikationsmechanismen des ADAC bildet. Die genaue Spezifikation des Ansatzes findet sich im Text selbst.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 4) fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kommunikationsstrategien des ADAC im Widerstand gegen ein Tempolimit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt, insbesondere zur Analyse von Themen im Bereich der Verkehrspolitik, des Lobbyismus und der Verbändeforschung.
- Citation du texte
- Johannes Kempen (Auteur), 2015, Kommunikationsmechanismen des ADAC zum Tempolimit auf deutschen Autobahnen zwischen 1989 und 2013, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301015