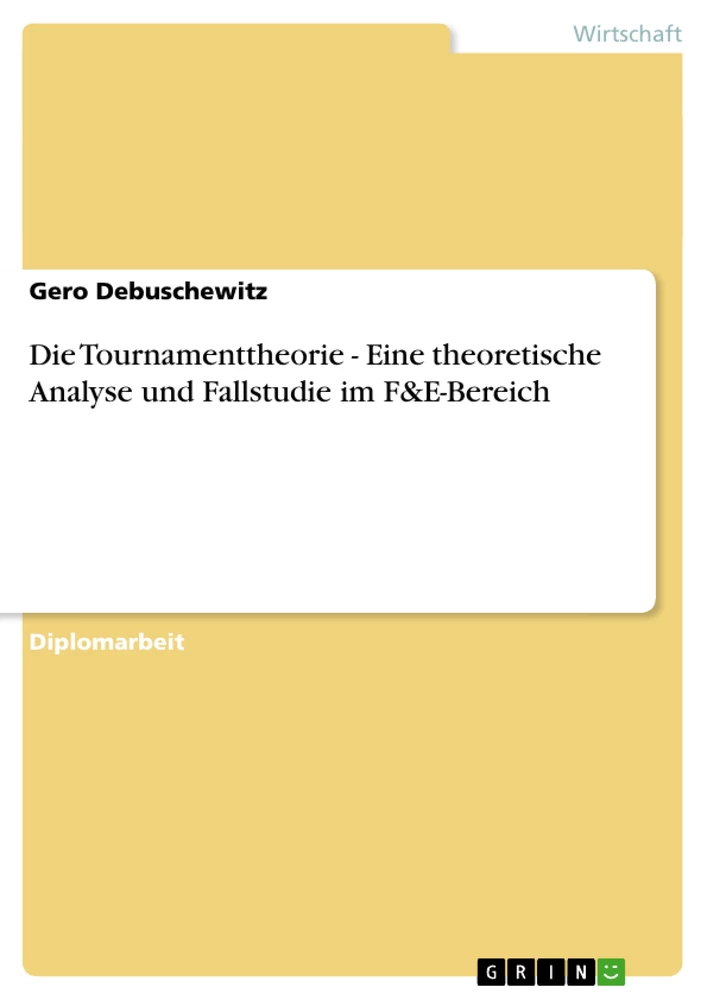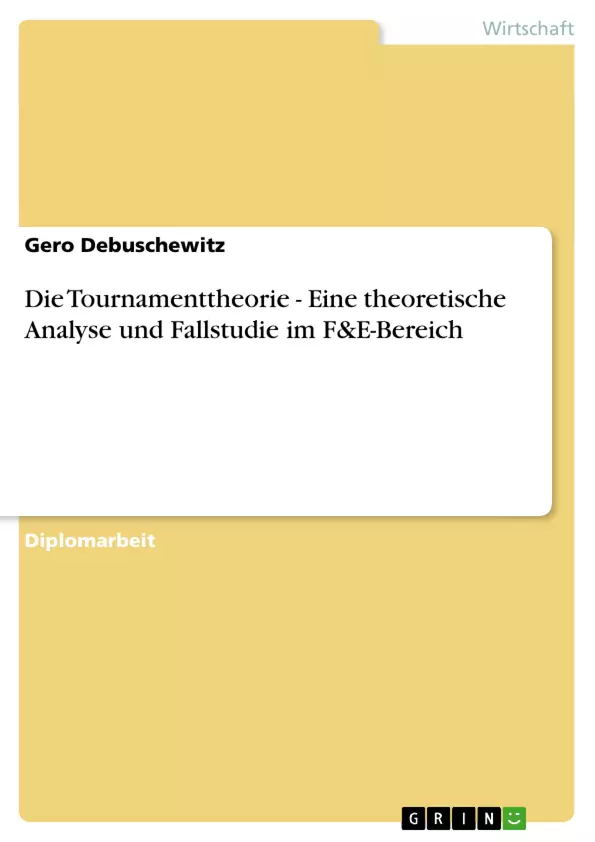Turniere sind Wettbewerbssituationen, in denen Individuen oder Kollektive relativ zur Leistung anderer Turnierteilnehmer belohnt werden. Im ökonomischen Kontext werden solche Leistungsturniere unter dem Begriff der Tournamenttheorie zusammengefasst.
Die Anwendung von Turnieren als Anreizkonzept ist weit verbreitet und besitzt gerade dann Vorteile, wenn eine präzise Leistungsmessung schwierig ist, und Systeme wie individuelle Leistungslöhne aufgrund gemeinschaftlicher, äußerer Risiken nicht einsetzbar sind. Aufgrund u.a. dieser positiven Eigenschaften scheinen Leistungsturniere grundsätzlich ein geeignetes Instrument zu sein, um a) Mitarbeiter hinsichtlich einer höheren Arbeitsleistung zu motivieren bzw. zu kompensieren, und um b) aus einer scheinbar homogenen Arbeitnehmer¬gruppe die geeignetsten Kandidaten für eine Beförderung, Gehaltserhöhung etc. auszuwählen.
Die vorliegende Arbeit untersucht exemplarisch eine derartige Anwendung der Tournamenttheorie im komplexen Organisationsbereich für Forschung und Entwicklung eines Unternehmens.
Auf fortschrittlicher personalökonomischer Basis werden dazu verschiedene Turniervarianten hergeleitet und in Ihrer Anreiz- und Motivationswirkung sowie Ihrem Nutzen ausführlich betrachtet. Neben der Grundform von Turnieren werden ebenfalls eventuelle Problembereiche beleuchtet. Zur modulartigen Erweiterung auf komplexere Situationen der Realität, werden daneben Asymmetrische Turniere eingeführt. Es wird argumentativ dargelegt, formal bewiesen und empirisch untermauert, dass auch solche Turniere ein überzeugendes personalpolitisches Anreizinstrument darstellen. Obendrein werden Maßnahmen aufgezeigt, die solche Turniere in der betrieblichen Praxis ermöglichen bzw. welche so genannte ungleiche und unfaire Turniere ausgleichen können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AUSGANGSSITUATION UND PROBLEMSTELLUNG
- Principal-Agent-Theory und asymmetrische Informationsverteilung
- Situation im Anwendungsfall
- AUSWAHL EINES GEEIGNETEN ANREIZKONZEPTES
- Personalökonomischer Ansatz
- Möglichkeiten externer Anreizstrukturen
- GRUNDLAGEN DER TOURNAMENTTHEORIE
- Einführung in die Tournamenttheorie
- Grundmodell der Tournamenttheorie nach Lazear und Rosen
- Problemfelder der Tournamenttheorie
- Theoretische Annahmen
- Kollusion und Rattenrennen
- Sabotage und anderes unkooperatives Verhalten
- Erweiterung Grundmodell: Asymmetrische Turniere
- EMPIRISCHER FORSCHUNGSSTAND UND TURNIERDESIGN
- Tournamenttheorie allgemein
- Sabotage und Absprachen
- Asymmetrische Turniere
- EINSATZ UND ANWENDUNG VON TURNIEREN
- Darstellung des Problemumfeldes
- Beschreibung des Unternehmens
- Arbeitsweise im Forschungs- und Entwicklungsbereich
- Projektaufträge
- Anwendung der Tournamenttheorie im Organisationsbereich
- Geeignete Einsatzmöglichkeiten von Leistungsturnieren
- Einsatz von Beförderungsturnieren - Selektion
- Selektion durch Vorgesetztenbeurteilung
- Selektion durch Leistungsmessung in der Projektarbeit
- Zusammenfassung Turniere zur Selektion
- Einsatz von Turnieren zur Anreizsteigerung - Motivation
- Leistungsturniere zwischen Individuen
- Leistungsturniere zwischen Kollektiven
- Zusammenfassung Turniere zur Motivation
- RESÜMEE UND SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Anwendung der Tournamenttheorie als Anreizkonzept im Forschungs- und Entwicklungsbereich eines Unternehmens. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der Tournamenttheorie und ihre empirischen Befunde, um die Einsatzmöglichkeiten von Leistungsturnieren in der Praxis zu bewerten.
- Theoretische Analyse der Tournamenttheorie im Kontext von Principal-Agent-Beziehungen und asymmetrischen Informationsverteilungen
- Empirische Evidenz für den Einsatz von Turnieren und die Auswirkungen auf Motivation, Leistung und Sabotage
- Anwendung der Tournamenttheorie in einem konkreten Fallbeispiel aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich
- Bewertung der Vor- und Nachteile von Leistungsturnieren im Hinblick auf Selektion und Motivation von Mitarbeitern
- Identifizierung und Analyse von Problemfeldern wie Sabotage, Kollusion und Rattenrennen im Kontext von Turnieren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Thematik der Tournamenttheorie und ihre Relevanz für den Arbeitsmarkt dargestellt werden. Kapitel 2 beleuchtet die Ausgangssituation und die Problemstellung, die durch die Principal-Agent-Theory und die asymmetrische Informationsverteilung entstehen. Kapitel 3 diskutiert die Auswahl eines geeigneten Anreizkonzepts, wobei der Schwerpunkt auf dem personalökonomischen Ansatz und den Möglichkeiten externer Anreizstrukturen liegt.
Kapitel 4 stellt die Grundlagen der Tournamenttheorie vor, wobei das Grundmodell von Lazear und Rosen erläutert und potenzielle Problemfelder wie theoretische Annahmen, Kollusion, Rattenrennen und Sabotage behandelt werden. Das Modell wird anschließend auf asymmetrische Turniere erweitert und mögliche Ausgleichsmaßnahmen betrachtet.
Kapitel 5 beleuchtet den empirischen Forschungsstand zur Tournamenttheorie, insbesondere zu den Themen Sabotage, Absprachen und asymmetrische Turniere. Kapitel 6 fokussiert auf den Einsatz und die Anwendung von Turnieren im Organisationsbereich, wobei ein konkretes Fallbeispiel aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich eines Unternehmens analysiert wird. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Tournamenttheorie, Anreizstrukturen, Principal-Agent-Theorie, asymmetrische Informationsverteilung, Leistungsturniere, Motivation, Selektion, Sabotage, Kollusion, Rattenrennen, Forschungs- und Entwicklungsbereich, empirische Evidenz und Fallstudie.
- Quote paper
- Gero Debuschewitz (Author), 2004, Die Tournamenttheorie - Eine theoretische Analyse und Fallstudie im F&E-Bereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30113