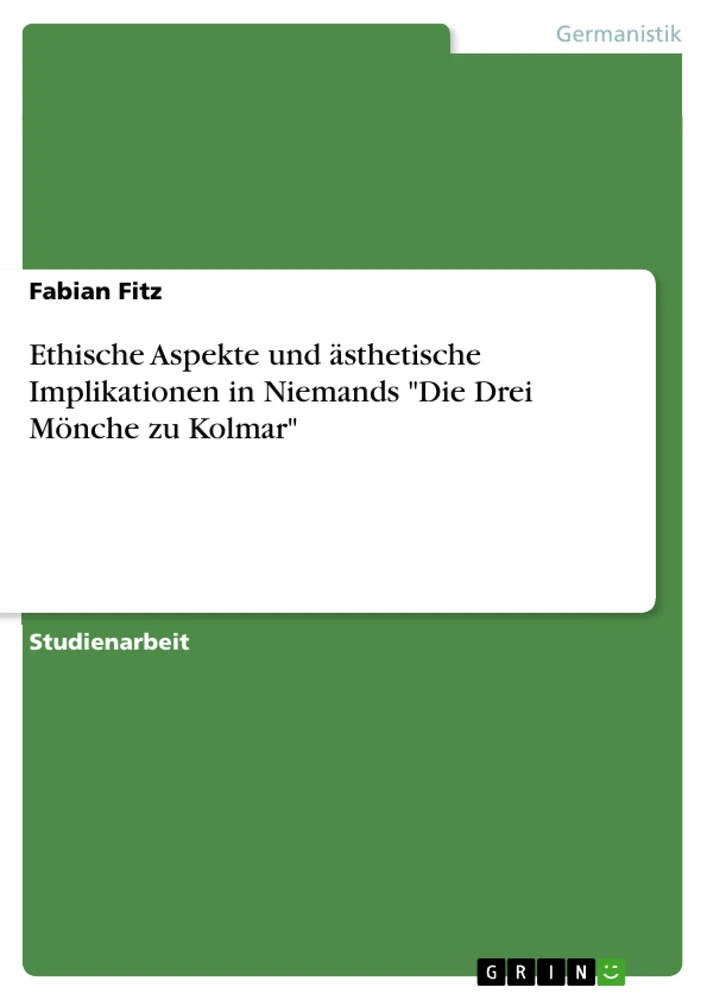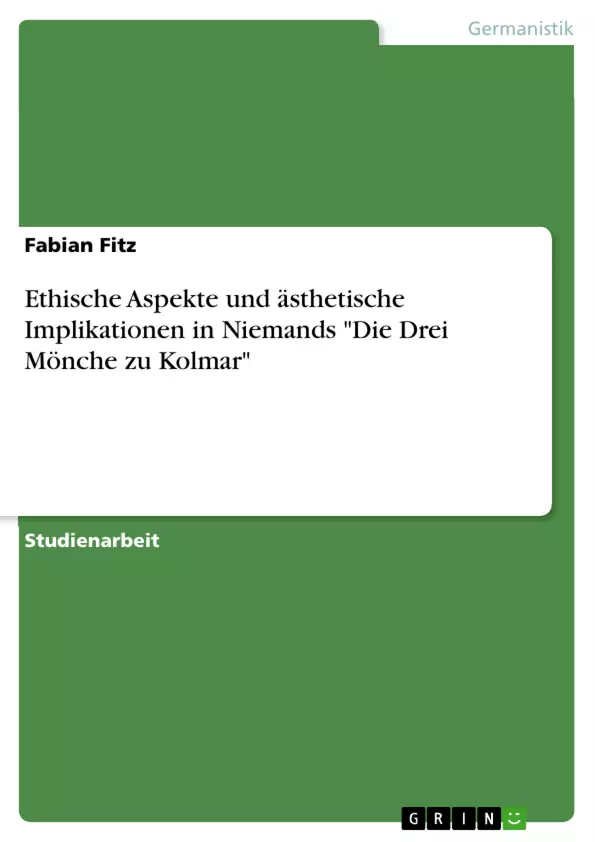Die Beschäftigung mit Fragen der Moral in Bezug auf mittelalterliche Texte stellt mit Sicherheit eine Herausforderung dar. Sowohl die Kontextabhängigkeit beziehungsweise Universalität der Moral selbst spielt dabei eine Rolle, als auch die nicht immer einfache Auslegung mittelalterlicher Texte, welche für eine ergiebige Analyse mit moralischen Kriterien unerlässlich ist.
Eine besondere Herausforderung ist die Analyse von Kurzerzählungen, im Falle dieser Arbeit eines Schwank-Märes, da diesen oftmals ein fehlender moralischer Rahmen nachgesagt wird. Bei einem – aus Sicht der Beschäftigung mit der Interpretation – so offenen, auf unterschiedliche Art und Weise und aus verschiedenen Perspektiven interpretierten Text, wie ihn „Die Drei Mönche zu Kolmar“ darstellt, ist es für das Aufrechterhalten eines Sinnhorizonts von Bedeutung, einen solchen Text in einen Gattungs- und Diskurszusammenhang einzuordnen.
Interessanterweise hat gerade im spezifischen Fall „Die Drei Mönche zu Kolmar“ die Einordnung in einen ebensolchen Zusammenhang zu ganz unterschiedlichen Interpretationen des Textes geführt. Dies scheint jedoch auch darauf zurückzuführen zu sein, dass die Gattungsgrenzen mittelalterlicher Kleinformen von Literatur sehr schwer zu bestimmen sind.
Haug geht in seinem „Entwurf zur Theorie der mittelalterlichen Kurzerzählung“ sogar so weit, von „Erzählungen im gattungsfreien Raum“ zu sprechen, was bedeute, dass „man keinerlei Vorgaben“ habe, „die es dem Dichter und dem Publikum erlauben Sinn zu konstituieren, oder die zumindest auf einen Sinnhorizont verweisen würden.“ Das durch die Gattung vorhandene Sinndefizit werde dann durch Pro- und Epimythien ausgeglichen, welche auf den ersten Blick eine explizite Moral entwürfen und somit dem Text einen Sinn gäben.
Über die Zuordnung des Textes „Die Drei Mönche zu Kolmar“ ist man sich nichtsdestotrotz weitestgehend einig und so wird die Erzählung meist zur Gattung der Schwänke oder der Schwank-Mären, einer spezifizierten Gattung der Mären, gezählt.
Durch die Einordnung des Textes in eine Gattung oder Untergattung, soll ein erster Bezugsrahmen geschaffen werden, innerhalb dessen eine nähere Betrachtung der Erzählung möglich wird.
Zu diesem Bezugsrahmen zählen neben der Gattungseinordnung auch ein kurzer Blick auf die Stoffgeschichte und die Spezifika der deutschen Fassung des Stoffes. Es soll in diesen Kapiteln jeweils schon ein Augenmerk darauf gelegt werden, welche moralisch-ethischen Implikationen sich ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung des Textes als Schwank-Märe
- Sinn und Sinnhorizont
- „Die drei Mönche zu Kolmar“ - Inhalt der Erzählung
- Die Stoffgeschichte der Erzählung „Die drei Mönche zu Kolmar“
- Die Besonderheiten der Mären-Fassung
- Verortung in Kolmar
- Die Mönchsorden
- Finanzielle Beweggründe der List
- Die unmoralischen Handlungen der Figuren und ihre Bewertung
- Das Ehepaar
- Die Mönche
- Der fahrende Student
- Die Einstellung des Erzählers
- Interpretationsansätze der „Drei Mönche zu Kolmar“
- Das Theodiezee Problem
- Eine chaotisch-sinnlose erzählte Welt
- Die Erzählung als Beispiel des Schwarzen Humors
- Beurteilung der Moral und ästhetische Konsequenzen
- Moral und Ästhetik
- Betrachtung aus der Perspektive des Moralismus
- Immoralismus, Komik und Moral
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die mittelalterliche Erzählung „Die drei Mönche zu Kolmar“ mit Fokus auf ihre ethischen und ästhetischen Implikationen. Sie betrachtet die Einordnung des Textes in die Gattung des Schwank-Märes, die Stoffgeschichte, die moralischen Handlungen der Figuren und die verschiedenen Interpretationsansätze. Ziel ist es, die ethischen Konflikte der Erzählung zu beleuchten und die ästhetischen Konsequenzen der dargestellten Moral zu untersuchen.
- Die Einordnung des Textes in die Gattung des Schwank-Märes
- Die moralische Bewertung der Figuren und ihrer Handlungen
- Die Interpretation der Erzählung aus verschiedenen Perspektiven
- Der Einfluss der Moral auf die Ästhetik des Textes
- Die Bedeutung des Schwarzen Humors in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Moral in mittelalterlichen Texten ein und beleuchtet die Herausforderung, derartige Texte unter moralischen Kriterien zu analysieren. Sie betont die Bedeutung der Einordnung des Textes in einen gattungs- und diskursgeschichtlichen Kontext. Kapitel 2 ordnet den Text „Die drei Mönche zu Kolmar“ als Schwank-Märe ein und beschreibt die typischen Merkmale dieser Gattung, wie die Listhandlung und die Darstellung gegensätzlicher Strukturen. Es wird der Sinnhorizont der Schwank-Mären beleuchtet, der durch die Darstellung von Gegensätzlichkeiten und deren Aufhebung entsteht. Kapitel 3 untersucht die Stoffgeschichte der Erzählung und beleuchtet, wie die deutsche Fassung des Stoffes spezifische moralisch-ethische Implikationen aufweist. Kapitel 4 analysiert die Besonderheiten der deutschen Fassung der Erzählung, insbesondere die Verortung in Kolmar, die Darstellung der Mönchsorden und die finanziellen Beweggründe der List. Die Kapitel 5 und 6 setzen sich mit den unmoralischen Handlungen der Figuren und ihrer Bewertung auseinander. Sie untersuchen die moralischen Einstellungen des Ehepaars, der Mönche und des fahrenden Studenten sowie die Haltung des Erzählers. Die Analyse wird durch die Betrachtung verschiedener Interpretationsansätze der „Drei Mönche zu Kolmar“ ergänzt, darunter das Theodiezee Problem, die chaotisch-sinnlose erzählte Welt und die Erzählung als Beispiel des Schwarzen Humors.
Schlüsselwörter
Schwank-Märe, Moral, Ästhetik, mittelalterliche Literatur, Figuren, Handlung, Interpretation, Theodiezee Problem, Schwarzer Humor, Kolmar.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Erzählung "Die Drei Mönche zu Kolmar"?
Es handelt sich um ein mittelalterliches Schwank-Märe, das von einer List handelt, in die ein Ehepaar, drei Mönche und ein fahrender Student verwickelt sind.
Welche moralischen Konflikte werden im Text thematisiert?
Die Arbeit untersucht die unmoralischen Handlungen der Figuren, wie Gier und Betrug, und fragt nach dem fehlenden moralischen Rahmen in dieser Gattung.
Was versteht man unter einem "Schwank-Märe"?
Dies ist eine kurze mittelalterliche Erzählform, die oft durch Komik, Listenreichtum und die Darstellung von Gegensätzen geprägt ist, wobei ein expliziter Sinnhorizont oft fehlt.
Wie wird "Schwarzer Humor" in der Erzählung gedeutet?
Ein Interpretationsansatz sieht in der grausamen Komik des Textes ein Beispiel für Schwarzen Humor, der eine chaotische und sinnlose Welt widerspiegelt.
Welche Rolle spielt die Verortung in Kolmar?
Die Arbeit analysiert die Besonderheiten der deutschen Fassung, wie die spezifische geografische Verortung und die Darstellung der beteiligten Mönchsorden.
- Quote paper
- Fabian Fitz (Author), 2014, Ethische Aspekte und ästhetische Implikationen in Niemands "Die Drei Mönche zu Kolmar", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301151