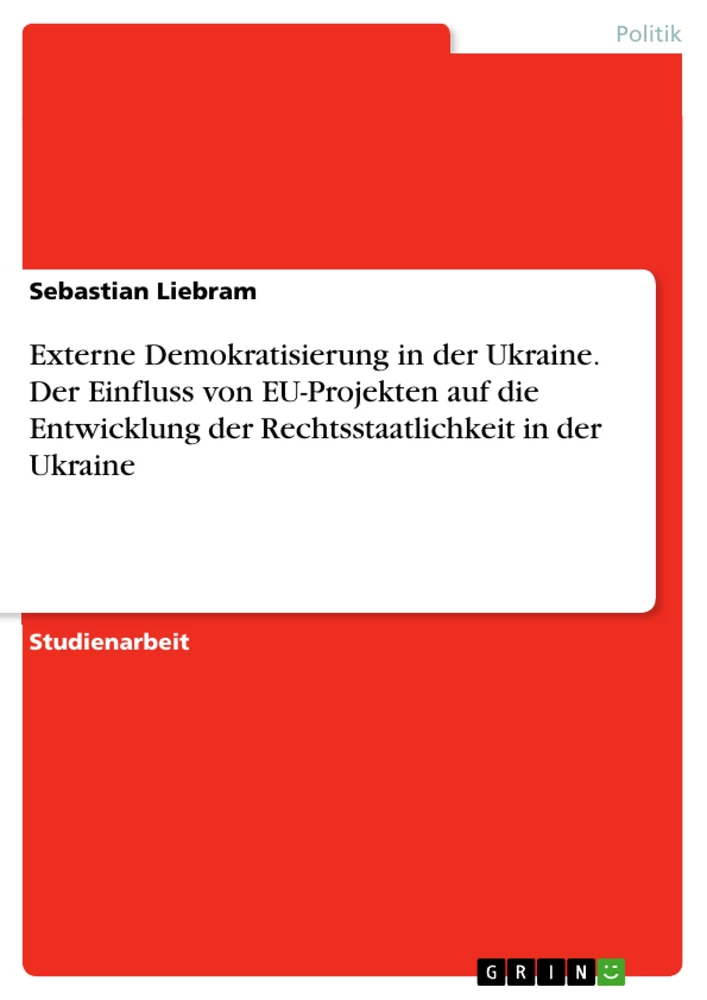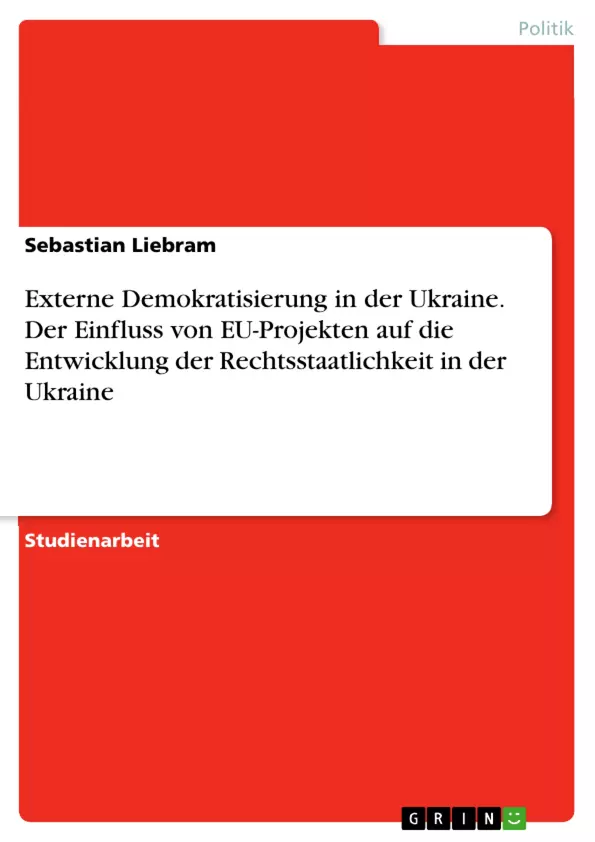„The 2004 Orange Revolution marked Ukraine’s departure from authoritarianism rather than advent of liberal democracy.” (Riabchuk, 2009, S. 273)
Die Orangene Revolution stellt aus Riabchuks optimistischer Perspektive den Beginn des Verfalls der autoritären Herrschaft in der Ukraine dar. Riabchuk relativiert zugleich jedoch die Aussichten auf eine zügige Demokratisierung des postsowjetischen Landes. Diese Beurteilung deckt sich mit der bis heute aktuellen Einschätzung der Situation in der Ukraine, wie sie zum Beispiel in einer Agenturmeldung der Deutschen Presse-Agentur vom 27. April 2015 verbreitet wurde.
Der EU-Ratspräsident Donald Tusk rief demzufolge die „krisengeschüttelte Ukraine zu dringend benötigten Reformen“ (dpa, 2015) auf. Jean-Claude Juncker betonte als Präsident der EU-Kommission, dass die Reformen schmerzhaft sein würden, aber insbesondere im Bereich der Korruptionsbekämpfung vorangetrieben werden müssten (vgl. ebd.). Auch zehn Jahre nach der Orangenen Revolution rangiert die Ukraine auf Platz 142 des Corruption Perception Indexes der nichtstaatlichen Organisation Transparency International – von 175 betrachteten Ländern (vgl. Transparency International, 2015).
Trotz dieser offenbar stagnierenden Demokratisierungsentwicklung der Ukraine, schreibt Gerhard Simon der europäischen und nordamerikanischen Demokratieförderung dagegen eine gewisse positive Wirkung zu (vgl. Simon, 2009, S. 311).
Vor diesem Hintergrund erscheint die Analyse der tatsächlichen Wirkung von durch externen Akteuren initiierten Maßnahmen zur Demokratisierung der Ukraine als wissenschaftlich relevant. Die Europäische Union (EU) ist einer der wesentlichen externen Akteure, die eine Demokratisierung der Ukraine unterstützen. Insbesondere die Förderung der Rechtsstaatlichkeit stellt dabei einen häufig betonten Schwerpunkt der EU-Maßnahmen zur Demokratieförderung in der Ukraine dar.
In theoretische Hinsicht ergibt sich die Relevanz der Arbeit aus der mangelnden Verfügbarkeit von Studien zum Einfluss externer Demokratisierungsfaktoren in Bezug auf die Rechtsstaatsentwicklung in der Ukraine. In praktischer Hinsicht ergibt sich zudem die Möglichkeit einer Wirkungsanalyse der von der EU grundsätzlich umgesetzten Demokratisierungspolitik in EU-Nachbarstaaten, speziell bezogen auf den Erfolg der Maßnahmen in der Ukraine. Dabei ist es von Interesse in welcher Hinsicht erfolgreiche Ansätze in Zusammenhang mit den EU-Maßnahmen zu erkennen sind.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Forschungsdesign
- 4. Begriffe
- 5. EU-Partnerschaft mit der Ukraine
- 5.1 Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der unabhängigen Ukraine
- 5.2 Die Europäische Nachbarschaftspolitik
- 5.3 Das Europäische Nachbarschaftsinstrument als Finanzierungsinstrument der ENP-Maßnahmen
- 5.4 Die Östliche Partnerschaft als Sonderform der ENP
- 6. Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine
- 7. EU-Maßnahmen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine
- 7.1 Die Umsetzung des TAIEX-Programms
- 7.2 EU-Unterstützung bei der Reform des Justizsektors
- 8. Die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in empirischer Betrachtung
- 8.1 Demokratiebarometer als Anhalt von Demokratiequalität
- 8.2 Vertrauen in die ukrainischen Polizeibehörden
- 8.3 Vertrauen in das ukrainische Rechtssystem
- 9. Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine und darauf bezogenen EU-Politik
- 10. Intervenierende Variablen
- 10.1 Die Ukraine als „nahes Ausland“ der Russischen Föderation
- 10.2 Die multivektorale Ausrichtung der ukrainischen Außenpolitik
- 11. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen von EU-Projekten auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine. Sie untersucht, inwieweit die Europäische Union durch ihre Maßnahmen zur Demokratisierung und insbesondere zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine einen Einfluss auf deren Entwicklung hatte. Die Analyse stützt sich dabei auf den aktuellen Forschungsstand zur externen Demokratisierung und die Entwicklung der Demokratisierung in der Ukraine.
- Einfluss von EU-Projekten auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine
- Analyse der EU-Maßnahmen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine
- Bewertung der Wirksamkeit der externen Demokratieförderung in der Ukraine
- Untersuchung der Auswirkungen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) auf die Ukraine
- Betrachtung der Rolle der Ukraine als "nahes Ausland" Russlands und der Folgen für die EU-Politik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel 1) beleuchtet die Relevanz der Analyse der Wirkung von EU-Maßnahmen auf die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine vor dem Hintergrund der stagnierenden Demokratisierung des Landes. Kapitel 2 behandelt den aktuellen Forschungsstand zu externer Demokratisierung und der Entwicklung der ukrainischen Demokratie. Kapitel 3 erläutert das Forschungsdesign, das sich auf den Einfluss von EU-Maßnahmen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit fokussiert. Kapitel 4 definiert wichtige Begriffe, die für das Verständnis der Arbeit relevant sind. Kapitel 5 beschreibt die EU-Partnerschaft mit der Ukraine, einschließlich der Entwicklung der Beziehungen von den 1990er Jahren bis zur Gegenwart. Kapitel 6 behandelt die Entwicklung und Herausforderungen der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine. In Kapitel 7 werden exemplarisch zwei EU-Maßnahmen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit vorgestellt: das TAIEX-Programm und die Unterstützung bei der Reform des Justizsektors. Kapitel 8 untersucht die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine anhand von Daten des Demokratiebarometers und Vergleichsergebnissen des Razumkov-Centres. Kapitel 9 analysiert mögliche Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine und EU-Politiken. Kapitel 10 beleuchtet intervenierende Variablen, die die Umsetzung von EU-Maßnahmen beeinflussen können, wie den Einfluss Russlands und die multivektorale Ausrichtung der ukrainischen Außenpolitik. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung (Kapitel 11) abgeschlossen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themengebieten der externen Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit, EU-Partnerschaft, Ukraine, Europäische Nachbarschaftspolitik, Östliche Partnerschaft, TAIEX-Programm, Justizreform, Demokratiebarometer, Vertrauen in staatliche Institutionen, Russland, und multivektorale Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die EU die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine?
Die EU nutzt verschiedene Instrumente wie das TAIEX-Programm und Unterstützung bei Justizreformen, um die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern.
Welche Rolle spielt die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)?
Die ENP und die Östliche Partnerschaft bilden den Rahmen für die finanzielle und politische Unterstützung von Reformen in der Ukraine.
Warum stagniert die Demokratisierung in der Ukraine trotz EU-Hilfe?
Intervenierende Variablen wie der Einfluss Russlands ("nahes Ausland") und die multivektorale Außenpolitik der Ukraine erschweren den Reformprozess.
Was ist der Corruption Perception Index und warum ist er für die Ukraine relevant?
Er misst die wahrgenommene Korruption. Die Ukraine rangierte auch Jahre nach der Orangenen Revolution auf sehr niedrigen Plätzen (z.B. Platz 142 von 175), was den Reformbedarf unterstreicht.
Wie wird die Rechtsstaatlichkeit empirisch gemessen?
Die Arbeit nutzt Daten des Demokratiebarometers sowie Umfragen zum Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei und das Rechtssystem.
Was war die Bedeutung der Orangenen Revolution für die Ukraine?
Laut Riabchuk markierte sie eher die Abkehr vom Autoritarismus als den sofortigen Beginn einer liberalen Demokratie.
- Quote paper
- Sebastian Liebram (Author), 2015, Externe Demokratisierung in der Ukraine. Der Einfluss von EU-Projekten auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301222