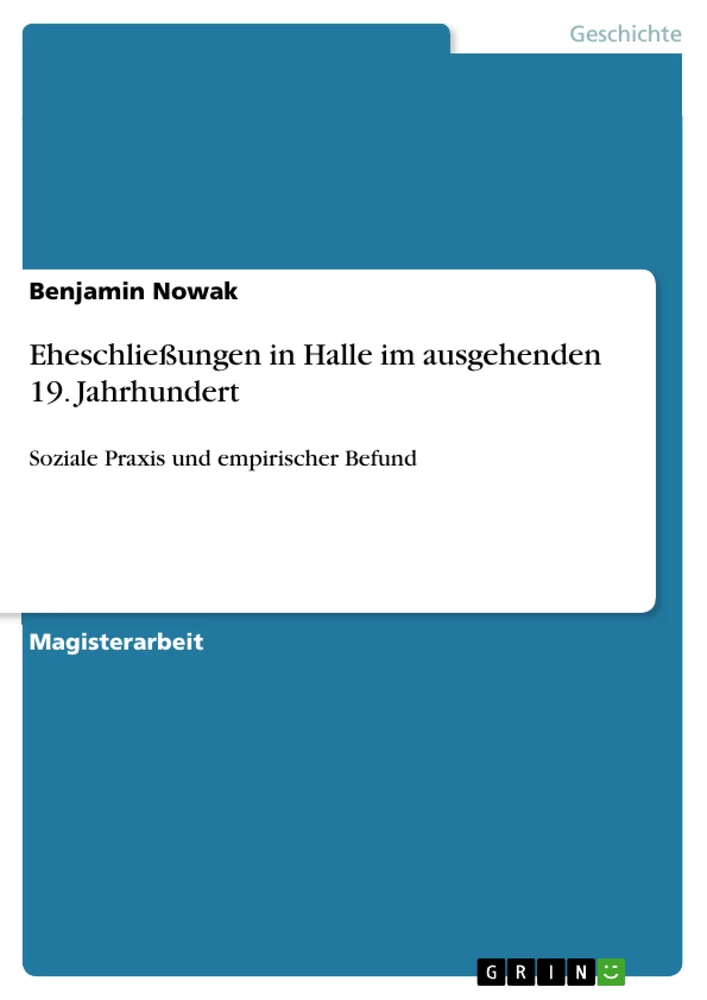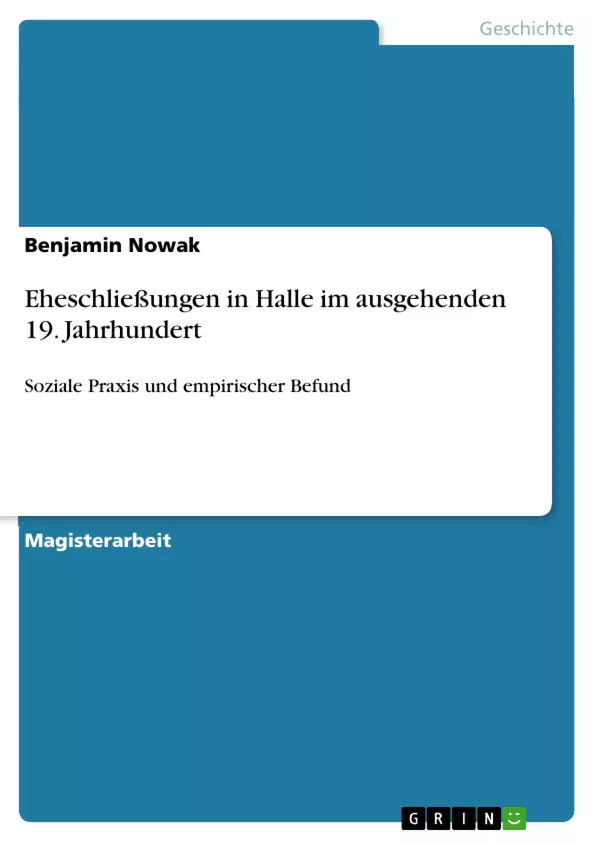Die Arbeit thematisiert das Eheschließungsverhalten der Einwohner der Stadt Halle (Saale), einer schnell industrialisierenden preußischen Großstadt, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Wer heiratet wen, warum und was ergibt sich daraus für die gesellschaftliche Verfassung der Zeit und der folgenden Generation? Zur Beantwortung wurden die Standesamtsregister der Stadt Halle des Jahres 1895 (853 Eheschließende. Angaben zu deren Beruf, Alter, Wohnort, Konfession und Eltern) erfasst, nach wissenschaftlich vergleichbaren Kriterien zahlencodiert und sozialstatistisch ausgewertet (Assoziationsindices, Quotenverhältnisse, abs./rel. Häufigkeiten etc.). Ein umfassende Diskussion und Interpretation der relevanten historischen, soziologischen und demografischen Literatur (über 200 Titel) bereichert die statistische Auswertung. Es entsteht eine sozialgeschichtliche Abhandlung zu den historischen Mechanismen der Paarbindung und deren gesellschaftlichen Folgen. Außerdem bereichert die Arbeit den eher dörflich-kleinstädtischen, hessisch-westfälischen Forschungsfokus um ein mitteldeutsches, urbanes Beispiel.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung.
- 1. 1. Thematik und Fragestellung.
- 1. 2. Die Ehe als Rechtsinstitut und gesellschaftliche Institution im 19. Jahrhundert.
- 1. 2. 1. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR).
- 1. 2. 2. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).
- 1. 2. 3. Folgerungen.
- 1. 2. 4. Zusammenfassung.
- A. Theoretischer Teil
- 2. Ehe als soziale Praxis.
- 2. 1. Zugänge zur Thematik.
- 2. 1. 1. Forschungs- und Literaturüberblick.
- 2. 1. 2. Kurze Bilanz einer Forschungsgeschichte.
- 2. 2. Ehe im Kontext der sozialen Platzierung.
- 2. 2. 1. Soziale Platzierungsleistungen als Grundlage sozialer Mobilität.
- 2. 2. 2. Ehe und soziale Platzierung.
- 2. 2. 2. 1. Struktur und Kultur.
- 2. 2. 2. 2. Interdependenz von Struktur und Kultur.
- 2. 2. 2. 3. Auswirkungen auf die soziale Mobilität einer Gesellschaft.
- B. Empirischer Teil.
- 3. Die Eheschließungen in Halle im Jahr 1895. Grundlagen und Methoden.
- 3. 1. Die Stadt Halle im 19. Jahrhundert.
- 3. 1. 1. Allgemeines.
- 3. 1. 2. Entwicklung des Wirtschafts- und Verwaltungszentrums.
- 3. 1. 3. Bevölkerungsentwicklung und Urbanisierung der Stadt Halle.
- 3. 2. Die Ehebücher der Stadt Halle. Quellenlage und Quellenkritik.
- 3. 3. Methodik.
- 3. 3. 1. Klassifikationen.
- 3. 3. 2. Methodisches Vorgehen.
- 3. 3. 2. 1. Datenaufbereitung.
- 23. 3. 2. 2. Mobilitätsanalyse.
- 3. 3. 2. 3. Exkurse zu den Eheschließungen.
- 4. Mobilitätsanalyse.
- 4. 1. Mobilität zwischen 2 Schichten.
- 4. 1. 1. Intergenerationale berufliche Mobilität der Bräutigame.
- 4. 1. 2. Konnubiale Mobilität der Bräute und Bräutigame.
- 4. 1. 3. Konnubiale Mobilität der Bräutigame nach deren sozialer Herkunft.
- 4. 1. 4. Zwischenbilanz.
- 4. 2. Mobilität zwischen 6 Schichten.
- 4. 2. 1. Intergenerationale berufliche Mobilität der Bräutigame.
- 4. 2. 1. 1. Mobilitätsprozesse in den Unterschichten.
- 4. 2. 1. 2. Mobilitätsprozesse in den Mittelschichten.
- 4. 2. 1. 3. Mobilitätsprozesse zwischen Unter- und Mittelschichten.
- 4. 2. 1. 4. Mobilitätsprozesse zwischen Mittel- und Oberschichten.
- 4. 2. 1. 5. Mobilitätsprozesse zwischen Unter- und Oberschicht.
- 4. 2. 1. 6. Zwischenbilanz zur intergenerationalen Berufsmobilität.
- 4. 2. 2. Konnubiale Mobilität der Bräute und Bräutigame.
- 4. 2. 2. 1. Mobilitätsprozesse in den Unterschichten.
- 4. 2. 2. 2. Mobilitätsprozesse in den Mittelschichten.
- 4. 2. 2. 3. Mobilitätsprozesse zwischen Unter- und Mittelschichten.
- 4. 2. 2. 4. Mobilitätsprozesse zwischen Mittel- und Oberschichten.
- 4. 2. 2. 5. Mobilitätsprozesse zwischen Unter- und Oberschicht.
- 4. 2. 2. 6. Zwischenbilanz zur konnubialen Mobilität zwischen 6 Schichten.
- 4. 2. 3. Berufsplatzierung und konnubiale Platzierungschancen.
- 4. 3. Mobilität zwischen 15 Berufsgruppen.
- 4. 3. 1. Intergenerationale berufliche Mobilität der Bräutigame.
- 4. 3. 2. Konnubiale Mobilität der Bräute und Bräutigame.
- 4. 3. 2. 1. Vorbemerkungen.
- 4. 3. 2. 2. Eheschließungen.
- 4. 3. 2. 3. Zwischenbilanz zur konnubialen Mobilität zwischen 15 BG.
- 4. 4. Alter, Herkunft, Konfession. Exkurse zu den Eheschließungen.
- 4. 4. 1. Das Alter der Eheschließenden.
- 4. 4. 2. Die Herkunft der Eheschließenden.
- 4. 4. 3. Die Konfession der Eheschließenden.
- 4. 4. 4. Bilanz.
- 35. Fazit.
- Die Entwicklung der Ehe als Rechtsinstitut und gesellschaftliche Institution im 19. Jahrhundert
- Ehe im Kontext der sozialen Platzierung und Mobilität
- Eheschließungen in Halle im Jahr 1895 als empirisches Beispiel
- Analyse der Mobilitätsmuster von Bräuten und Bräutigamen
- Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft, Beruf und Ehe
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Thematik und Fragestellung der Arbeit vor. Sie skizziert den historischen Kontext und erläutert die Relevanz des Themas.
- Kapitel 2: Der theoretische Teil analysiert die Ehe als soziale Praxis und betrachtet deren Bedeutung im Kontext der sozialen Platzierung. Es werden verschiedene Zugänge zur Thematik und Forschungsliteratur beleuchtet.
- Kapitel 3: Der empirische Teil widmet sich den Eheschließungen in Halle im Jahr 1895. Es werden die Quellenbasis und die Methodik der Analyse erläutert.
- Kapitel 4: Die Mobilitätsanalyse untersucht die intergenerationale berufliche Mobilität der Bräutigame sowie die konnubiale Mobilität der Bräute und Bräutigame.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Eheschließungen in Halle am Ende des 19. Jahrhunderts und untersucht die Verbindung von sozialer Praxis und empirischen Befunden. Sie befasst sich mit der Ehe als Rechtsinstitut und gesellschaftlicher Institution und analysiert deren Rolle im Kontext der sozialen Platzierung und Mobilität.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Schlüsselwörter (Keywords)
Ehe, Sozialgeschichte, 19. Jahrhundert, Halle, Soziale Praxis, Empirische Forschung, Mobilität, Berufsmobilität, Konnubiale Mobilität, Soziale Platzierung, Schichten, Berufsgruppen.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie zu Eheschließungen in Halle?
Die Arbeit analysiert das Eheschließungsverhalten und die soziale Mobilität der Einwohner von Halle (Saale) im Jahr 1895 anhand von Standesamtsregistern.
Welche Quellen wurden für die Untersuchung genutzt?
Als Primärquellen dienten die Standesamtsregister von 1895 mit Daten zu Beruf, Alter, Wohnort und Konfession von 853 Eheschließenden.
Was bedeutet konnubiale Mobilität?
Konnubiale Mobilität bezeichnet die soziale Bewegung, die durch die Heirat zwischen Personen unterschiedlicher sozialer Schichten entsteht.
Welche Rolle spielte das BGB für die Ehe im 19. Jahrhundert?
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) löste am Ende des Jahrhunderts ältere Rechtsnormen wie das ALR ab und definierte die Ehe als rechtliches und gesellschaftliches Institut neu.
Wie beeinflusste die Industrialisierung das Heiratsverhalten?
Die schnelle Industrialisierung in Städten wie Halle führte zu neuen sozialen Schichten und veränderte die Mechanismen der Partnerwahl und sozialen Platzierung.
- Citar trabajo
- Benjamin Nowak (Autor), 2013, Eheschließungen in Halle im ausgehenden 19. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301300