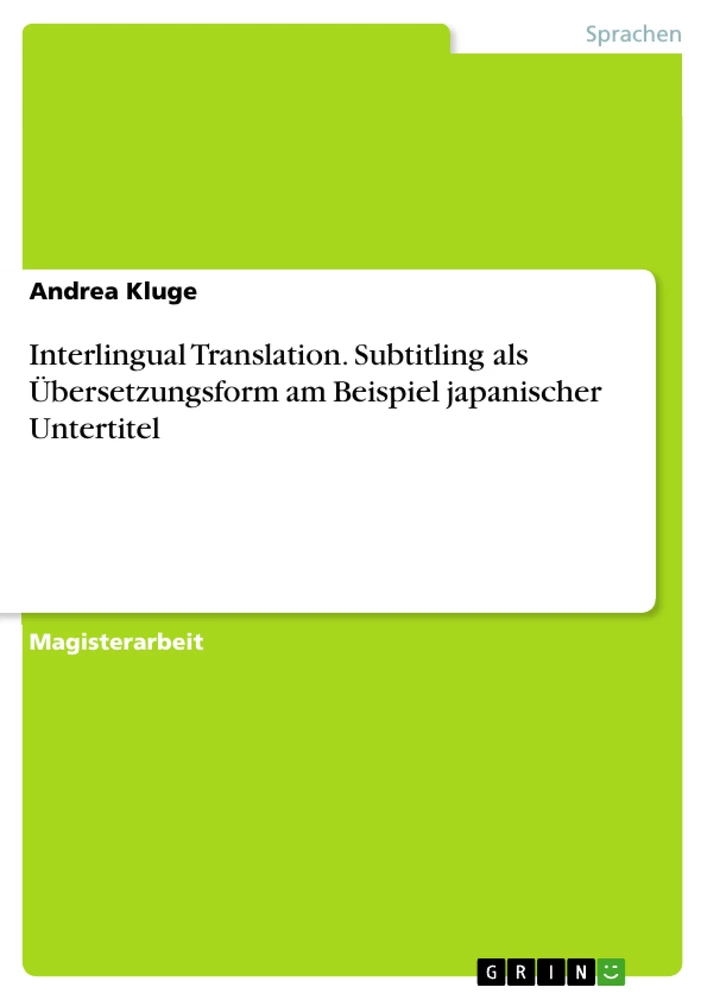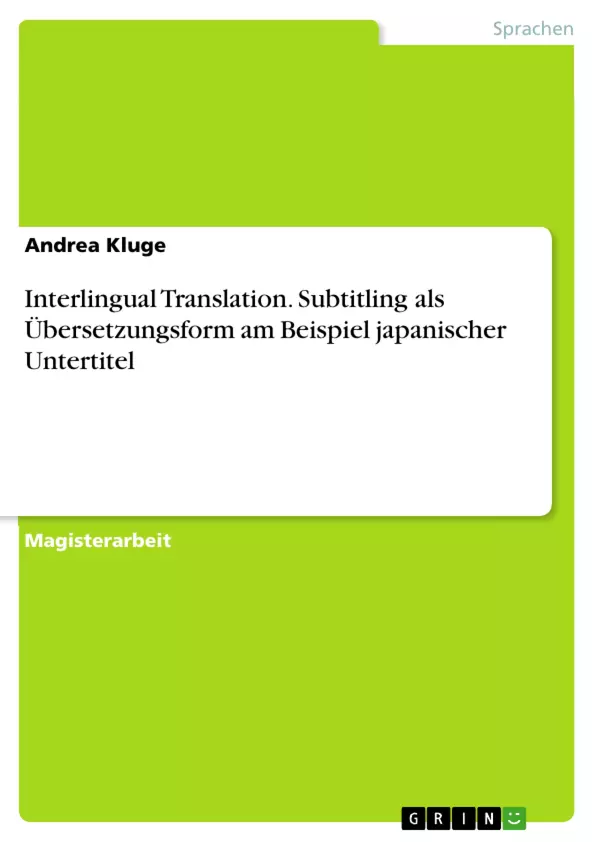Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gegenstand des Subtitlings als Form der interlingualen Übersetzung. Dabei soll unter anderem den Fragen nachgegangen werden, welche Besonderheiten und Restriktionen dabei eine bedeutende Rolle spielen und inwiefern eine solch interlinguale – im Gegensatz zur intralingualen – Untertitelung überhaupt als Form der Übersetzung zu verstehen ist. Anhand der westlichen Methoden und Standards werde ich zunächst eine Einführung in die Gattung und Entstehung von Untertiteln geben, um im weiteren Verlauf meiner Arbeit das Hauptaugenmerk auf den Bereich japanischer Untertitel in ausländischen Filmen zu legen. Dabei sollen ebenso Unterschiede zu den westlichen Konventionen sowie bedeutende Charakteristika der japanischen Sprache und Schrift einer näheren Betrachtung unterzogen werden, um die Inhalte meiner anschließenden Hauptuntersuchung verständlicher darstellen zu können. Am Beispiel eines amerikanischen Films werde ich die wesentlichen Merkmale und Auffälligkeiten einer interlingualen Untertitelübersetzung am Beispiel japanischer Untertitel sowohl auf technische als auch linguistische Weise verdeutlichen und anhand der eingangs genannten gattungsspezifischen Restriktionen und Konventionen zu begründen versuchen. Dabei soll sowohl eine Übersetzung des englischen Originaldialogs wie auch eine Übersetzung und Transkription der japanischen Untertitel nicht fehlen. Auf Grundlage dieser Darstellung erfolgt im Anschluss eine direkte Beurteilung der Untertitelung, um noch einmal die wesentlichsten Übersetzungsauffälligkeiten innerhalb der interlingualen Untertitelung aufgrund standardisierter Vorgehensweise und sprachlicher Mentalitätsunterschiede zu veranschaulichen. Auf dieser Grundlage möchte ich abschließend eine Antwort auf die anfangs erwähnte Frage geben, ob der sprachliche Transfer zwischen mündlichem Original und schriftlichen Untertiteln tatsächlich als gewöhnliche Übersetzung, oder vielmehr als umschreibende Zusammenfassung zu werten ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1.0 Die Gattung Untertitel und das Subtitling
- 1.1 Entwicklungsgeschichte und Herstellungsprozess
- 1.2 Vorgang und Ablauf des Untertitelns: das Subtitling
- 1.2.1 Räumliche und zeitliche Restriktionen
- 1.2.2 Standards des ‚Code of Good Subtitling Practice’
- 2.0 Umriss der japanischen Sprache und Schrift
- 2.1 Kurze Einführung in Schrift und Schriftsystem
- 2.2 Besondere Eigenschaften des Japanischen
- 2.2.1 Verschiedene Höflichkeitsstufen
- 2.2.2 Frauensprache vs. Männersprache
- 2.2.3 Personalpronomen und Anredeformen
- 3.0 Zum Subtitling ausländischer Filme in Japan
- 3.1 Entstehungsgeschichte des japanischen Subtitlings
- 3.2 Unterschiede in Standards und Restriktion
- 4.0 Interlinguales Subtitling als Form des Übersetzens
- 4.1 Bedeutung und Beschreibung des Übersetzens
- 4.2 Schwierigkeiten und Nachteile des Subtitlings
- 4.3 Subtitling als Brücke des kulturellen Transfers
- 5.0 Untersuchung: japanische Untertitel im Film „I, Robot“
- 5.1 Auffälligkeiten im Transfer unter Berücksichtigung der Standards
- 5.1.1 Höflichkeit, Genderlekt und Personalpronomina
- 5.2 Nähere Betrachtung weiterer sprachmentaler Transferunterschiede
- 5.2.1 Beleidigungen, Drohungen und Flüche
- 5.2.2 Slang und Umgangssprache
- 5.2.3 Ironie, Sarkasmus und Wortwitz
- 5.3 Gesamtbeurteilung anhand der wesentlichen Gesichtspunkte
- 5.1 Auffälligkeiten im Transfer unter Berücksichtigung der Standards
- 6.0 Fazit: Subtitling – Übersetzung oder Zusammenfassung?
- 7.0 Literatur‐ und Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Magisterarbeit untersucht das interlinguale Subtitling als Übersetzungsform, insbesondere im Kontext der japanischen Sprache und Kultur. Die Arbeit beleuchtet die besonderen Herausforderungen und Restriktionen, die beim Übersetzen von englischen Filmen ins Japanische entstehen, und analysiert, inwiefern sich diese Übersetzungsform von traditionellen Übersetzungen unterscheidet.
- Die Geschichte und Entwicklung des Subtitlings im Allgemeinen und in Japan
- Die technischen und linguistischen Restriktionen, die bei der Erstellung von Untertiteln zu beachten sind
- Die Besonderheiten der japanischen Sprache, wie Höflichkeit, Genderlekt und Personalpronomen
- Der kulturelle Transfer und die Unterschiede zwischen der englischen und japanischen Sprachmentalität
- Eine empirische Untersuchung japanischer Untertitel im Film „I, Robot“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1 gibt eine Einführung in die Gattung Untertitel und die Entwicklung des Subtitlings. Es werden wichtige Standards und Restriktionen des Subtitlings erläutert, sowie ein Überblick über die Geschichte und die Entwicklung des Subtitlings in Japan gegeben.
- Kapitel 2 liefert eine Einführung in die japanische Sprache und Schrift. Es werden wichtige Besonderheiten der japanischen Sprache wie Höflichkeit, Genderlekt und Personalpronomen erläutert.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Subtitling ausländischer Filme in Japan. Es werden die Entstehungsgeschichte und die Unterschiede in den Standards und Restriktionen des japanischen Subtitlings im Vergleich zu westlichen Untertiteln beleuchtet.
- Kapitel 4 behandelt das interlinguale Subtitling als Form des Übersetzens. Es werden die Bedeutung und die Beschreibung des Übersetzens diskutiert, sowie die Schwierigkeiten und Nachteile des Subtitlings aufgezeigt. Außerdem wird der kulturelle Transfer und das Subtitling als Brücke zwischen verschiedenen Kulturen beleuchtet.
- Kapitel 5 analysiert die japanischen Untertitel im Film „I, Robot“. Die Untersuchung beleuchtet die technischen und linguistischen Restriktionen, die bei der Übersetzung der englischen Originaldialoge in die japanischen Untertitel zu beachten waren. Außerdem werden sprachmentale Unterschiede und Auffälligkeiten im Transfer zwischen beiden Sprachen erörtert.
- Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beantwortet die Frage, ob interlinguales Subtitling eher als Übersetzung oder Zusammenfassung zu betrachten ist.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen interlinguale Übersetzung, Subtitling, japanische Sprache, kultureller Transfer, sprachliche Besonderheiten, Zeichenbegrenzung, Übersetzungskriterien, "I, Robot", Film, Sprachmentalität.
Häufig gestellte Fragen
Ist Untertitelung eine vollwertige Übersetzung oder eine Zusammenfassung?
Aufgrund technischer Restriktionen (Zeit und Raum) stellt Subtitling oft einen Transfer dar, der zwischen einer präzisen Übersetzung und einer umschreibenden Zusammenfassung oszilliert.
Welche Besonderheiten gibt es bei japanischen Untertiteln?
Japanische Untertitel müssen spezifische Höflichkeitsstufen (Keigo), Unterschiede zwischen Frauen- und Männersprache sowie komplexe Schriftsysteme berücksichtigen, die im Original oft nicht explizit sind.
Was sind die technischen Beschränkungen beim Subtitling?
Dazu gehören die Zeichenbegrenzung pro Zeile (räumlich) und die Standzeit der Untertitel auf dem Bildschirm (zeitlich), damit der Zuschauer den Text bequem lesen kann.
Wie werden Beleidigungen und Slang ins Japanische untertitelt?
Der Transfer von Flüchen, Slang und Ironie erfordert oft eine kulturelle Anpassung, da die japanische Sprachmentalität andere Konventionen für Direktheit und Höflichkeit besitzt.
Was ist der „Code of Good Subtitling Practice“?
Es handelt sich um einen Standard für professionelle Untertitelung, der Richtlinien für Lesbarkeit, Synchronität und inhaltliche Treue festlegt.
- Citar trabajo
- Andrea Kluge (Autor), 2009, Interlingual Translation. Subtitling als Übersetzungsform am Beispiel japanischer Untertitel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301315