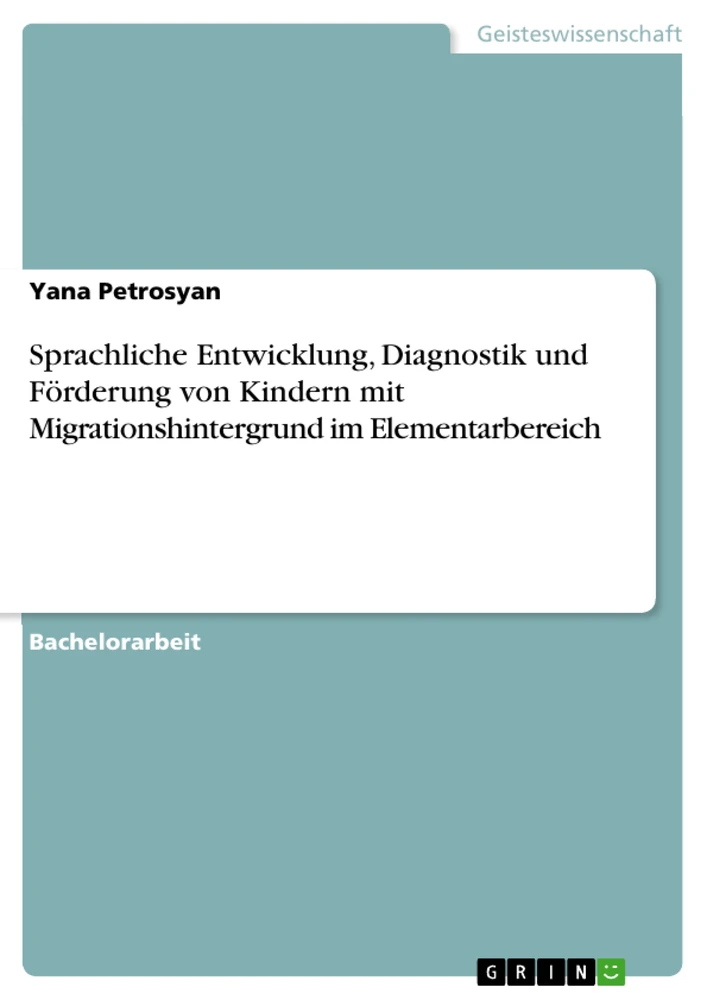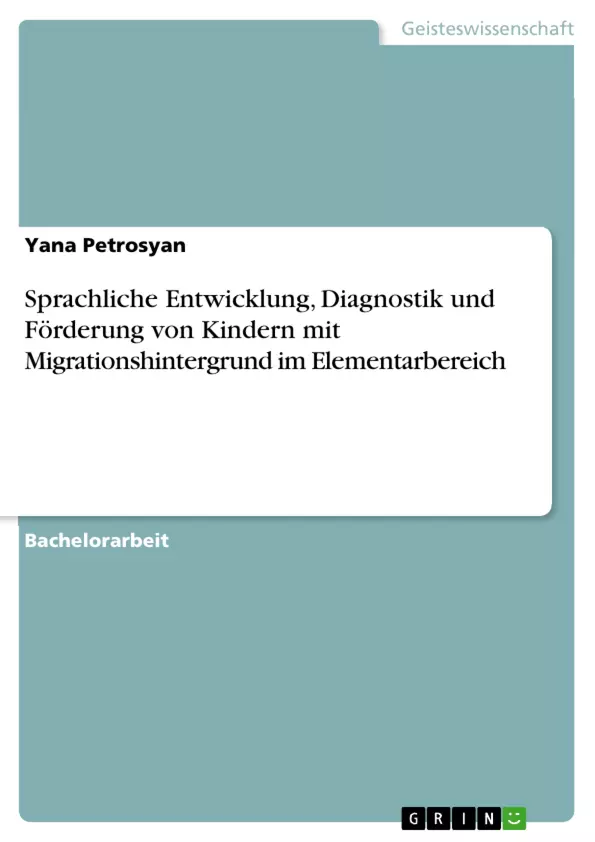Die gesprochene Sprache ist sicherlich das wichtigste Kommunikationsmittel eines jeden Menschen und entscheidet maßgebend über seine Positionierung und Interaktion innerhalb einer sozialen Gruppe gleich welcher Art. Umso schwieriger gestaltet sich diese Aufgabe, wenn dieses Kommunikationsmittel nicht oder zumindest nicht vollumfänglich eingesetzt werden kann. Eine der häufigsten Ursachen dafür ist die Notwendigkeit in einer Fremdsprache zu kommunizieren, zum Beispiel in Folge einer Umsiedlung oder Auswanderung. Bei all den alltäglichen Herausforderungen in einem neuen Land wiegt die fehlende oder nur begrenzte Beherrschung der Sprache besonders schwer.
Diesen Schwierigkeiten sind verständlicherweise auch die Kinder vollumfänglich ausgesetzt, wobei die Problematiken bei ihnen anders gelagert sind. Dies liegt vor allem daran, dass die sprachliche Entwicklung im Kindesalter noch nicht vollständig abgeschlossen ist und Kinder beim Erlernen einer Sprache im Vergleich zu den Erwachsenen ein anderes Lernverhalten haben (Heuer , 2005).
In Deutschland lebten im Jahr 2010 rund 15,7 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, davon rund 4,3 Mio. in der Alterskategorie bis 19 Jahre (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012). Natürlich sind viele darunter, die von der Problematik nicht betroffen sind, weil sie zum Beispiel in einer deutschsprachigen Umgebung aufgewachsen sind und keine Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung aufweisen. Dennoch betrifft das Themengebiet eine sehr breite Bevölkerungsschicht und hat eine entsprechende gesellschaftliche Relevanz.
Studien in Deutschland (Dubowy et al., 2008) haben in den letzten Jahren zutage gebracht, dass die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten bei Kindern mit Migrationshintergrund deutlich häufiger suboptimal verläuft bzw. von zahlreichen Problemen begleitet wird. Im Rahmen dieser Arbeit soll diese Problematik aufgegriffen und aufbereitet werden. Zunächst soll die normale sprachliche Entwicklung im Kindesalter, insbesondere die einzelnen Phasen und relevanten Entwicklungsfaktoren, kurz skizziert werden.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der zweite Teil in dem zunächst auf die Besonderheiten und der Sprachentwicklung der Kinder mit Migrationshintergrund eingegangen wird. Ziel ist es, auf Basis der Datenlage, die grundsätzlichen Differenzen und Problemfelder im Vergleich zu der Gesamtgruppe (also aller Kinder in Deutschland) zu identifizieren und zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der Sprache im Kindesalter.
- Phasen der Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter
- Relevante Sprachentwicklungsfaktoren..........\n
- Besonderheiten der Sprachentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund ………………………….\n
- Terminologieabgrenzung.\n
- Sprachliche Situation in Familien mit Migrationshintergrund\n
- Relevante Sprachentwicklungsfaktoren und mögliche Problemfelder.\n
- Diagnostik und Sprachförderung der Kinder mit Migrationshintergrund\nim Elementarbereich
- Diagnostik der kindlichen Sprachentwicklung mit Hilfe von Sprachstandserhebungen.....
- Ausgewählte Förderkonzepte der kindlichen Sprachentwicklung...\n
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich und untersucht die Besonderheiten dieser Entwicklung im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund. Ziel ist es, die relevanten Sprachentwicklungsfaktoren, potentielle Problemfelder und die Rolle von Diagnostik und Förderung in diesem Kontext zu beleuchten.
- Entwicklung der Sprache im Kindesalter
- Besonderheiten der Sprachentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Relevante Sprachentwicklungsfaktoren und mögliche Problemfelder
- Diagnostik und Sprachförderung im Elementarbereich
- Bedeutung von frühen Interventionen und Fördermaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der normalen Sprachentwicklung im Kindesalter, wobei die einzelnen Phasen und relevanten Entwicklungsfaktoren beleuchtet werden. Anschließend wird der Fokus auf die Sprachentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund gelegt. Hier werden die Besonderheiten und Herausforderungen dieser Gruppe anhand von relevanten Sprachentwicklungsfaktoren und möglichen Problemfeldern untersucht. Im nächsten Kapitel geht es um Diagnostik und Sprachförderung im Elementarbereich. Es werden verschiedene Sprachstandserhebungen vorgestellt und ausgewählte Förderkonzepte im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Sprachentwicklung, Migrationshintergrund, Kinder, Elementarbereich, Diagnostik, Sprachförderung, Sprachstandserhebungen, Förderkonzepte, Sprachliche Situation, Familien, Problemfelder.
Häufig gestellte Fragen
Wie verläuft die Sprachentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund?
Die Entwicklung kann suboptimal verlaufen, wenn die Förderung in der Erst- oder Zweitsprache fehlt. Kinder lernen Sprachen jedoch im Vergleich zu Erwachsenen oft intuitiver und schneller.
Was sind Sprachstandserhebungen?
Das sind diagnostische Instrumente im Elementarbereich (Kindergarten), um festzustellen, wie weit die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes entwickelt sind und ob Förderbedarf besteht.
Welche Faktoren beeinflussen den Zweitspracherwerb?
Wichtige Faktoren sind das Alter des Kindes, die sprachliche Situation in der Familie, die Qualität des Kontakts zur Zielsprache und die Wertschätzung der Herkunftssprache.
Warum ist Sprachförderung im Elementarbereich so wichtig?
Frühzeitige Förderung gleicht Defizite aus, bevor das Kind in die Schule kommt, und ist somit entscheidend für den späteren Bildungserfolg und die soziale Integration.
Welche Förderkonzepte gibt es?
Es gibt verschiedene Ansätze, von der alltagsintegrierten Sprachförderung bis hin zu spezifischen Programmen, die gezielt Wortschatz und Grammatik trainieren.
- Quote paper
- Yana Petrosyan (Author), 2015, Sprachliche Entwicklung, Diagnostik und Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301327