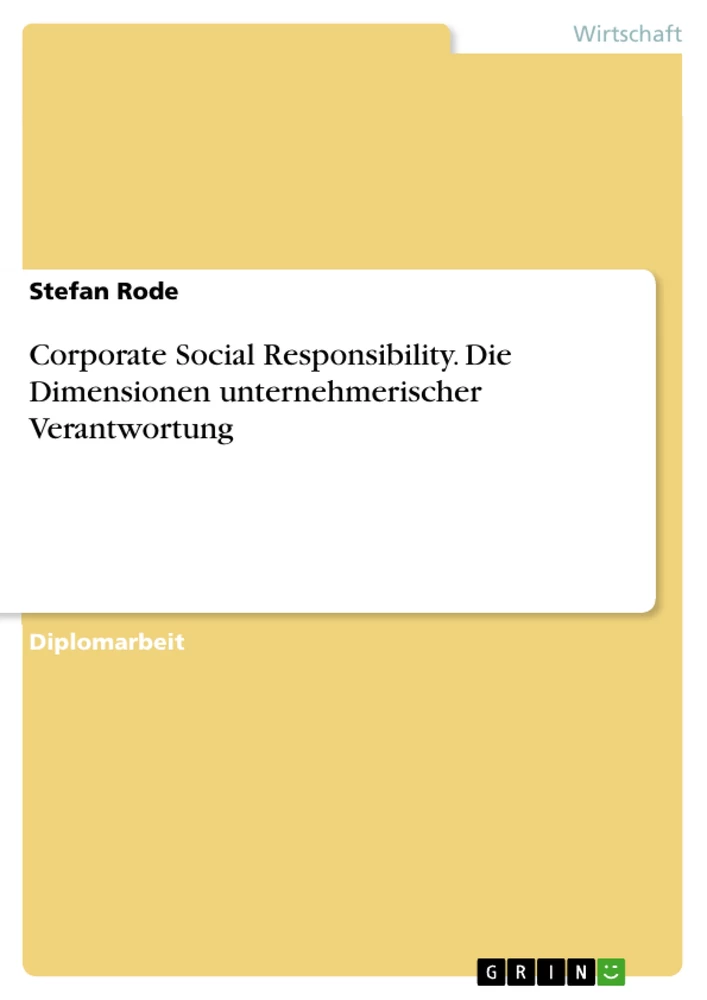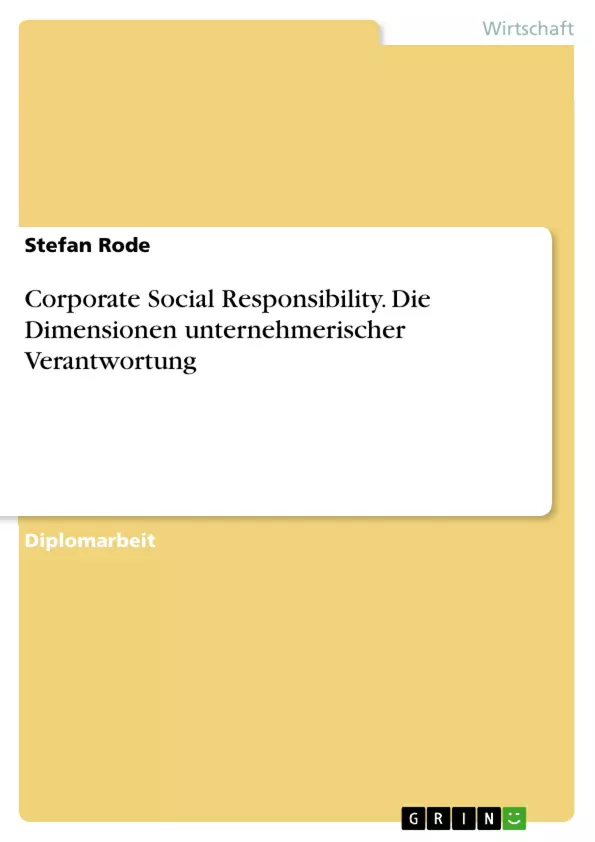„Corporate Social Responsibility“, nachfolgend kurz CSR genannt, ist heute ein Begriff, der in verschiedenen Kontexten der Wissenschaft und Praxis vielfältig verwendet wird. Der Aktionsplan CSR, sowie die internationale Norm ISO 26000 versuchen die verschiedenen Dimensionen der CSR abzustecken, können jedoch nur einzelne Meinungen im vielstimmigen Tenor der Begriffsauslegung darstellen.
Dabei handelt es sich beim Wertesystem der CSR keinesfalls um eine gänzlich neue Konzeption. Freiwillige unternehmerische Verantwortung kann bereits im 15. und 16. Jahrhundert nachgewiesen werden. Noch älter ist das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns als Ehrenkodex.
In Zusammenhang mit CSR wird oftmals auch der Begriff der Nachhaltigkeit („sustainable development“) genannt, welcher sich aufgrund der weiteren Ausweitung der sozialen Unternehmerverantwortung auf ökologische und ökonomische Aspekte mit dem CSR-Begriff vermischt. Diese Annäherung wird in der Arbeit kritisch betrachtet werden.
In der Wohnungswirtschaft ist der Begriff der Nachhaltigkeit oftmals mit Gedanken an LEED- oder DGNB-Zertifikate verknüpft. Aber sind diese tatsächlich Ausdrucksform einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit? Oberflächliches CSR wirkt unglaubwürdig und schadet der Reputation des Unternehmens mehr als sie nützt. CSR darf kein reines „Marketing-Gimmick“ sein, sondern muss als „echte“ CSR-Marke mit Inhalten und Werten unternehmerisch gelebt werden. Gibt es hierzu Beispiele des „best practice“? Hilft ein Blick in die Vergangenheit?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Corporate Social Responsibility
- 2.1 Problemstellung
- 2.2 Begriffsbestimmung und Dimensionen
- 2.2.1 Frühe angelsächsische Auslegung (1950 – 1990)
- 2.2.2 Derzeitige deutsche Auslegung (2000 - 2011)
- 2.2.3 Institutionalisierung von CSR
- 2.2.3.1 Aktionsplan CSR (Bundesregierung)
- 2.2.3.2 ISO 26000
- 2.3 CSR und Nachhaltigkeitsmanagement in Abgrenzung
- 2.3.1 Begriff der Nachhaltigkeit
- 2.3.2 Überschneidungen von CSR und Nachhaltigkeitsmanagement
- 2.3.3 Unterschiede zwischen CSR und Nachhaltigkeitsmanagement
- 3. Margarethenhöhe in Essen
- 3.1 Stiftungsphilosophie und Historie
- 3.2 Architektur und Lage
- 3.3 Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge
- 3.3.1 Portfolio der Margarethe Krupp-Stifung für Wohnungsfürsorge
- 3.3.2 Heutige Tätigkeit der Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge
- 4. Margarethenhöhe im Kontext von CSR
- 4.1 Einbettung in CSR-Konzepte
- 4.1.1 Ökonomische Aspekte
- 4.1.2 Soziale Aspekte
- 4.1.3 Ökologische Aspekte
- 4.2 Zusammenfassende Bewertung der Margarethenhöhe im Kontext von CSR
- 4.1 Einbettung in CSR-Konzepte
- 5. Schlussbetrachtung: Denkmal und Verantwortung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert den Begriff der „Corporate Social Responsibility“ (CSR) und untersucht die Einbettung des historischen Wohnungsbauprojekts Margarethenhöhe in Essen in aktuelle CSR-Konzepte. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des CSR-Begriffs und dessen Dimensionen, um die Margarethenhöhe im Kontext von ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten der unternehmerischen Verantwortung zu bewerten.
- Historische Entwicklung des CSR-Begriffs
- Dimensionen und Auslegung von CSR
- Zusammenhang von CSR und Nachhaltigkeit
- Die Margarethenhöhe als Beispiel für unternehmerische Verantwortung
- Bewertung der Margarethenhöhe im Kontext von CSR-Kriterien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von CSR im heutigen Kontext beleuchtet und die zentrale Fragestellung der Arbeit definiert. Kapitel 2 analysiert den Begriff der CSR und seine historische Entwicklung, von frühen angelsächsischen bis zu den aktuellen deutschen Auslegungen. Es beleuchtet die Institutionalisierung von CSR durch den Aktionsplan CSR der Bundesregierung und die ISO 26000-Norm. Kapitel 3 widmet sich der Margarethenhöhe in Essen, beleuchtet ihre Stiftungsphilosophie und Geschichte, sowie die Architektur und Lage. Es beschreibt die Aktivitäten der Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge und deren Portfolio. Kapitel 4 untersucht die Einbettung der Margarethenhöhe in CSR-Konzepte und analysiert ihre ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte. Schließlich stellt Kapitel 5 eine Schlussbetrachtung dar, die den historischen Aspekt der Margarethenhöhe mit dem aktuellen Verständnis von CSR in Beziehung setzt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Corporate Social Responsibility (CSR), der Nachhaltigkeit, der historischen Entwicklung von CSR-Konzepten, der Einbettung von CSR in der Wohnungswirtschaft, und der Margarethenhöhe in Essen als Beispiel für unternehmerische Verantwortung. Dabei werden zentrale Begriffe wie „frühe angelsächsische Auslegung“, „derzeitige deutsche Auslegung“, „Aktionsplan CSR“, „ISO 26000“, „Nachhaltigkeitsmanagement“, „Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge“ und „Gartenstadt“ im Kontext der CSR analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die freiwillige unternehmerische Verantwortung, die über gesetzliche Anforderungen hinausgeht und soziale, ökologische sowie ökonomische Aspekte umfasst.
Wie hängen CSR und Nachhaltigkeit zusammen?
Obwohl sich die Begriffe oft vermischen, wird CSR häufig als der Beitrag der Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) verstanden.
Was ist die Margarethenhöhe in Essen und warum ist sie für CSR relevant?
Die Margarethenhöhe ist ein historisches Wohnungsbauprojekt der Margarethe Krupp-Stiftung. Sie gilt als frühes Beispiel für gelebte unternehmerische Verantwortung im sozialen Wohnungsbau.
Was ist die ISO 26000?
Die ISO 26000 ist ein internationaler Leitfaden, der Organisationen dabei unterstützt, gesellschaftliche Verantwortung zu definieren und umzusetzen.
Darf CSR als reines Marketing-Instrument genutzt werden?
Nein, die Arbeit warnt davor, dass oberflächliches CSR ("Marketing-Gimmick") der Reputation schadet. Es muss als echte Marke mit Werten im Unternehmen gelebt werden.
- Quote paper
- Stefan Rode (Author), 2012, Corporate Social Responsibility. Die Dimensionen unternehmerischer Verantwortung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301436