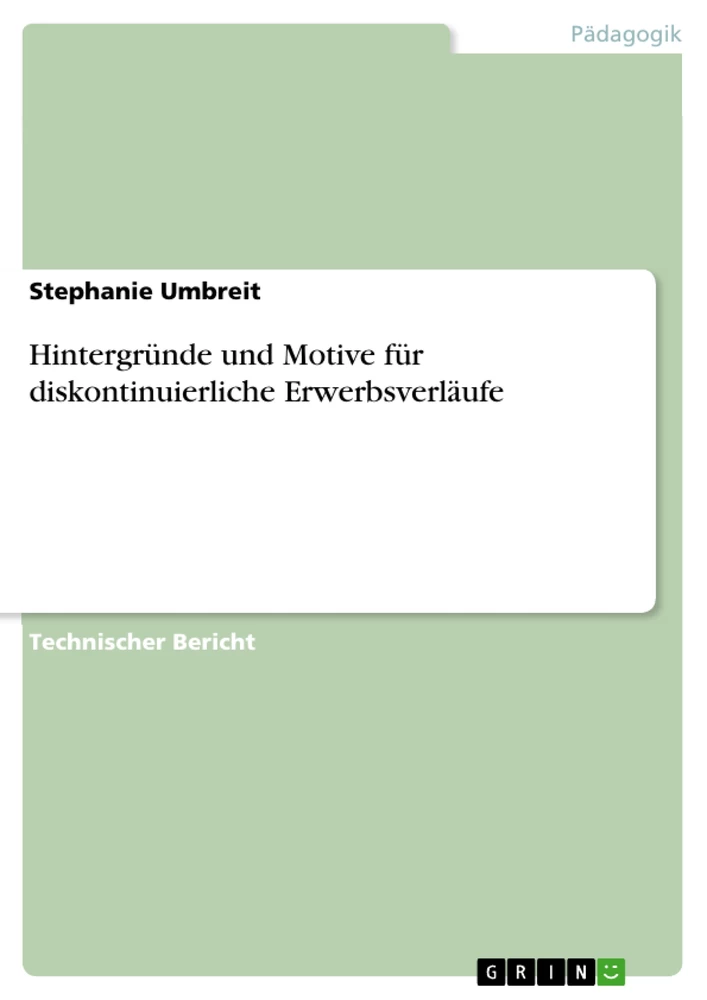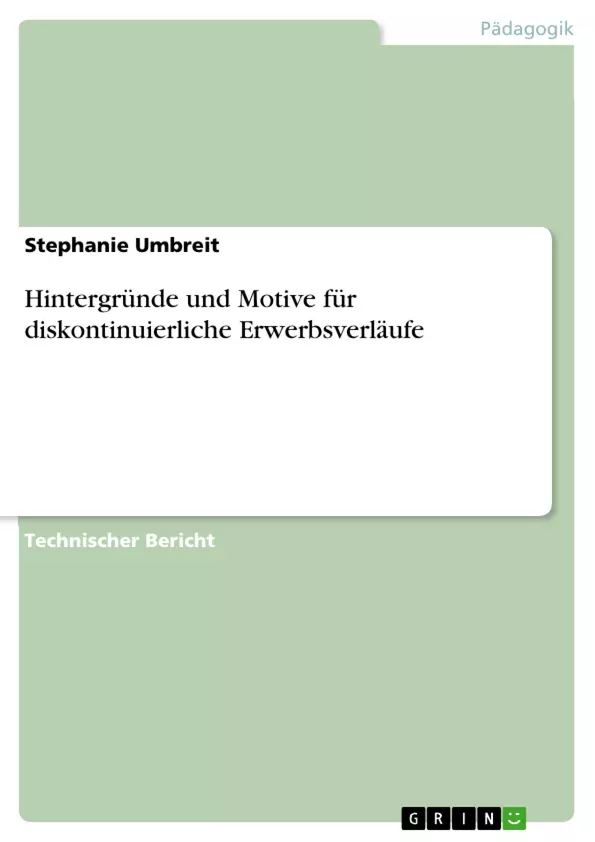Ob in der Zeitung oder im Fernsehen, jeden Tag gibt es neue Meldungen zur aktuellen Arbeitsmarktpolitik. Zum einen ist zwischen der Regierung und der Opposition im Bundestag ein Streit zum Thema Mindestlohn ausgebrochen und ein weiteres topaktuelles Thema ist der Fachkräftemangel in Deutschland.
Wenn man sich jedoch den Arbeitsmarkt der letzten Jahre anschaut, gibt es noch ganz andere Entwicklungen, die die Politik nicht wirklich ändern oder beseitigen kann. So beschreiben neuere Arbeitsmarktstudien dass Beschäftigungen in einem Normalarbeitsverhältnis immer mehr abnehmen und „atypische“ und „flexible“ Beschäftigungsverhältnisse zunehmen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass es zu Debatten über die These der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses kam (vgl. Mückenberger 1990: 159ff.; ).
Auch die Soziologen Pongratz und Voß beschäftigten sich mit den neuen Entwicklungen des Arbeitsmarktes. „"Entgrenzungen" von Arbeitsverhältnissen finden sich, auf unterschiedlichen sozialen Ebenen: auf gesellschaftlicher Ebene, im Verhältnis von Betrieben zu ihren Umwelt, auf der Ebene von Arbeitsplätzen. Wir möchten zeigen, daß auch auf Ebene von Arbeitskraft Entgrenzungen stattfinden.“ (Pongratz/Voß 1998: 1) Die Wissenschaftler entwickelten die These des Arbeitskraftunternehmers (vgl. Pongratz/ Voß 2003; Voß/ Pongratz 1998).
Der Arbeitskraftunternehmertypus besagt das der Mensch als Unternehmer selber agiert. Das bedeutet, er ist Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft „die er innerhalb des Betriebs kontinuierlich zur Leistung anbietet und sich im Arbeitsprozess gezielt selbst organisiert“ (Pongratz/Voß 2003: 24). Der Arbeitskraftunternehmer zeichnet sich durch verstärkte Selbstkontrolle, erweiterte Selbst-Ökonomisierung, Selbst-Rationalisierung und Verbetrieblichung der Lebensführung aus. (vgl. Pongratz/Voß 1998: 3ff.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchungsansatz
- Einleitung und Fragestellung
- Handlungsmodell
- Methode
- Meine Teilfrage
- Stand der Forschung
- Fallanalysen
- Fallanalyse 1
- Fallanalyse 2
- Fallanalyse 3
- Fallanalyse 4
- Zusammenfassung, Schlussfolgerung und offene Fragen
- Zusammenfassung der Einzelschritte
- Schlussfolgerung meiner Analyse
- Offene Fragen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lehrforschung befasst sich mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen aus der Perspektive der Arbeitnehmer. Ziel ist es, die Gründe für Arbeitsplatzwechsel im höheren Alter zu untersuchen, insbesondere angesichts der Risiken, die mit einem solchen Wechsel verbunden sind.
- Motivation von Arbeitnehmern für Arbeitsplatzwechsel im höheren Alter
- Einflussfaktoren auf die Entscheidung für einen Arbeitsplatzwechsel
- Analyse von diskontinuierlichen Erwerbsverläufen anhand von Fallstudien
- Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktentwicklung und individuellen Karriereentscheidungen
- Relevanz von Arbeitskraftunternehmertum im Kontext von flexiblen Arbeitsverhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der diskontinuierlichen Erwerbsverläufe ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung dar. Das Kapitel "Untersuchungsansatz" erläutert die Forschungsfrage, das Handlungsmodell und die Methode der Lehrforschung. Der "Stand der Forschung" fasst relevante Literatur zur Thematik zusammen. Die Fallanalysen präsentieren detaillierte Einblicke in die individuellen Erfahrungen von Arbeitnehmern mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen. Die Zusammenfassung, Schlussfolgerung und offene Fragen fassen die Ergebnisse der Lehrforschung zusammen und stellen mögliche weitere Forschungsrichtungen in den Vordergrund.
Schlüsselwörter
Diskontinuierliche Erwerbsverläufe, Arbeitsplatzwechsel, höheres Alter, Handlungsmodell, Arbeitskraftunternehmertum, flexible Arbeitsverhältnisse, Fallanalysen, Arbeitsmarktentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind diskontinuierliche Erwerbsverläufe?
Dies sind Lebensläufe, die durch Brüche wie Arbeitsplatzwechsel, Phasen der Arbeitslosigkeit oder berufliche Neuorientierungen statt durch eine lebenslange Beschäftigung bei einem Arbeitgeber geprägt sind.
Was besagt die These des "Arbeitskraftunternehmers"?
Nach Pongratz und Voß agieren Arbeitnehmer zunehmend als Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft, was Selbstkontrolle, Selbst-Ökonomisierung und eine stärkere Selbst-Organisation erfordert.
Warum wechseln Menschen im höheren Alter noch den Arbeitsplatz?
Gründe können der Wunsch nach Selbstverwirklichung, Unzufriedenheit im aktuellen Job oder die Notwendigkeit sein, sich an flexiblere Arbeitsmarktbedingungen anzupassen.
Was versteht man unter der "Erosion des Normalarbeitsverhältnisses"?
Damit ist die Abnahme von unbefristeten Vollzeitstellen zugunsten von atypischen Beschäftigungsformen wie Teilzeit, Befristung oder Leiharbeit gemeint.
Welche Rolle spielt die Selbst-Rationalisierung?
Im Konzept des Arbeitskraftunternehmers bedeutet es, dass Individuen ihre gesamte Lebensführung effizient auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes ausrichten.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Umbreit (Autor:in), 2012, Hintergründe und Motive für diskontinuierliche Erwerbsverläufe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301628