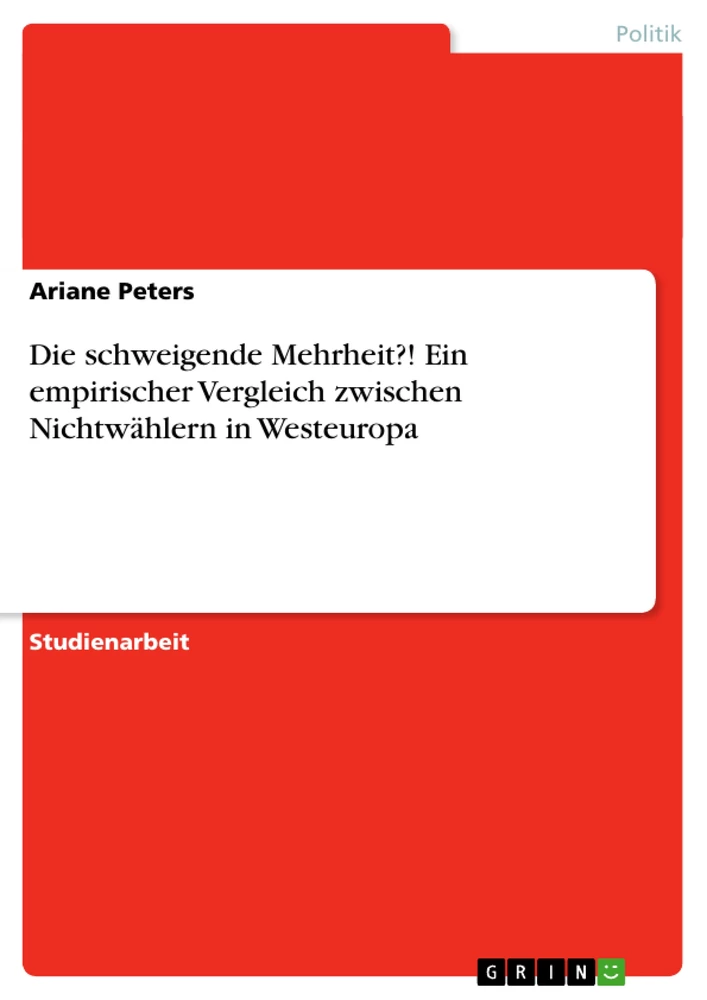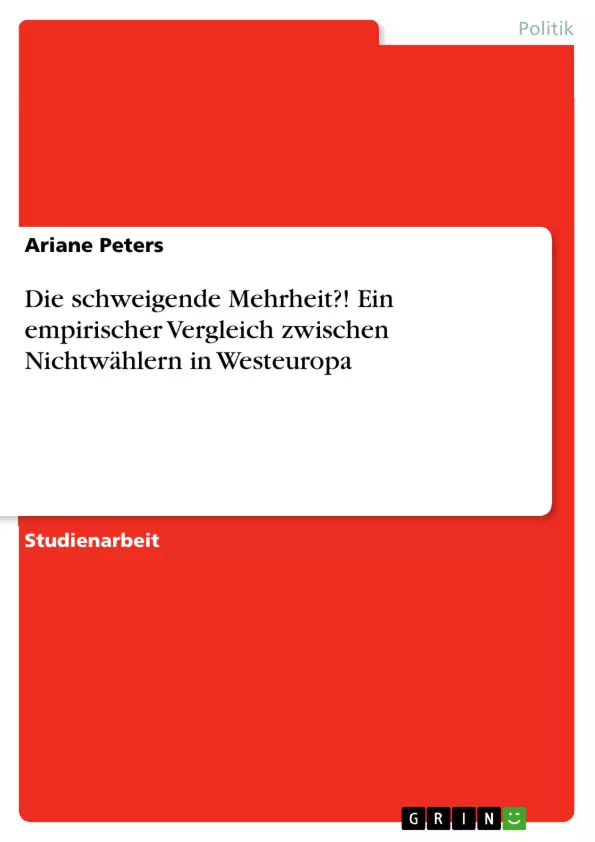Die politische Wahl stellt eine vergleichsweise wenig Engagement erfordernde Legitimation des politischen Systems seitens der Bevölkerung dar. Dennoch wächst der Anteil derjenigen Westeuropäer, die sich ihrer Wahlstimme enthalten. Der Anstieg des Nichtwähleranteils in Westeuropa bietet Anlass zu gezielten Untersuchungen und kritischen Fragen: Befindet sich Westeuropa in einem Stadium der Politikverdrossenheit? Nimmt das Vertrauen der Bürger in das demokratische System an sich ab? Welche Bedeutung wird politischen Institutionen wie dem Parlament in westeuropäischen Demokratien noch beigemessen? Ist die abnehmende Wahlbeteiligung Ausdruck einer allgemeinen Zufriedenheit mit der Funktionsweise des politischen Systems oder das Anzeichen für eine gestörte Beziehung zwischen Wählern und Gewählten?
Zur Beantwortung der vorliegenden Fragen werde ich in folgenden Schritten vorgehen: Im theoretischen Teil dieser Arbeit gilt es zunächst die Begriffe Politikverdrossenheit und Nichtwähler zu definieren. Anschließend werde ich die damit in Verbindung stehende Krisen- und Normalisierungsthese näher erläutern. Nach einer kurzen Analyse der Wahlbeteiligungsentwicklung in elf westeuropäischen Ländern, wird im empirischen Teil dieser Arbeit untersucht, ob Westeuropa sich in einem Stadium der Politikverdrossenheit befindet und welche “Objekte“ den Unmut der Bürger auf sich ziehen. Auf Grundlage des European Value Survey von 1999 werden dabei sowohl die Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Wählern und Nichtwählern aufgezeigt. Mit den empirisch dargelegten Befunden zum Verhältnis von Demokratie und Nichtwahl, werde ich belegen, dass in Westeuropa von Demokratieverdrossenheit nichts zu verspüren ist und auch keine generelle Politikverdrossenheit vorherrscht, sondern der Unmut der Bürger sich in erster Linie auf Parteien und Politikern bezieht. Zum Ende dieser Arbeit wird es eine kurze Zusammenfassung geben, mit dem Ziel weitere Perspektiven für die zukünftige Forschung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1. Definitionen der Begriffe
- 2.1.1. Politikverdrossenheit
- 2.1.2. Typologie der Nichtwähler
- 2.1.3. Normalisierungs- und Krisenthese
- 3. Empirischer Teil
- 3.1. Begründung der Fallauswahl
- 3.3. Empirische Befunde
- 3.3.1. Die Wahlbeteiligung im westeuropäischen Vergleich
- 3.3.2. Demokratie- und Politikverdrossenheit im westeuropäischen Vergleich
- 4. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Anstieg der Nichtwählerquote in Westeuropa und hinterfragt mögliche Ursachen wie Politikverdrossenheit und sinkendes Vertrauen in das demokratische System. Sie analysiert die Wahlbeteiligung und die Einstellungen von Wählern und Nichtwählern im europäischen Vergleich.
- Definition und Typologie von Politikverdrossenheit und Nichtwählern
- Analyse der Wahlbeteiligung in westeuropäischen Ländern
- Vergleich der Einstellungen von Wählern und Nichtwählern zum demokratischen System
- Untersuchung der Beziehung zwischen Nichtwahl und Unzufriedenheit mit politischen Institutionen
- Aufzeigen von Forschungsansätzen für zukünftige Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für den steigenden Anteil von Nichtwählern in Westeuropa vor. Sie skizziert den Forschungsansatz, der zunächst eine Klärung der Begriffe Politikverdrossenheit und Nichtwähler beinhaltet, bevor im empirischen Teil die Wahlbeteiligung und Einstellungen von Wählern und Nichtwählern untersucht werden. Die Einleitung leitet zu den folgenden Kapiteln über, in denen die theoretischen Grundlagen gelegt und die empirische Untersuchung detailliert beschrieben werden. Das erklärte Ziel ist es, zu klären, ob der Anstieg der Nichtwähler ein Zeichen von Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit, oder allgemeiner Unzufriedenheit ist.
2. Theoretischer Teil: Dieses Kapitel widmet sich der Definition zentraler Begriffe. Es thematisiert die vielschichtige und uneinheitliche Verwendung des Begriffs „Politikverdrossenheit“ in der sozialwissenschaftlichen Literatur und beleuchtet die verschiedenen Dimensionen dieses Phänomens, wie Parteien-, Politiker- und Demokratieverdrossenheit. Es wird kritisch auf die begriffliche Unschärfe hingewiesen und verschiedene Definitionen und Perspektiven diskutiert, unter anderem die von Andreas Schedler, der die Emotionen und die Distanzierung von der Politik als wichtige Aspekte hervorhebt. Der Abschnitt analysiert außerdem die Ursachen von Politikverdrossenheit, indem er strukturelle, rationale und akteursbezogene Determinanten unterscheidet. Insbesondere die aktive Rolle von Nichtwahl als Ausdruck von Parteienverdrossenheit wird hervorgehoben.
3. Empirischer Teil: Der empirische Teil beschreibt die Methodik der Untersuchung und präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Wahlbeteiligung und der Einstellungen von Wählern und Nichtwählern in elf westeuropäischen Ländern, basierend auf dem European Value Survey von 1999. Hier wird die Fallauswahl begründet und der Fokus auf den Vergleich zwischen Wählern und Nichtwählern gelegt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Demokratie- und Politikverdrossenheit herausgearbeitet. Dieser Teil liefert die empirischen Daten, die im letzten Kapitel zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet werden.
Schlüsselwörter
Wahlverhalten, Nichtwähler, Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, Westeuropa, European Value Survey, Wahlbeteiligung, empirische Forschung, politische Unzufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Anstieg der Nichtwählerquote in Westeuropa
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Anstieg der Nichtwählerquote in Westeuropa und analysiert mögliche Ursachen wie Politikverdrossenheit und sinkendes Vertrauen in das demokratische System. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Wahlbeteiligung und der Einstellungen von Wählern und Nichtwählern in verschiedenen westeuropäischen Ländern.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und untersucht?
Die Arbeit definiert und untersucht die Begriffe „Politikverdrossenheit“ (inklusive Parteien-, Politiker- und Demokratieverdrossenheit) und „Nichtwähler“. Es wird auf die vielschichtige und uneinheitliche Verwendung dieser Begriffe in der Literatur eingegangen und verschiedene Definitionen und Perspektiven diskutiert, z.B. die von Andreas Schedler.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert einen theoretischen Teil mit einer empirischen Untersuchung. Der empirische Teil basiert auf Daten des European Value Survey von 1999 und analysiert die Wahlbeteiligung und die Einstellungen von Wählern und Nichtwählern in elf westeuropäischen Ländern. Die Fallauswahl wird begründet und ein Vergleich zwischen Wählern und Nichtwählern durchgeführt.
Welche Länder werden im empirischen Teil untersucht?
Der empirische Teil der Arbeit konzentriert sich auf elf westeuropäische Länder. Die genauen Länder werden in der Arbeit selbst benannt, sind aber in dieser Kurzfassung nicht spezifiziert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Der empirische Teil präsentiert Ergebnisse zur Wahlbeteiligung und den Einstellungen von Wählern und Nichtwählern in den untersuchten Ländern. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Demokratie- und Politikverdrossenheit herausgearbeitet. Die Ergebnisse dienen der Beantwortung der Forschungsfrage nach den Ursachen des Anstiegs der Nichtwählerquote.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im letzten Kapitel präsentiert und beantworten die Forschungsfrage nach den Gründen für den steigenden Anteil von Nichtwählern in Westeuropa. Es wird untersucht, ob der Anstieg ein Zeichen von Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit oder allgemeiner Unzufriedenheit ist. Die Arbeit bietet auch Ansatzpunkte für zukünftige Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil (mit Definitionen von Politikverdrossenheit und Typologie der Nichtwähler), einen empirischen Teil (mit Begründung der Fallauswahl und empirischen Befunden im westeuropäischen Vergleich) und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahlverhalten, Nichtwähler, Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, Westeuropa, European Value Survey, Wahlbeteiligung, empirische Forschung, politische Unzufriedenheit.
- Arbeit zitieren
- Ariane Peters (Autor:in), 2004, Die schweigende Mehrheit?! Ein empirischer Vergleich zwischen Nichtwählern in Westeuropa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30172