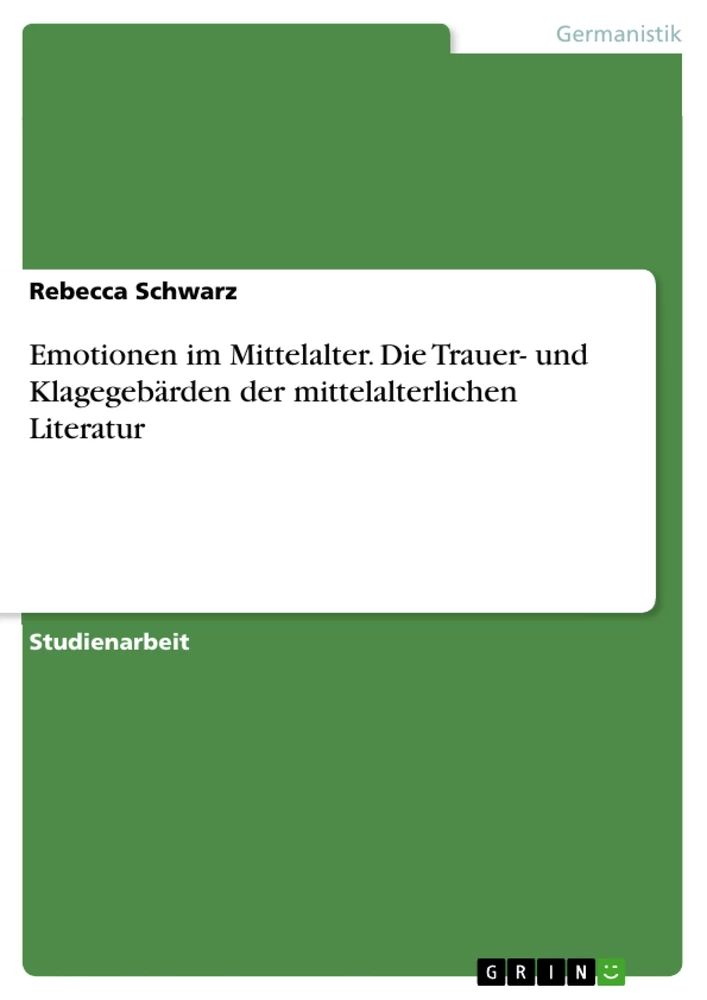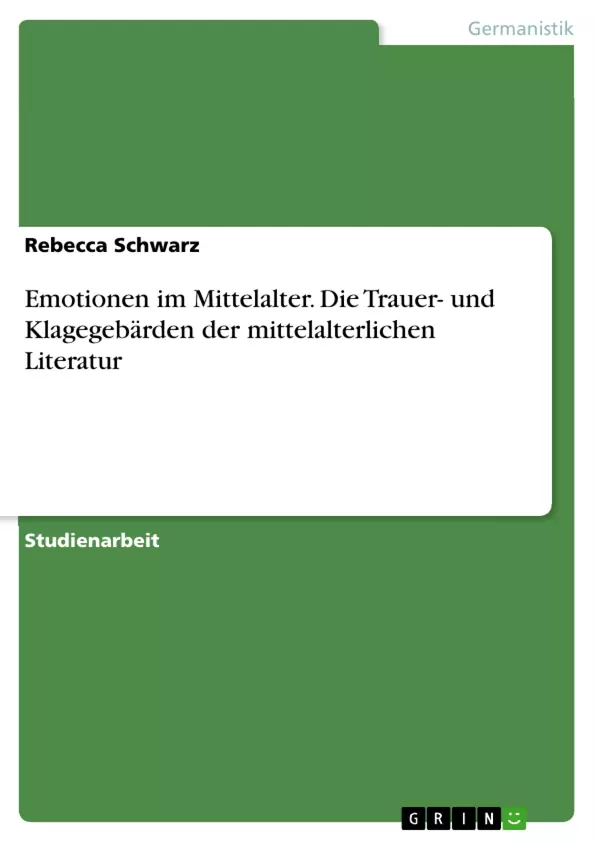Die Menschen des deutschen Mittelalters bedienten sich stets einer ausgelassenen Mimik und Gestik, die einen großen Teil der höfischen Kommunikation ausmachte und auch die literarischen Werke dieser Zeit entscheidend prägte. Aus heutiger Sicht ist diese oft heftige Gebärdensprache nicht nachvollziehbar und wirkt auf den heutigen Leser möglicherweise entfremdend oder sogar haltlos und unehrenhaft.
Doch im Mittelalter sendeten die Menschen mit bestimmten Gebaren und Zeichen Botschaften an ihren Nächsten aus. Die öffentliche Kommunikation wurde demnach von festgelegten Handlungen bestimmt, die zudem für das Zeremoniell und die Dramatik aufgebauscht wurden und daher für den modernen Leser nur schwer verständlich sind. Für den mittelalterlichen Zuhörer jedoch waren diese Gebärden, ebenso wie die dabei herausbrechenden Emotionen, verständliche Zeichen. Die Emotionen werden hierbei sowohl verbal als auch nonverbal ausgedrückt. Jedoch sind die in der narrativen Literatur dargestellten Gefühle immer auch inszeniert. Hierbei ist vor allem die Trauer eine Emotion, die auf vielschichtige Art und Weise mit der Darstellung des Körpers verknüpft ist.
In der mittelalterlichen Literatur finden sich zahlreiche solcher Klagegebärden, die körperliche Reaktionen der trauernden Personen darstellen und auf diese Weise nicht nur fühlbar sondern auch sichtbar werden. Die komplette Dimension der mittelalterlichen Klagegebärden kann jedoch nur in der Epik gefunden werden, da die Lyrik zwar anschauliche, jedoch nur lückenhafte Einblicke liefert. Die Gesten der Figuren, ihre Mimik und ihr Handeln können nicht in der wörtlichen Rede Ausdruck finden und treten maßgeblich in der mittelalterlichen Epik in Erscheinung.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Klagegebärden der mittelalterlichen Literatur und beschränkt sich hierbei auf die epischen Werke. Anhand einiger Beispiele der höfischen Epik werden die Gebärden der Trauer sowie ihr Hintergrund und ihre Bedeutung für den mittelalterlichen Hörer aufgezeigt. Zudem wird erläutert, welche Hintergründe und Ursachen zu der Trauer der Personen führen und welchen Unterschied es in der Darstellung von männlicher und weiblicher Klage gibt. Darüber hinaus soll anhand einiger beispielhafter Werke aus der epischen Literatur verdeutlicht werden, dass intensives Klageverhalten der Figuren letztendlich auch deren Tod herbeiführen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Klage in der höfischen Welt des Mittelalters
- Gründe der Trauer in der höfischen Literatur
- Das Trauerverhalten im Mittelalter
- Trauer- und Klagegebärden in der mittelalterlichen Literatur
- Kopfsenken und Versagen der Sprache
- Selbstverletzung
- Weinen und Schreien
- Händeringen und Krachen des Herzens
- Weitere Klage- und Trauergebärden
- Beispiele von Trauer- und Klagegebärden in der mittelalterlichen Literatur
- Konrad von Würzburg: Partonopier und Meliur
- Heinrich von Veldeke: Eneasroman
- Das Rolandslied des Pfaffen Konrad
- Gottfried von Straßburg: Tristan
- Der Tod
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Trauer- und Klagegebärden in der mittelalterlichen Literatur, insbesondere in der höfischen Epik. Sie untersucht, welche Gründe zur Trauer führten, wie sich diese in körperlichen Reaktionen manifestierten und welche Bedeutung die Darstellung von Trauer für das Publikum hatte. Dabei werden Unterschiede in der Darstellung männlicher und weiblicher Klage sowie die mögliche Verbindung zwischen Klage und Tod beleuchtet.
- Klagegebärden in der mittelalterlichen Literatur
- Gründe für Trauer und Klage in der höfischen Epik
- Darstellung von Trauer im Kontext der höfischen Welt
- Unterschiede in der Darstellung männlicher und weiblicher Klage
- Die mögliche Verbindung zwischen Klage und Tod
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Trauer und Klagegebärden in der mittelalterlichen Literatur ein und beleuchtet den Kontext der höfischen Kommunikation. Kapitel 2 betrachtet die Rolle der Klage in der höfischen Welt des späten 12. Jahrhunderts und untersucht, wie Trauer und Schmerz in die höfische Dichtung Einzug halten. Kapitel 3 befasst sich mit den Gründen für die Trauer in der höfischen Literatur, insbesondere mit dem Verlust geliebter Menschen, der Verletzung der Ehre und der Angst um das Schicksal anderer. Kapitel 4 analysiert das Trauerverhalten im Mittelalter und die Bedeutung von körperlichen Reaktionen als Ausdruck von Emotionen. Kapitel 5 widmet sich den verschiedenen Klage- und Trauergebärden, die in der Literatur beschrieben werden, wie z. B. Kopfsenken, Selbstverletzung, Weinen und Schreien. Kapitel 6 präsentiert Beispiele für Trauer- und Klagegebärden in bekannten Werken der höfischen Epik, wie z. B. „Partonopier und Meliur“ von Konrad von Würzburg oder „Tristan“ von Gottfried von Straßburg.
Schlüsselwörter
Trauer, Klage, höfische Epik, Mittelalter, Körperlichkeit, Emotionen, Kommunikation, Gestik, Mimik, Selbstverletzung, Tod, höfische Welt, Hohe Mut, mâze, Nibelungenlied, Kriemhilt, Siegfried.
- Quote paper
- Rebecca Schwarz (Author), 2012, Emotionen im Mittelalter. Die Trauer- und Klagegebärden der mittelalterlichen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301754