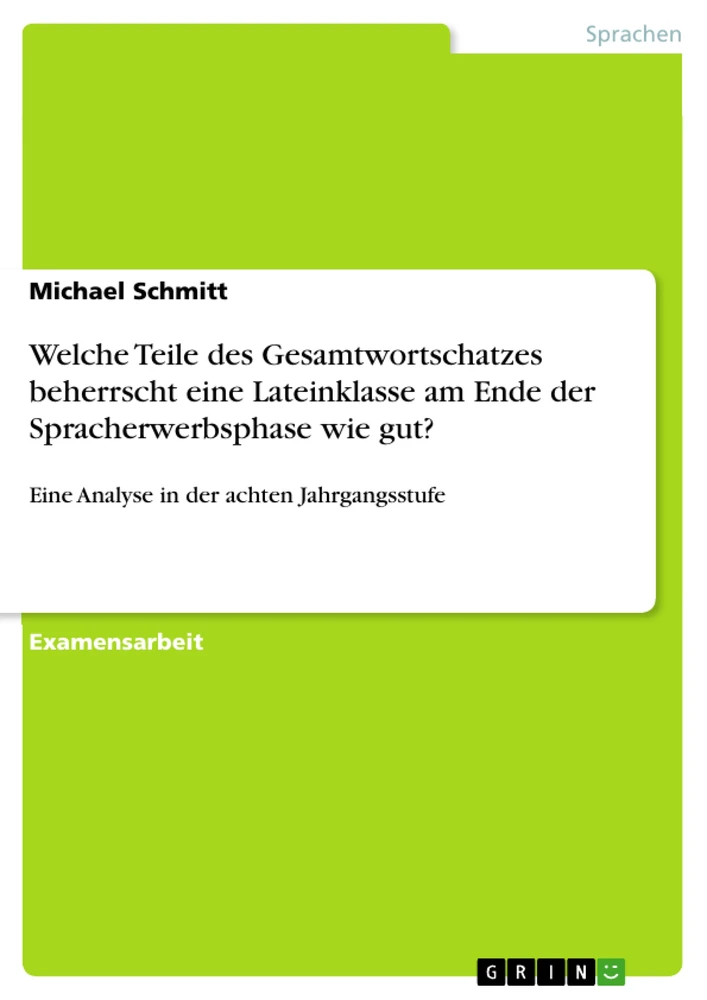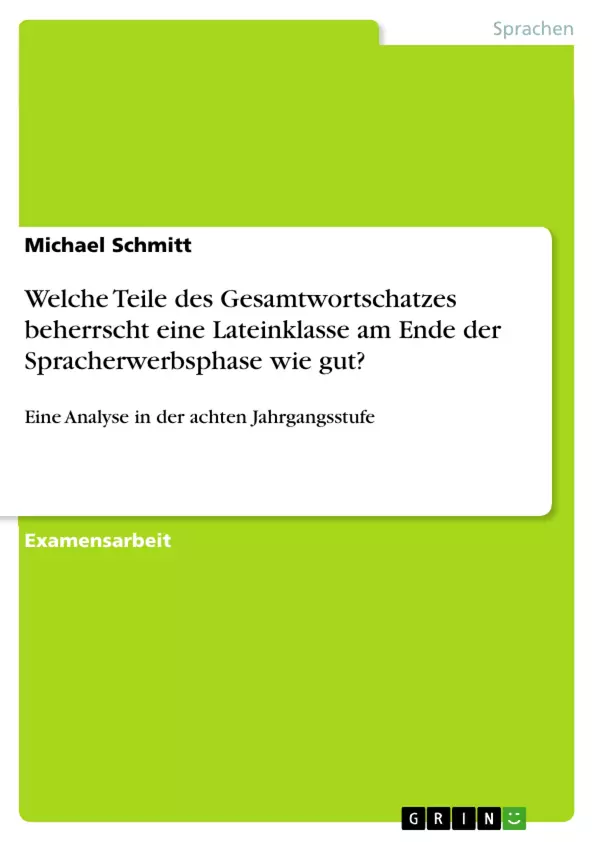In einer achten Jahrgangsstufe eines bayerischen Gymnasiums, d.h. am Ende der Spracherwerbsphase, wurde anhand von Vokabeltests eruiert, welche Teile des Gesamtwortschatzes wie gut bei den Schülern verankert sind.
Beispielsweise wurde untersucht, ob die Schüler eine bestimmte Wortart besser beherrschen als andere.
Anders formuliert, überprüft die vorliegende Arbeit, was Wortschatzarbeit in der Schule leistet und wo der Hebel in Zukunft angesetzt werden muss.
Hierzu wurden aus einem theoretischen ersten Teil der Arbeit heraus Hypothesen aufgestellt. Diese wurden mit schriftlichen Wortschatztests, welche in einer Lateinklasse durchgeführt wurden, überprüft.
An die Präsentation der Ergebnisse schließen sich sowohl eine Einordnung derselben an, sowie Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen des Vokabellernens
- Der Grundwortschatz der Spracherwerbsphase
- Lernpsychologie beim Vokabellernen
- Konzeption der Untersuchung
- Beschreibung der Klasse
- Der untersuchte Wortschatz
- Konzeption der Tests
- Vorgehen bei der Auswertung
- Darstellung der Ergebnisse
- Hypothesen 1 und 2
- Hypothese 3
- Hypothese 4
- Hypothese 5
- Einordnung der Ergebnisse
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Wortschatzumfang einer Lateinklasse am Ende der Spracherwerbsphase in der achten Jahrgangsstufe. Ziel ist es, herauszufinden, welche Teile des Grundwortschatzes besonders gut oder weniger gut beherrscht werden und ob Merkmale von Vokabeln den Lernerfolg beeinflussen. Die Ergebnisse sollen Aufschlüsse für einen effizienteren Lateinunterricht liefern.
- Analyse des Wortschatzbeherrschung in einer Lateinklasse der achten Jahrgangsstufe.
- Identifizierung von Abschnitten des Grundwortschatzes mit unterschiedlichem Beherrschungsgrad.
- Untersuchung des Einflusses von Vokabelmerkmalen auf den Lernerfolg.
- Entwicklung von Implikationen für einen effizienteren Lateinunterricht.
- Bedeutung der Lernpsychologie für die Wortschatzvermittlung im Lateinunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beherrschungsgrad des lateinischen Grundwortschatzes am Ende der Spracherwerbsphase. Sie verweist auf die hohe Fehlerquote aufgrund mangelnden Wortschatzwissens in Schülerübersetzungen und formuliert die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung betont die Relevanz der Untersuchung für einen effizienteren Lateinunterricht.
Theoretische Grundlagen des Vokabellernens: Dieses Kapitel beleuchtet den Bamberger Wortschatz als Grundlage des Lehrwerks und die Lernpsychologie des Vokabellernens. Es wird der Grundwortschatz der Spracherwerbsphase definiert und in drei Blöcke unterteilt (Lektionen 1-20, 21-40, 41-58). Es werden Hypothesen aufgestellt, die den Verlauf der Untersuchung leiten, insbesondere die Hypothese, dass der erste Block am besten beherrscht wird aufgrund der hohen Lerneffizienz zu Beginn des Unterrichts. Das Kapitel diskutiert auch Herausforderungen beim Vokabellernen, wie ungünstige Wortreihenfolgen oder irreführende Merkhilfen.
Konzeption der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung. Es wird die untersuchte Klasse charakterisiert, der Umfang des untersuchten Wortschatzes definiert und die Konzeption der Wortschatztests erläutert. Es wird das Vorgehen bei der Auswertung der Testergebnisse detailliert dargestellt. Die Beschreibung der Methodik legt den Fokus auf die wissenschaftliche Validität und die Objektivität der Untersuchung.
Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Wortschatztests, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Hypothesen. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach den einzelnen Hypothesen (1-5), die im Kapitel "Theoretische Grundlagen" eingeführt wurden, um eine systematische und nachvollziehbare Analyse zu gewährleisten. Es wird auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen, ohne jedoch die detaillierten Zahlenwerte oder statistischen Auswertungen zu präsentieren.
Einordnung der Ergebnisse: Dieses Kapitel ordnet die Ergebnisse der Untersuchung in den Kontext der Fachdidaktik und Lernpsychologie ein. Die Ergebnisse werden diskutiert und in Beziehung zu den theoretischen Grundlagen gesetzt. Hier werden Zusammenhänge hergestellt und die Bedeutung der Ergebnisse für den Unterricht reflektiert.
Schlüsselwörter
Latein, Vokabellernen, Spracherwerb, Grundwortschatz, Wortschatztests, Lernpsychologie, Hypothesen, Lehrwerk, Schülerleistung, Lateinunterricht, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wortschatzumfang im Lateinunterricht
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wortschatzumfang einer Lateinklasse am Ende der Spracherwerbsphase (8. Jahrgangsstufe). Im Fokus steht die Frage, welche Teile des Grundwortschatzes besonders gut oder weniger gut beherrscht werden und ob Merkmale von Vokabeln den Lernerfolg beeinflussen. Das Ziel ist es, Erkenntnisse für einen effizienteren Lateinunterricht zu gewinnen.
Welche Inhalte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, theoretische Grundlagen des Vokabellernens (inkl. Lernpsychologie und Definition des Grundwortschatzes), die Konzeption der Untersuchung (Beschreibung der Klasse, der untersuchte Wortschatz, die Testkonzeption und die Auswertungsmethode), die Darstellung der Ergebnisse (aufgeschlüsselt nach Hypothesen), die Einordnung der Ergebnisse und ein Fazit mit Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie hoch ist der Beherrschungsgrad des lateinischen Grundwortschatzes am Ende der Spracherwerbsphase? Zusätzlich werden Fragen untersucht, welche Teile des Grundwortschatzes unterschiedlich gut beherrscht werden und wie Vokabelmerkmale den Lernerfolg beeinflussen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Methodik der Untersuchung detailliert. Es wird die untersuchte Klasse charakterisiert, der Umfang des untersuchten Wortschatzes definiert und die Konzeption der Wortschatztests erläutert. Das Vorgehen bei der Auswertung der Testergebnisse wird ebenfalls detailliert dargestellt, mit Fokus auf wissenschaftliche Validität und Objektivität.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Wortschatztests, aufgeschlüsselt nach einzelnen Hypothesen (1-5). Die detaillierten Zahlenwerte und statistischen Auswertungen werden jedoch nicht präsentiert; es wird lediglich eine Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben.
Wie werden die Ergebnisse eingeordnet?
Die Ergebnisse werden im Kontext der Fachdidaktik und Lernpsychologie eingeordnet und diskutiert. Es werden Zusammenhänge hergestellt und die Bedeutung der Ergebnisse für den Lateinunterricht reflektiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Latein, Vokabellernen, Spracherwerb, Grundwortschatz, Wortschatztests, Lernpsychologie, Hypothesen, Lehrwerk, Schülerleistung, Lateinunterricht, Effizienz.
Auf welchen theoretischen Grundlagen basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf dem Bamberger Wortschatz als Grundlage des Lehrwerks und der Lernpsychologie des Vokabellernens. Der Grundwortschatz der Spracherwerbsphase wird definiert und in drei Blöcke unterteilt. Herausforderungen beim Vokabellernen, wie ungünstige Wortreihenfolgen oder irreführende Merkhilfen, werden ebenfalls diskutiert.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lateinlehrer, Fachdidaktiker, Lernpsychologen und alle, die sich für den Spracherwerb und den effektiven Lateinunterricht interessieren.
- Citation du texte
- Michael Schmitt (Auteur), 2014, Welche Teile des Gesamtwortschatzes beherrscht eine Lateinklasse am Ende der Spracherwerbsphase wie gut?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301865