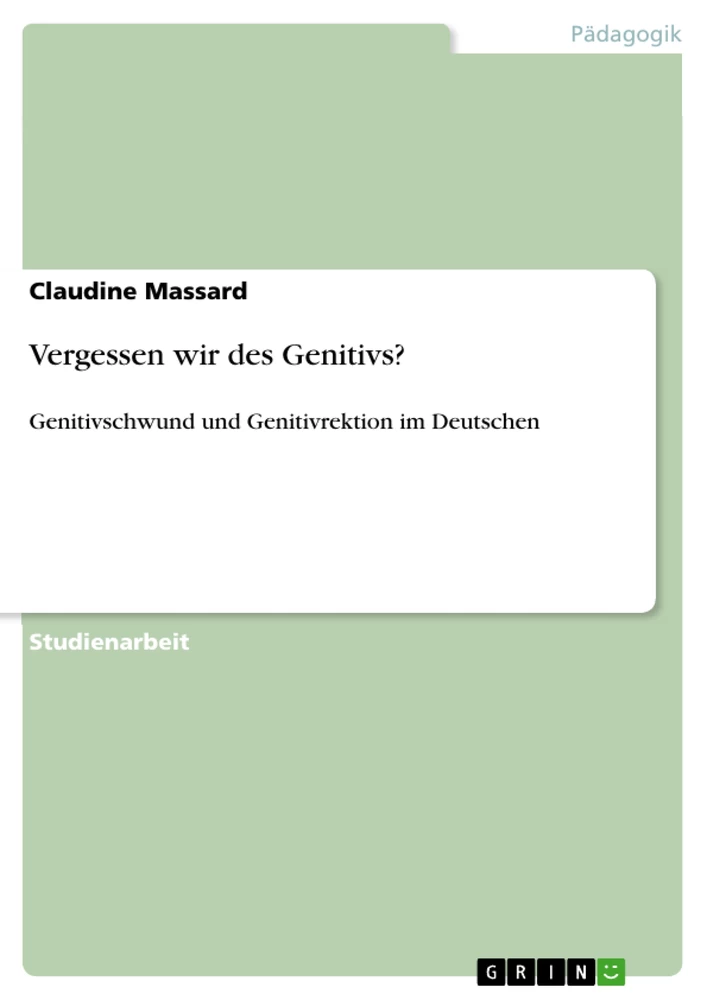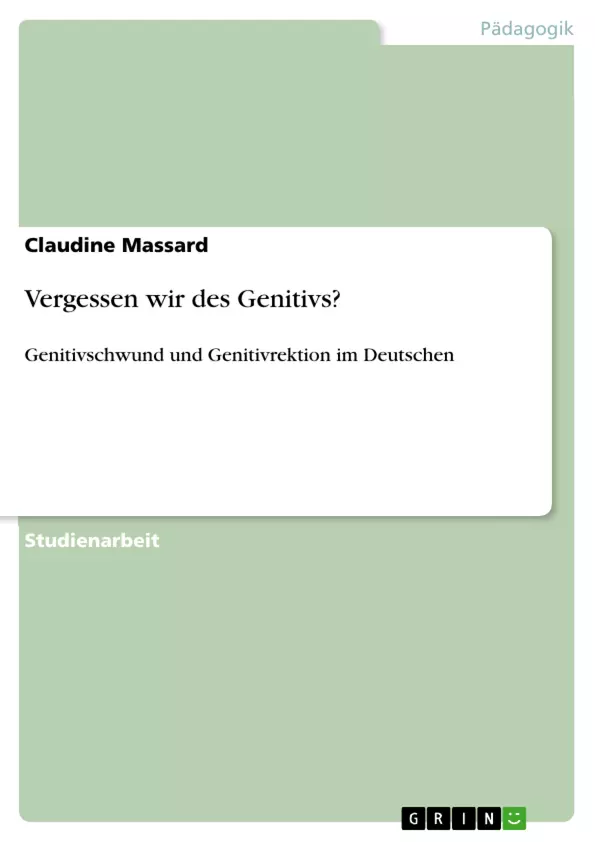Der Genitivschwund ist ein durchaus bekanntes, aber nicht ganz so rezentes Phänomen, wie man glauben möchte. Die Akkusativ-Rektion des Verbes vergessen etwa, hat sich durch den Sprachwandel soweit eingebürgert, dass heute wohl kaum einer sich noch des Genitivs bedienen würde. Lediglich Indizien, wie etwa der Name Vergissmeinnicht, lassen uns heute noch darauf schlieβen.
Populärstes Beispiel, und wohl auch Grund für die vermehrte Auseinandersetzung mit dem Thema, ist Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, welches als Kolumne „Zwiebelfisch“ startete und mittlerweile in drei Bänden und in der zwölften Auflage erschienen ist.
Die Frage, die sich in erster Linie aufdrängt, ist, ob der Genitiv wirklich dem Tode geweiht ist. Gibt es genauso „falsche“ Genitiv-Rektionen? Welche Schlüsse kann man aus dem jeweiligen Gebrauch ziehen?
Ist es überhaupt richtig von Fehlern zu reden? Was sagen die Grammatiken zu diesem Thema?
Welches sind die Gründe, die dazu führen, dass Unsicherheiten, die den Genitiv betreffen, vermehrt auftreten?
Hierzu werden zum einen, wie bereits erwähnt, Ratgeber aber auch der Duden zu Rate gezogen.
Um diesen theoretischen Aspekt dem praktischen gegenüberzustellen, werden Korpusanalysen von Claudio Di Meola mit eigenen erhaltenen Resultaten verbunden. Hierzu werden Cosmas II und das DTA verwendet.
Anschlieβend soll geprüft werden, welche Schlussfolgerungen auf dieser Basis gezogen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Genitiv als Kasus
- Funktionswandel
- Historische Entwicklung
- Genitivschwund: Ursachen und Entwicklung
- Konkurrierende Konstruktionen im verbalen Bereich
- Ersatz des Genitivs
- Der Genitivschwund im Bereich der Adjektive
- Adverbiale Verwendung
- Prädikative Verwendung
- Präpositionen
- Präpositionale Verwendung
- „Semantische Verdeutlichung“
- Regionale Gründe
- Genitivrektion: Ursachen und Entwicklung
- Präpositionale Verwendung
- Interne und externe Faktoren
- Interne Faktoren
- Grammatikalisierung
- Prestige
- Weitere Gründe
- Externe Faktoren
- Interne Faktoren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Genitivschwund im Deutschen und die damit verbundenen Ursachen und Entwicklungen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Genitivs als Kasus, analysiert konkurrierende Konstruktionen und Ersatzformen, und betrachtet regionale Einflüsse. Die Studie vergleicht theoretische Ansätze mit praktischen Korpusanalysen, um ein umfassendes Bild des Genitivgebrauchs in der Gegenwartssprache zu liefern.
- Der Genitiv als Kasus und seine Funktion im Satz
- Historische Entwicklung und Wandel des Genitivs
- Ursachen des Genitivschwunds und konkurrierende Konstruktionen
- Regionale Variationen im Genitivgebrauch
- Analyse des Genitivgebrauchs anhand von Korpusdaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Genitivschwunds ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen und Auswirkungen dieses Phänomens. Sie erläutert die Relevanz des Themas und benennt die verwendeten Methoden (Korpusanalysen, Literaturrecherche). Die Einleitung verweist auf die weitverbreitete Diskussion um den Genitiv und dessen vermeintliches Aussterben, führt aber gleichzeitig aus, dass der Genitivschwund ein komplexes und vielschichtiges Phänomen ist, das einer genaueren Betrachtung bedarf. Es wird bereits angedeutet, dass die Arbeit sowohl theoretische als auch empirische Ansätze verwenden wird, um das Thema umfassend zu beleuchten.
Der Genitiv als Kasus: Dieses Kapitel diskutiert unterschiedliche Definitionen des Genitivs als Kasus. Es werden verschiedene linguistische Perspektiven vorgestellt, die den Genitiv unterschiedlich definieren und seine Funktion im Satz unterschiedlich beschreiben. Der Fokus liegt auf der Ambiguität des Genitivs und den Schwierigkeiten, ihn eindeutig zu identifizieren. Die Diskussion um die Definition des Genitivs wird auf die Herausforderungen seiner Charakterisierung zurückgeführt, die sich aus dem Phänomen des Synkretismus und der variablen Satzstellung ergeben. Der Abschnitt über den Funktionswandel verdeutlicht die zunehmende Bedeutungsverschiebung des Genitivs im Vergleich zu anderen Kasus.
Historische Entwicklung: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Genitivs nach und beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und Auffassungen des Genitivs in der Geschichte der deutschen Grammatik. Es werden die Ansichten von verschiedenen Linguisten vorgestellt, die sich mit der Definition und der Funktion des Genitivs auseinandersetzten und aufzeigen, wie sich das Verständnis des Genitivs über die Zeit hinweg verändert hat. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wandel von der rein morphologischen Beschreibung zur syntaktischen Betrachtung des Genitivs und der damit verbundenen Schwierigkeiten, eine eindeutige und allgemeingültige Definition zu finden.
Genitivschwund: Ursachen und Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Ursachen und der Entwicklung des Genitivschwunds. Es untersucht konkurrierende Konstruktionen, insbesondere den Ersatz des Genitivs durch andere Kasus oder präpositionale Wendungen. Hier werden verschiedene Faktoren analysiert, die zum Rückgang des Genitivs beitragen, wie beispielsweise die zunehmende Verwendung des Akkusativs, die Vereinfachung der Syntax und regionale Variationen. Die Kapitel analysiert den Genitivschwund in verschiedenen syntaktischen Kontexten (Adjektive, Adverbien, Präpositionen) und beleuchtet so die Komplexität des Problems.
Genitivrektion: Ursachen und Entwicklung: In diesem Kapitel wird die Genitivrektion – also die Fähigkeit von Verben, Adjektiven und Präpositionen, den Genitiv zu regieren – im Detail untersucht. Der Fokus liegt auf den internen und externen Faktoren, die die Genitivrektion beeinflussen. Interne Faktoren betreffen die grammatikalischen Eigenschaften der Wörter selbst, während externe Faktoren soziolinguistische und sprachpolitische Aspekte miteinbeziehen. Das Kapitel analysiert, wie Grammatikalisierungsprozesse, Prestige und andere sprachinterne Entwicklungen den Gebrauch des Genitivs beeinflussen und erklärt, wie soziokulturelle Faktoren den Genitivgebrauch prägen.
Schlüsselwörter
Genitivschwund, Genitivrektion, Kasus, Grammatikalisierung, Sprachwandel, Syntax, Semantik, Korpusanalyse, Konkurrenzkonstruktionen, regionale Variationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Genitivschwund im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Genitivschwund im Deutschen. Sie untersucht die historischen Entwicklungen des Genitivs, analysiert die Ursachen seines Rückgangs und betrachtet konkurrierende grammatische Strukturen sowie regionale Variationen.
Welche Aspekte des Genitivs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Genitiv als Kasus, seine Funktionen im Satz, seine historische Entwicklung, den Funktionswandel, die Ursachen des Genitivschwunds (inklusive konkurrierender Konstruktionen und Ersatzformen), regionale Unterschiede im Genitivgebrauch und die Genitivrektion (die Fähigkeit von Wörtern, den Genitiv zu regieren).
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Ansätze mit empirischen Methoden. Es werden Korpusanalysen durchgeführt, um den aktuellen Genitivgebrauch zu untersuchen, und die Ergebnisse werden mit bestehenden Theorien zum Sprachwandel verglichen.
Welche konkreten Ursachen für den Genitivschwund werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Faktoren, die zum Rückgang des Genitivs beitragen. Dazu gehören konkurrierende Konstruktionen (z.B. der Ersatz durch den Akkusativ oder präpositionale Wendungen), Vereinfachungen der Syntax, regionale Variationen, Grammatikalisierungsprozesse, Prestige und soziokulturelle Einflüsse.
Wie wird der Genitivschwund in verschiedenen syntaktischen Kontexten betrachtet?
Der Genitivschwund wird in verschiedenen syntaktischen Kontexten untersucht, beispielsweise im Bereich der Adjektive, Adverbien und Präpositionen, um die Komplexität des Phänomens zu beleuchten.
Welche Rolle spielen regionale Variationen?
Regionale Unterschiede im Genitivgebrauch werden explizit untersucht und als ein wichtiger Faktor für den Genitivschwund betrachtet.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Forschungsmethodik), Der Genitiv als Kasus (Definition und Funktion), Historische Entwicklung (Entwicklung des Genitivs im Laufe der Zeit), Genitivschwund: Ursachen und Entwicklung (Analyse der Ursachen und des Verlaufs des Schwunds), Genitivrektion: Ursachen und Entwicklung (Analyse der Faktoren, die die Genitivrektion beeinflussen), und Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genitivschwund, Genitivrektion, Kasus, Grammatikalisierung, Sprachwandel, Syntax, Semantik, Korpusanalyse, Konkurrenzkonstruktionen, regionale Variationen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit dem Thema des Genitivschwunds im Deutschen auseinandersetzen möchten. Der Fokus liegt auf einer akademischen und strukturierten Analyse des Phänomens.
- Citar trabajo
- Claudine Massard (Autor), 2015, Vergessen wir des Genitivs?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301946