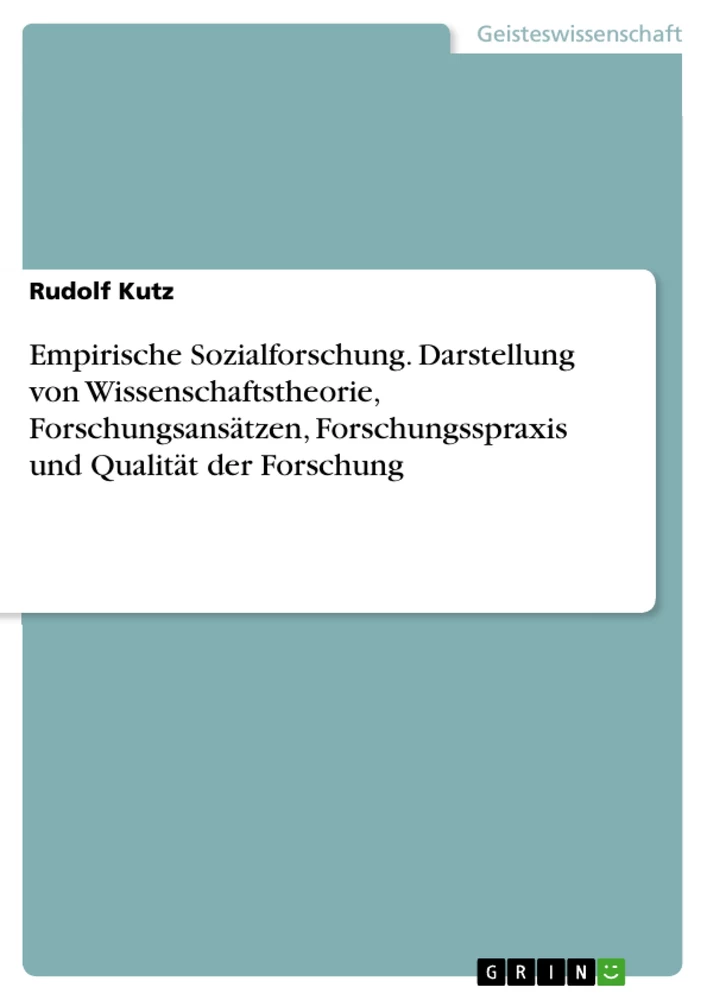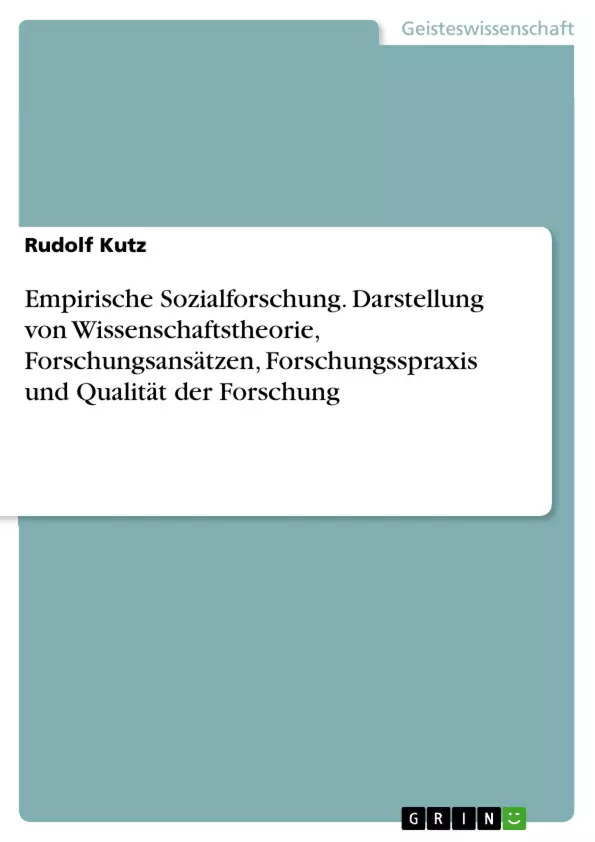Wissenschaftstheorie kann als Metatheorie des kulturspezifischen wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses bezeichnet werden. Sie beschäftigt sich primär mit den begrifflichen und methodischen Grundannahmen und Regeln, nach denen Wissenschaft und Ergebnisse der Wissenschaft als allgemeingültig anerkannt werden. Wissenschaftstheorie ist anders ausgedrückt ein Problem unterschiedlicher Vorgehensweisen zur Erkenntnisgewinnung. Die Naturwissenschaften arbeiten nach anderen Regeln als die Psychologie oder die Soziologie, die Philosophie oder die Jurisprudenz.
In diesem Fachbuch geht es nicht nur um die Systematik der empirischen Sozialforschung, sondern vielmehr um die wissenschaftstheoretischen Grundlagen, die Probleme und die Qualität der Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Überblick
- Kapitel 1: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung
- 1.1 Naive Empirie
- 1.2 Der kritische Rationalismus
- 1.3 Der Konstruktivismus
- Kapitel 2: Die hermeneutische Tradition
- 2.1 Die Dialektik
- 2.2 Verstehende Sozialwissenschaften
- Kapitel 3: Theoriebildung in der quantitativen Forschung
- 3.1 Die Anomietheorie (Merton)
- 3.2 Hypothesenbildung, Variablen und Operationalisierung
- Kapitel 4: Methoden der Datenerhebung und -auswertung
- 4.1 Quantitative Forschung
- 4.2 Qualitative Forschung
- Kapitel 5: Handlungslogiken von Forschungsansätzen
- 5.1 Anwendungsorientierte Forschung
- 5.2 Theorieorientierte Forschung
- 5.3 Evaluationsforschung
- 5.4 Projektmanagement
- 5.5 Case-Management
- 5.6 Marketingforschung
- Kapitel 6: Qualität der Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „Empirische Sozialforschung“ von Rudolf Kutz analysiert die wissenschaftstheoretischen Grundlagen und methodischen Ansätze der empirischen Sozialforschung. Es zeichnet die historischen Entwicklungen der beiden Hauptströmungen der Sozialforschung - der quantitativen und der qualitativen Forschung - nach und beleuchtet die jeweilige Wissenschaftsphilosophie, die zugrundeliegenden Methoden sowie deren Stärken und Schwächen.
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen der quantitativen und qualitativen Forschung
- Historische Entwicklung der empirischen Sozialforschung
- Methoden der Datenerhebung und -auswertung in der quantitativen und qualitativen Forschung
- Anwendungsorientierte und theoretische Forschungsansätze
- Qualität der Forschung und kritische Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die verschiedenen Auffassungen von Wissenschaft und Erkenntnis in der Geschichte, vom naiven Empirismus über den kritischen Rationalismus bis hin zum Konstruktivismus. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Geschichte der hermeneutischen Tradition, beginnend mit der Dialektik und endend bei den verstehenden Sozialwissenschaften. Kapitel 3 stellt die Theoriebildung in der quantitativen Forschung am Beispiel der Anomietheorie von Merton dar und erläutert die Bedeutung von Hypothesenbildung, Variablen und Operationalisierung. Kapitel 4 behandelt die Datenerhebungs- und Auswertungsmethodik der quantitativen und qualitativen Forschung, um Grundlagen für den sinnvollen Einsatz von Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu liefern. Kapitel 5 widmet sich den Handlungslogiken von Forschungsansätzen und differenziert zwischen anwendungsorientierter und theoretischer Forschung. Es werden außerdem die spezifischen Aspekte der Evaluationsforschung, des Projektmanagements, des Case-Managements und der Marketingforschung behandelt.
Schlüsselwörter
Empirische Sozialforschung, Wissenschaftstheorie, Quantitative Forschung, Qualitative Forschung, Hermeneutik, Methoden, Datenerhebung, Auswertung, Theoriebildung, Anwendungsorientierte Forschung, Theorieorientierte Forschung, Evaluationsforschung, Projektmanagement, Case-Management, Marketingforschung, Qualität der Forschung, Kritische Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Forschung?
Quantitative Forschung nutzt standardisierte Daten und Hypothesenprüfung, während qualitative Forschung auf das Verstehen von Zusammenhängen und hermeneutische Traditionen setzt.
Was versteht man unter Wissenschaftstheorie?
Sie ist eine Metatheorie, die sich mit den Regeln und Grundannahmen beschäftigt, nach denen wissenschaftliche Erkenntnisse als allgemeingültig anerkannt werden.
Was ist der "Kritische Rationalismus"?
Ein wissenschaftstheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass Theorien nie endgültig bewiesen, sondern nur widerlegt (falsifiziert) werden können.
Welche Rolle spielt die Anomietheorie von Merton?
Sie dient im Buch als Beispiel für die Theoriebildung in der quantitativen Forschung, insbesondere zur Erläuterung von Variablen und Operationalisierung.
In welchen Bereichen wird empirische Sozialforschung angewendet?
Die Anwendungsfelder reichen von der Evaluationsforschung und dem Projektmanagement bis hin zur Marketingforschung und dem Case-Management.
Was bedeutet "Hermeneutik" in der Sozialforschung?
Hermeneutik bezeichnet die Kunst der Interpretation und des Verstehens von Texten oder sozialen Handlungen, oft im Gegensatz zum rein erklärenden Ansatz.
- Quote paper
- Dr. phil. Rudolf Kutz (Author), 2015, Empirische Sozialforschung. Darstellung von Wissenschaftstheorie, Forschungsansätzen, Forschungsspraxis und Qualität der Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301992