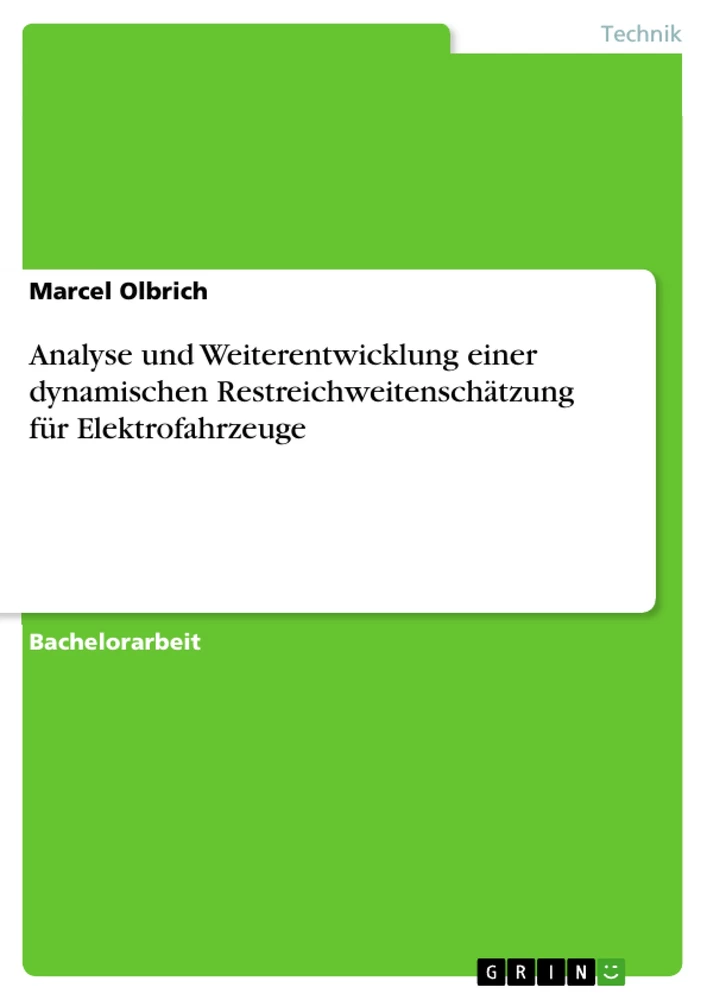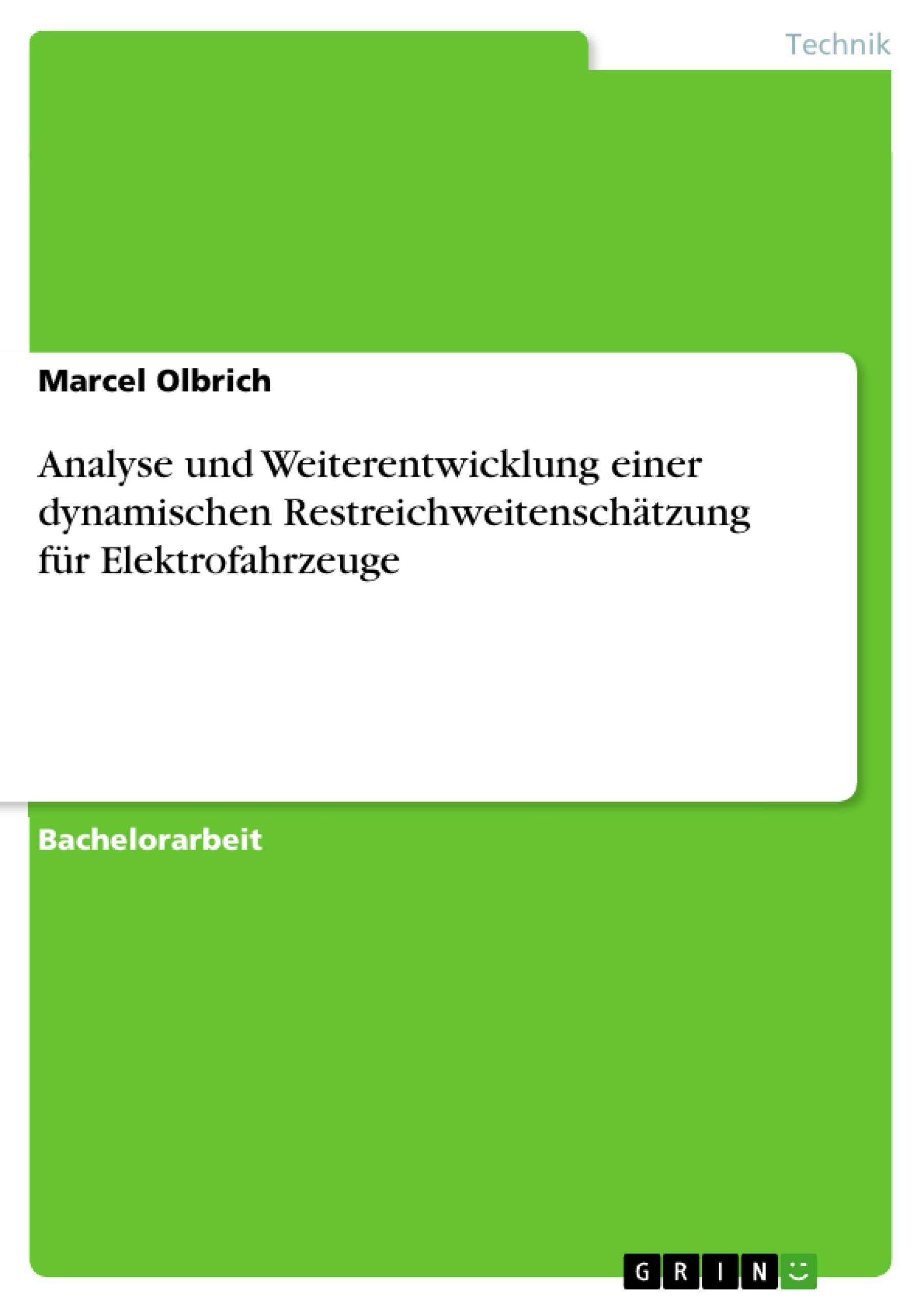Die Zahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge in Deutschland steigt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Reichweiten von Elektrofahrzeugen in Bezug auf Verbrennungsmotoren bedarf es in einem Elektroauto einer zuverlässigen Angabe der Restreichweite. Eine besondere Problematik obliegt dabei dem Zwiespalt zwischen der Dynamik und dem Komfort eines solchen Systems.
Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verschiedene Fahrzeugtypen, welche sich vor allem durch ihre Leistung und den jeweils verbauten Batterietyp unterscheiden, objektorientiert implementiert. Zudem wird ein bestehendes Modell zur Restreichweitenschätzung analysiert und weiterentwickelt. Durch abschließende Simulationen unter variierenden Parametersätzen werden Aussagen über die Echtzeittauglichkeit der Restreichweitenschätzung getätigt, sowie Unterschiede zwischen beiden Modellen dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Formelzeichen
- Einleitung
- Grundlagen
- Entwicklungsmethode zur Modellierung der Elektrofahrzeuge
- Physikalische Grundlagen
- Beschleunigungswiderstand
- Rollreibungswiderstand
- Steigungswiderstand
- Aerodynamischer Widerstand
- Versuchsfahrzeuge
- E-Polo
- Nissan Leaf
- Batteriemodelle
- Innenwiderstandsmodell (ZEBRA Batterie)
- RC-Modell (Li-Ionen Akkumulator)
- Programmiertechnische Grundlagen
- Einführung in die Entwicklungsumgebung Matlab
- Objektorientierte Programmierung
- Vorteile und Nachteile der objektorientierten Programmierung
- Implementierung des Fahrzeugmodells
- Klassenstruktur
- Implementierung der Fahrzeugkomponenten
- Kräftebilanz
- Drehmomentwandlung
- Motorblock
- Implementierung der Batteriemodelle
- ZEBRA - Batterie
- Li-Ionen Akkumulator
- Vorstellung der Restreichweitenschätzung
- Simulationen und Verifikation des Fahrzeugmodells
- Simulation verschiedener Streckenprofile
- Artemis Fahrzyklus
- Teststrecke Köln - Dortmund
- Teststrecke Köln - Dortmund mit Steigungsprofil
- Auswirkungen der Rekuperation
- Artemis Fahrzyklus
- Teststrecke Köln - Dortmund
- Restreichweitenschätzung anhand der Teststrecke Köln - Dortmund
- Gegenüberstellung der Ergebnisse
- E-Polo
- Nissan Leaf
- Restreichweitenschätzung
- Programmierung und Simulink
- Simulation verschiedener Streckenprofile
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Analyse und Weiterentwicklung einer dynamischen Restreichweitenschätzung für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, ein präzises und zuverlässiges System zu entwickeln, das die verbleibende Reichweite eines Elektrofahrzeugs in Echtzeit berechnet und dem Fahrer anzeigt.
- Modellierung und Simulation von Elektrofahrzeugen
- Analyse und Optimierung von Batteriemodellen
- Entwicklung und Implementierung einer Restreichweitenschätzung
- Bewertung der Echtzeittauglichkeit des entwickelten Systems
- Untersuchung der Auswirkungen von verschiedenen Streckenprofilen und Fahrverhalten auf die Restreichweite
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Elektrofahrzeugmodellierung und die relevanten physikalischen Prinzipien erläutert. Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Implementierung des Fahrzeugmodells und der Batteriemodelle. In Kapitel drei werden Simulationen verschiedener Streckenprofile durchgeführt und die Ergebnisse der Restreichweitenschätzung analysiert. Kapitel vier fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen. Das fünfte Kapitel enthält das Literaturverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis und den Anhang.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Elektrofahrzeuge, Restreichweitenschätzung, Batteriemodelle, Simulation, Echtzeitfähigkeit, Streckenprofile, Fahrverhalten, objektorientierte Programmierung, Matlab, Simulink.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Restreichweitenschätzung bei Elektroautos so wichtig?
Da Elektrofahrzeuge oft geringere Reichweiten als Verbrenner haben, benötigt der Fahrer eine präzise Angabe, um "Reichweitenangst" zu vermeiden und Fahrten sicher zu planen.
Welche Batteriemodelle werden in der Arbeit untersucht?
Es werden ein Innenwiderstandsmodell für ZEBRA-Batterien und ein RC-Modell für Lithium-Ionen-Akkumulatoren implementiert und verglichen.
Welchen Einfluss hat die Rekuperation auf die Reichweite?
Durch die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen kann die Reichweite erhöht werden; die Arbeit simuliert diesen Effekt in verschiedenen Fahrzyklen.
Wie wird das Fahrzeugmodell technisch realisiert?
Die Implementierung erfolgt objektorientiert in der Entwicklungsumgebung MATLAB und Simulink, wobei physikalische Widerstände wie Roll- und Luftwiderstand einfließen.
Was bedeutet Echtzeittauglichkeit in diesem Zusammenhang?
Echtzeittauglichkeit bedeutet, dass das System die Restreichweite während der Fahrt ohne spürbare Verzögerung berechnen und aktualisieren kann.
- Citation du texte
- Marcel Olbrich (Auteur), 2015, Analyse und Weiterentwicklung einer dynamischen Restreichweitenschätzung für Elektrofahrzeuge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302409