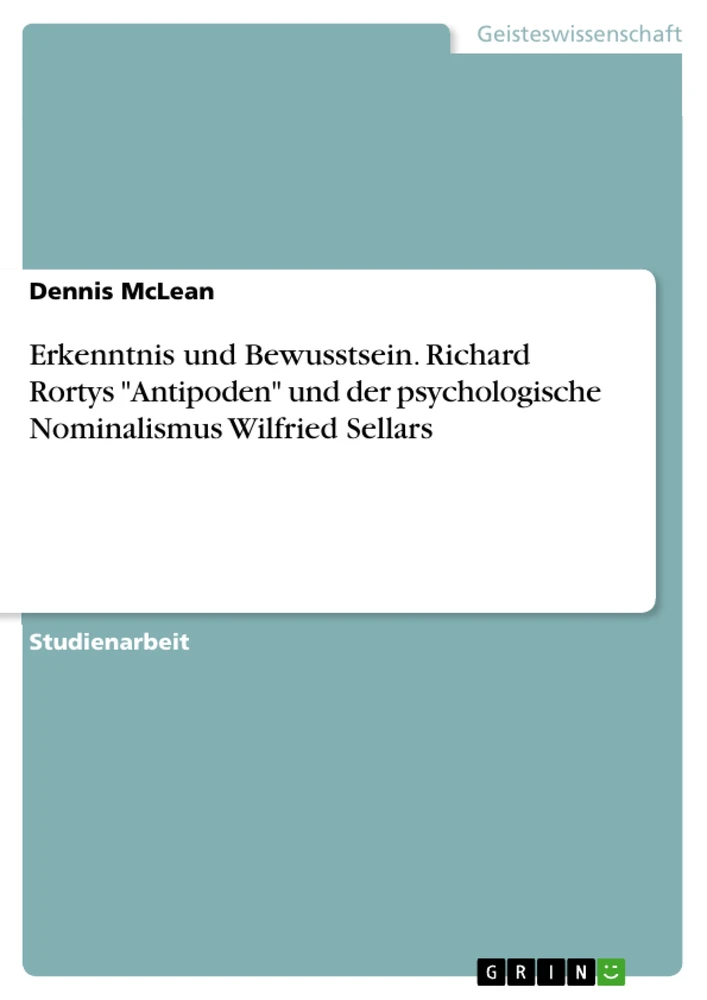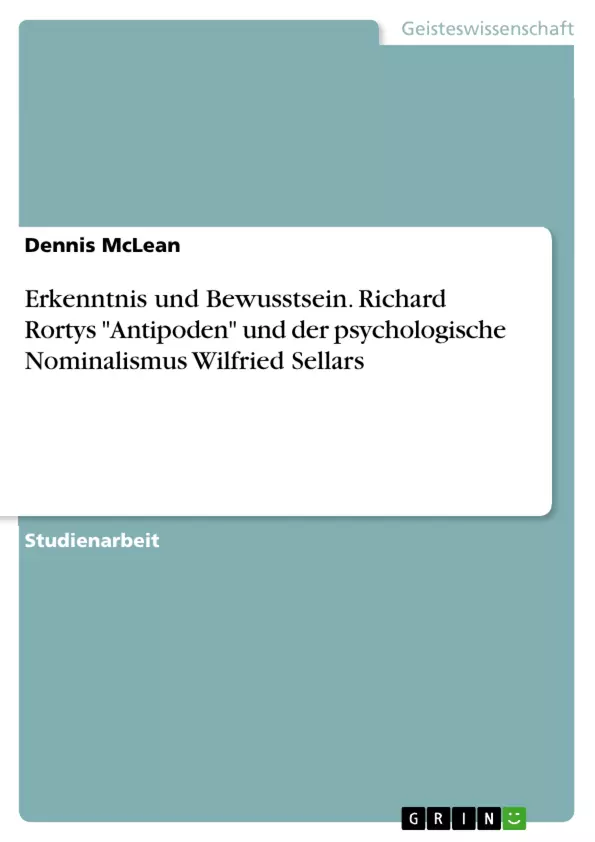Wie ist Erkenntnis möglich, wie entsteht sie und wann ist das, was wir als Wissen bezeichnen, überhaupt richtig? Die Frage, die sich stellt ist, ob die Welt, so wie sie ist, für uns überhaupt erfahrbar ist. Mit anderen Worten: Gibt es eine Art Wirklichkeit jenseits dessen, was wir mit unseren Sinnen erfassen können und ist es uns möglich, Zugang zu dieser Wirklichkeit zu finden? Oder ist das, was oft auch einfach als ‚physikalische Welt‘ bezeichnet wird, die einzige Wirklichkeit die es gibt?
In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Plausibilität von Wissen berechtigt, denn wenn das, was wir sehen, unabhängig davon ist, wie die Welt wirklich ist, wie können wir dann überhaupt etwas wissen?
Mit Kant soll die klassische Ansicht dieses Problems verdeutlicht werden, bevor mit Richard Rorty und seinem Gedankenexperiment der ‚Antipoden‘ ein etwas modernerer Lösungsansatz der Erkenntnisproblematik vorgestellt wird. In diesem Zusammenhang wird sich zeigen, dass Wissen in erster Linie abhängig von Sprache ist. Um dies zu untermauern, wird Wilfried Sellars psychologischer Nominalismus dienen, der sich sowohl an Rortys Idee der Hermeneutik als auch stark an Sellars ‚Mythos des Gegebenen‘ hält. Rorty überlässt die Frage „Was sind Gedanken?“ der Hermeneutik und verabschiedet eine philosophische Erkenntnistheorie, während Sellars versucht, auch dieses Problem zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ERKENNTNIS
- KLASSISCHE ANSICHT
- DIE ANTIPODEN
- RORTY UND DIE HERMENEUTIK
- SELLARS PSYCHOLOGISCHER NOMINALISMUS
- DAS MARY-GEDANKENEXPERIMENT
- GEDANKEN UND, UNMITTELBARE ERFAHRUNG'
- SELLARS, MYTH OF JONES'
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Frage der Erkenntnis und dem Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Bewusstsein. Der Schwerpunkt liegt auf den Ansätzen von Richard Rorty und Wilfrid Sellars und deren Kritik an der klassischen Sichtweise der Erkenntnis.
- Die Grenzen der klassischen Erkenntnistheorie
- Rortys Hermeneutik und die Rolle der Sprache bei der Erkenntnis
- Sellars psychologischer Nominalismus und die Frage der mentalen Zustände
- Das Gedankenexperiment der „Antipoden“ und seine Bedeutung für die Erkenntnis
- Die Rolle des Gehirns und die Frage nach dem Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach Erkenntnis und deren Bedeutung in der Philosophie vor. Es werden verschiedene Ansätze zur Erklärung von Erkenntnis erwähnt, und es wird deutlich, dass die Frage nach dem Wesen von Gedanken und ihrer Erfahrbarkeit im Mittelpunkt steht.
- Erkenntnis: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Erklärung von Erkenntnis. Die klassische Ansicht nach Kant wird vorgestellt, bevor Rortys "Antipoden"-Gedankenexperiment und Sellars psychologischer Nominalismus als moderne Lösungsansätze eingeführt werden. Es wird deutlich, dass die Frage der Sprache und ihrer Bedeutung für die Erkenntnis eine zentrale Rolle spielt.
- Gedanken und, unmittelbare Erfahrung': Das Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem Wesen von Gedanken und ihrer Verbindung zur Erfahrung. Es wird die Schwierigkeit, Gedanken zu beobachten und zu beschreiben, hervorgehoben. Die subjektive Natur von Gedanken und die Notwendigkeit, einen Konsens darüber zu finden, wie sie sich für den Einzelnen anfühlen, werden beleuchtet.
- Sellars, Mythos von Jones': Dieses Kapitel untersucht Sellars' "Mythos von Jones" und die Frage der phylogenetischen Entstehung von Gedanken. Es wird das Konzept der Gedanken als „innere Episoden“ vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieses Textes sind: Erkenntnis, Bewusstsein, Hermeneutik, psychologischer Nominalismus, „Antipoden“, Gedankenexperiment, Sprache, Gehirn, Intentionalität, phänomenales Bewusstsein, mentale Zustände, „Mythos von Jones“, Phylogenese, innere Episode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gedankenexperiment der „Antipoden“ von Richard Rorty?
Rorty nutzt dieses Experiment, um eine moderne Sicht auf die Erkenntnisproblematik darzustellen und zu zeigen, dass Wissen primär von Sprache abhängig ist.
Was versteht Wilfrid Sellars unter dem „psychologischen Nominalismus“?
Dieser Ansatz besagt, dass alles Wissen über psychologische Zustände und Gedanken sprachlich vermittelt ist und es kein „reines“ Gegebenes ohne Sprache gibt.
Wie unterscheidet sich Rortys Hermeneutik von klassischer Erkenntnistheorie?
Rorty verabschiedet die klassische Erkenntnistheorie und überlässt die Frage „Was sind Gedanken?“ der Hermeneutik, also der Interpretation von Sprache.
Was ist der „Mythos des Gegebenen“?
Es ist die Kritik von Sellars an der Vorstellung, dass es Wissen gibt, das uns unmittelbar durch die Sinne gegeben ist, ohne dass wir es begrifflich einordnen müssen.
Worum geht es in Sellars' „Mythos von Jones“?
Sellars diskutiert darin die Entstehung von Gedanken als „innere Episoden“ und wie wir lernen, über unsere inneren Zustände zu sprechen.
- Citation du texte
- Dennis McLean (Auteur), 2012, Erkenntnis und Bewusstsein. Richard Rortys "Antipoden" und der psychologische Nominalismus Wilfried Sellars, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302555