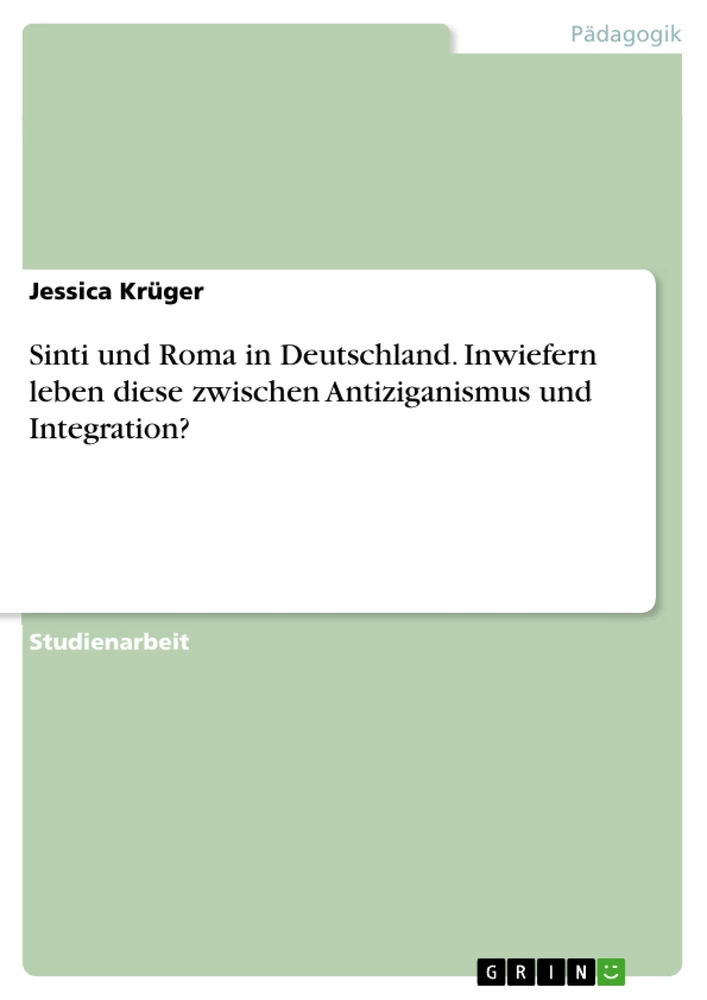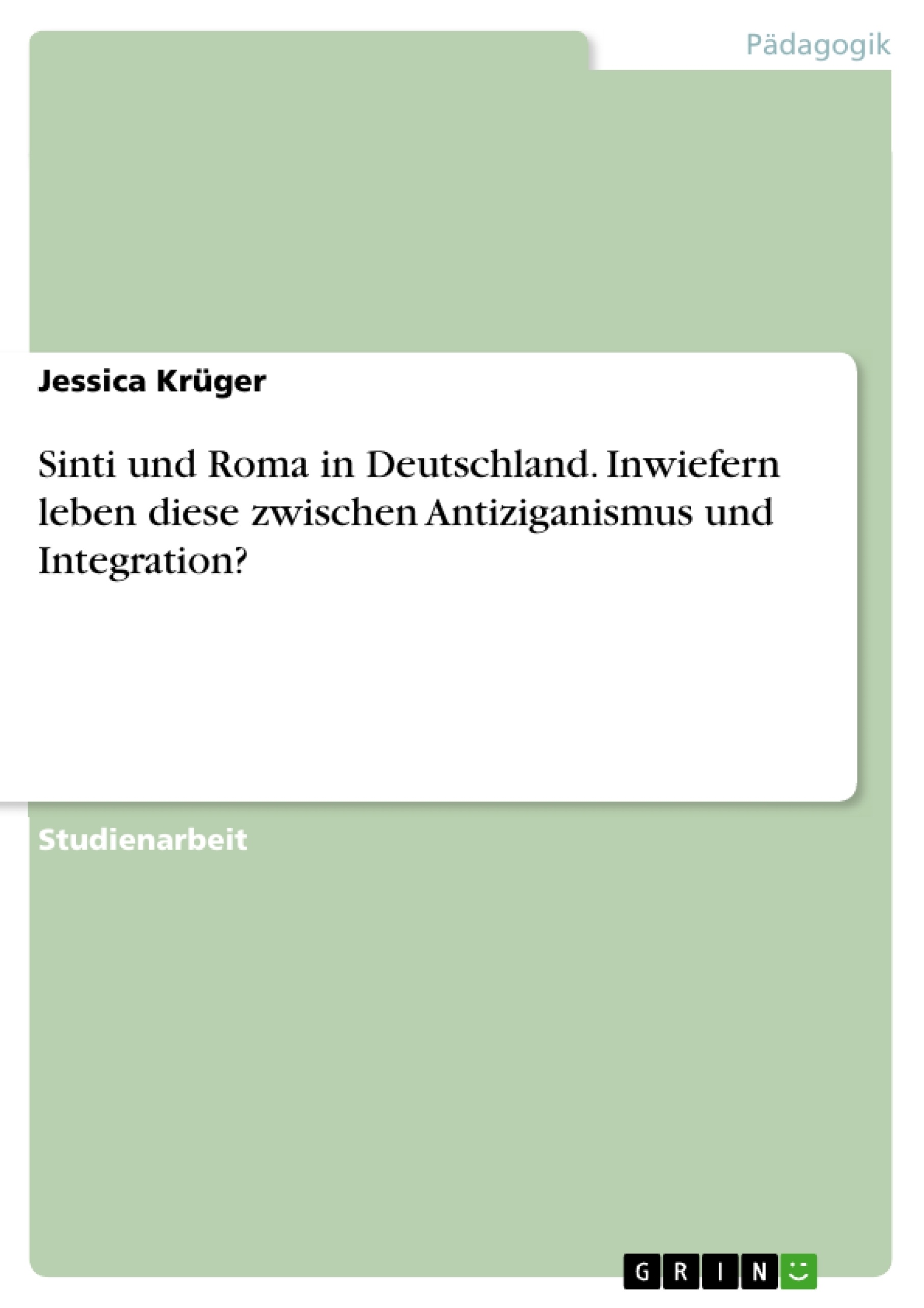Die Zuwanderung von Migranten ist aktuell eines der politischen und sozial meist diskutierten Themen in ganz Europa. Leider wird dieses Thema gerade in Deutschland u.a. durch einseitige, mediale Berichterstattung immer wieder ins schlechte Licht gerückt. Mit Migranten assoziieren die meisten lediglich Lärm, Müll und Kriminalität.
Ähnlich verhält es sich mit dem Thema über die nationalen Minderheiten in Deutschland, zu denen die deutschen Sinti und Roma zählen. Viele Deutsche verwenden die Bezeichnung „Zigeuner“ – ein Begriff, der eine negative Konnotation aufweist und von 93,1 % der deutschen Sinti und Roma als diskriminierend empfunden wird. Mit „Zigeunern“ verbinden die meisten Deutschen Eigenschaften wie: „Nicht sesshaft“, „unhygienisch“, „unmoralisch“, „diebisch“, etc.
Bis 1997 gab es in der Rechtsgrundlage keinen speziellen Schutz für nationale Minderheiten. Mittlerweile dienen das Rahmenübereinkommen, die Charta und insbesondere das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dem Schutz nationaler Minderheiten.
Doch welchen Einfluss hat die rechtliche Entwicklung auf die Lebenssituation der deutschen Sinti und Roma tatsächlich eingenommen?
In der nachfolgenden Arbeit soll untersucht werden, wie deutsche Sinti und Roma den Alltag in Deutschland erleben; werden sie von der Mehrheitsbevölkerung diskriminiert und ausgeschlossen oder in den deutschen Sozialstaat integriert und akzeptiert?
Es geht hierbei nicht nur um die Alltagssituation und das soziale Miteinander zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen, sondern insbesondere auch die Wohn-, Bildungs- und Arbeitsmarktsituation soll untersucht werden.
Die heutige Lebenssituation eines deutschen Sinti und Roma steht somit im Fokus dieser Arbeit, um die Frage: „Inwiefern lebt ein deutscher Sinti oder Roma zwischen Antiziganismus und Integration?“ beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Allgemeines
- Sinti und Roma
- Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
- Rechtliche Grundlagen der Sinti und Roma
- Charta der Grundrechte
- Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
- Deutsches Grundgesetz
- Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Bundeswahlgesetz (BWG)
- Resümee
- Aktuelle Lebenssituation
- Alltag
- Wohnen
- Bildung
- Beschäftigung/Arbeitsmarkt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Interview mit dem Landesverbandsvorsitzenden in Bayern
- E-Mail vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma e. V. NRW
- Beitrag für BIKUP-Dokumentation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie deutsche Sinti und Roma zwischen Antiziganismus und Integration leben. Sie untersucht die aktuelle Lebenssituation dieser Volksgruppe in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf Alltag, Wohnen, Bildung und Arbeitsmarkt. Die Arbeit analysiert, inwiefern die rechtliche Entwicklung den Schutz nationaler Minderheiten verbessert hat und welchen Einfluss dies auf die Lebensrealität von Sinti und Roma hat.
- Die Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland und die Herausforderungen der Diskriminierung und Verfolgung
- Die rechtlichen Grundlagen des Schutzes nationaler Minderheiten in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation der Sinti und Roma
- Die aktuelle Lebenssituation von Sinti und Roma in Deutschland, einschließlich ihrer Erfahrungen im Alltag, im Wohnbereich, in der Bildung und im Arbeitsmarkt
- Die Rolle von Antiziganismus und Integration in der Lebensrealität der Sinti und Roma
- Die Bedeutung von interkulturellem Verständnis und Dialog für die Förderung von Inklusion und Akzeptanz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Antiziganismus und Integration in Deutschland dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Der Hauptteil beleuchtet zunächst die Geschichte und Kultur der Sinti und Roma, bevor er sich mit den rechtlichen Grundlagen des Schutzes nationaler Minderheiten und ihrer konkreten Anwendung in der Praxis auseinandersetzt. Anschließend wird die aktuelle Lebenssituation von Sinti und Roma in Deutschland mit Fokus auf Alltag, Wohnen, Bildung und Arbeitsmarkt analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwiefern die rechtliche Entwicklung die Lebensrealität der Sinti und Roma verbessert hat und welche Herausforderungen und Chancen sich im Bereich von Antiziganismus und Integration ergeben.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation von Sinti und Roma in Deutschland. Der Anhang enthält ergänzendes Material, wie zum Beispiel ein Interview mit dem Landesverbandsvorsitzenden in Bayern und eine E-Mail vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma e. V. NRW.
Schlüsselwörter
Sinti und Roma, Antiziganismus, Integration, Diskriminierung, nationale Minderheiten, rechtliche Grundlagen, Charta der Grundrechte, Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, Deutsches Grundgesetz, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Bundeswahlgesetz (BWG), Alltag, Wohnen, Bildung, Beschäftigung, Arbeitsmarkt, interkulturelles Verständnis, Dialog, Inklusion, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Antiziganismus?
Es ist eine spezifische Form des Rassismus, die sich gegen Sinti und Roma richtet und oft mit diskriminierenden Stereotypen wie „unhygienisch“ oder „diebisch“ einhergeht.
Welche rechtlichen Grundlagen schützen Sinti und Roma in Deutschland?
Wichtige Gesetze sind das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Grundgesetz und das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten.
Wie erleben Sinti und Roma ihren Alltag in Deutschland?
Viele Betroffene berichten von Diskriminierung im Wohnungsmarkt, im Bildungssystem und bei der Arbeitssuche, trotz rechtlicher Fortschritte.
Was ist der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma?
Die zentrale Interessenvertretung der Sinti und Roma in Deutschland, die sich für deren politische Anerkennung und gegen Diskriminierung einsetzt.
Warum wird der Begriff „Zigeuner“ als diskriminierend empfunden?
Über 93 % der Sinti und Roma lehnen den Begriff ab, da er historisch belastet ist und negative Vorurteile transportiert.
- Quote paper
- Jessica Krüger (Author), 2014, Sinti und Roma in Deutschland. Inwiefern leben diese zwischen Antiziganismus und Integration?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302678