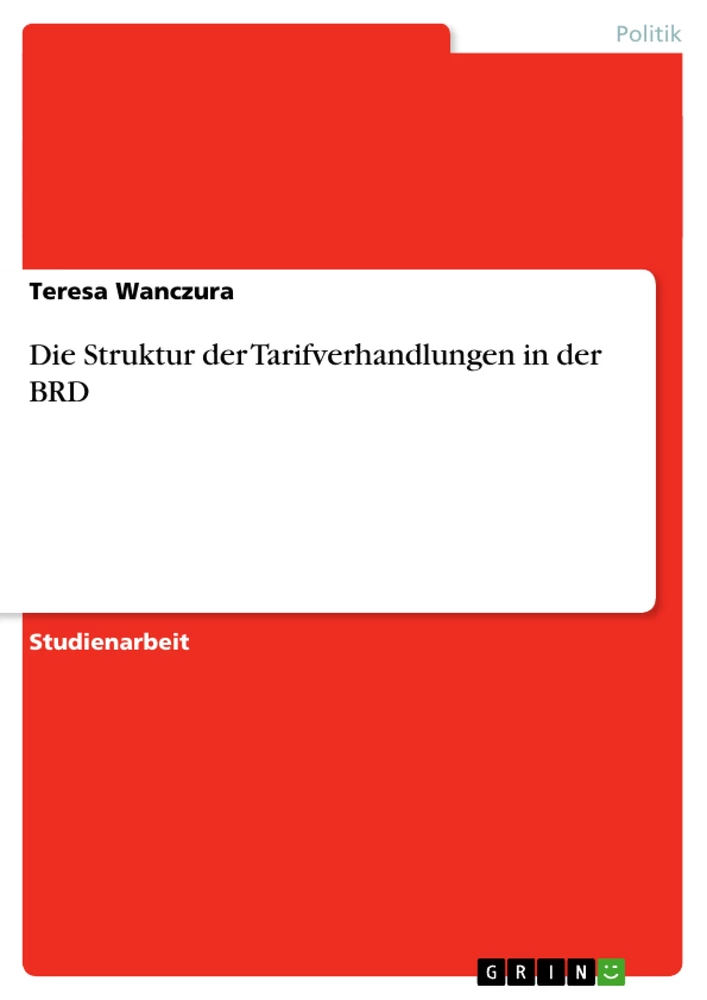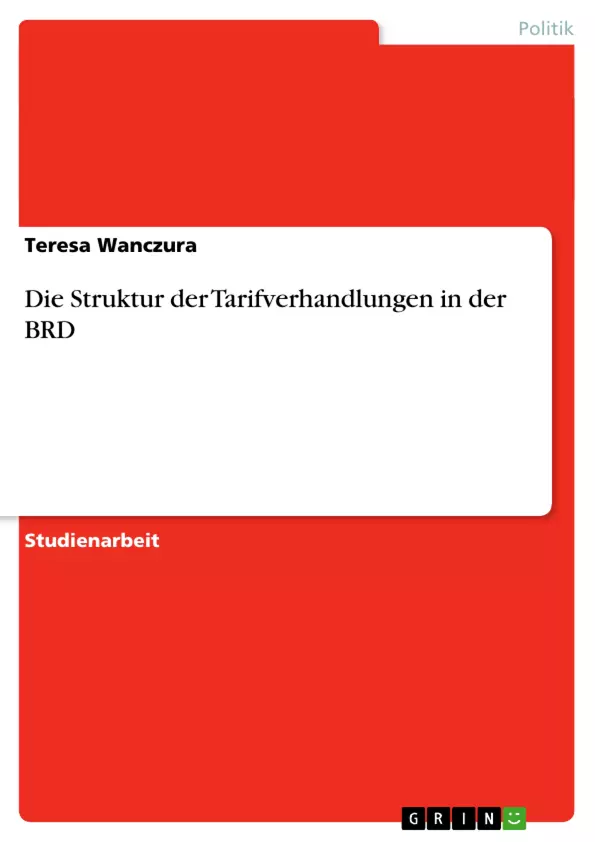Im Tarifpolitischen Jahresbericht von 1997 werden Tarifabschlüsse für über 17 Millionen Beschäftigte in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnet. Die Voraussetzungen für Abschlüsse dieser Art sind langwierige und oft komplizierte Tarifverhandlungen, die sich über das ganze Jahr hinweg verteilen können. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gefüge der Tarifverhandlungen und ihrer Verankerung im politischen Staat Deutschland. Hierzu gehören die gesetzlichen Grundlagen und die tarifliche Bestimmungen einerseits aber auch das Rollenverständnis der Tarifparteien und des Staates im Konflikfeld zwischen „Arbeit versus Kapital“ andererseits. Interessant erscheint es, darüber hinaus die industriellen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland in ihrer tarifpolitischen Prägung einzubinden, insofern sie Tarifverhandlungen beeinflussen bzw tangieren. Vor allen Dingen ist es wichtig, die Entwicklungen seit der Wende von 1989 und der wirtschaftlichen Rezession 1992 in Bezug auf das Tarifsystem zu beobachten.
Die Komplexität des Themas erfordert es, Eingrenzungen vorzunehmen. Sinnvoll erscheint es, den Ablauf oder die Kündigung des bestehenden Tarifvertrag als Ausgangspunkt der Verhandlungen zu nehmen und mit dem erfolgreichen Abschluß, d. h. einem neuen Tarifvertrag zu enden. Daß Tarifpolitik darüber hinaus das ganze Jahr über gesteuert wird und in einem Prozeß vonTarifbewegungen über unterschiedliche Tarifphasen hinweg beurteilt werden muß, kann hier nicht berücksichtigt werden. Angebracht erscheint es auch, den Arbeitskampf als Mittel zur Durchsetzung der Lohninteressen über die Tarifverhandlungen im Sinne einer friedlichen Regelung hinaus, hier nicht näher zu erörtern. Die Tarifpolitik der Bundesrepublik Deutschland ist auf konfliktvermeidende Lösungen ausgerichtet und hat als Ergebnis die wenigsten Streiktage jährlich innerhalb der Industriestaaten zu verzeichnen. Der Arbeitskampf verdient es, in einem historischen Kontext betrachtet zu werden, vorliegende Arbeit wird unter strukturellen Aspekten untersucht. Ein weiteres Thema für sich bilden die zahlreichen Tarifabschlüsse, die seit Bestehen der BRD je nach wirtschaftlicher Lage unterschiedliche Konturen erhielten. Hier bietet sich an, statistische Angaben in vollem Umfang zu nutzen und Vergleiche zu ziehen. Dies würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen im Interessenausgleich „Wirtschaft und Arbeit“ in der BRD
- Die Tarifautonomie
- Das Tarifvertragsgesetz
- Mitbestimmung in der Privatwirtschaft
- Die Bildung von Interessenverbänden - der „Dritte Sektor“ zwischen Staat und Markt
- Strukturprägende Faktoren der Tarifverhandlungen in der BRD
- Parteien eines Tarifvertrags
- Tarifverhandlungsebenen
- Schlichtung als erweiterndes Element der Tarifverhandlungen
- Strukturprägende Faktoren der Tarifverhandlungen in der BRD
- Das „duale System“ der Interessenvertretung
- Auswirkungen der Deregulierung auf die Tarifverhandlungen
- Dezentralisierung und Differenzierung des tariflichen Standards
- Bargaining und Konfliktlösungen in der BRD - Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Struktur der Tarifverhandlungen in der Bundesrepublik Deutschland, indem sie die gesetzlichen Grundlagen, die Rolle der Tarifparteien und den Einfluss industrieller Beziehungen auf die Tarifpolitik beleuchtet. Dabei liegt der Fokus auf den Entwicklungen seit 1989 und der wirtschaftlichen Rezession von 1992. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Tarifverhandlungen in der BRD zu zeichnen, ohne dabei auf den Ablauf oder die Kündigung von Tarifverträgen einzugehen.
- Die Rolle der Tarifautonomie und des Tarifvertragsgesetzes
- Die Bedeutung von Interessenverbänden und die Struktur der Tarifparteien
- Die Auswirkungen von Deregulierung und Dezentralisierung auf die Tarifverhandlungen
- Die Bedeutung des "dualen Systems" der Interessenvertretung in Deutschland
- Der Einfluss von industriellen Beziehungen auf die Tarifpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und der Definition des Themenbereichs. Es werden die Zielsetzung, der Umfang und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel analysiert die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, die den Rahmen für die Tarifverhandlungen in Deutschland bilden. Hier wird insbesondere auf die Tarifautonomie, das Tarifvertragsgesetz, die Mitbestimmung in der Privatwirtschaft und die Bildung von Interessenverbänden eingegangen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den strukturprägenden Faktoren der Tarifverhandlungen. Es werden die Parteien eines Tarifvertrags, die Tarifverhandlungsebenen und die Rolle der Schlichtung als erweiterndes Element der Tarifverhandlungen beleuchtet. Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen von Deregulierung und Dezentralisierung auf die Tarifverhandlungen. Es wird der Einfluss des "dualen Systems" der Interessenvertretung in Deutschland auf die Tarifpolitik und die Struktur der Tarifverhandlungen untersucht.
Schlüsselwörter
Tarifverhandlungen, Tarifautonomie, Tarifvertragsgesetz, Interessenverbände, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Mitbestimmung, Deregulierung, Dezentralisierung, industriellen Beziehungen, Bundesrepublik Deutschland, "duales System", Konfliktlösung, Bargaining.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Tarifautonomie" in Deutschland?
Das Recht der Tarifparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände), Arbeitsbedingungen ohne staatliche Einmischung auszuhandeln.
Welche Rolle spielt das Tarifvertragsgesetz?
Es bildet die gesetzliche Grundlage für den Abschluss, die Geltung und die Beendigung von Tarifverträgen in der BRD.
Was ist das "duale System" der Interessenvertretung?
Die parallele Interessenvertretung durch Gewerkschaften auf überbetrieblicher Ebene und Betriebsräte auf betrieblicher Ebene.
Wie beeinflusst die Deregulierung die Tarifverhandlungen?
Deregulierung führt oft zu einer Dezentralisierung und Differenzierung der tariflichen Standards, was das traditionelle Gefüge verändert.
Warum gibt es in Deutschland vergleichsweise wenige Streiktage?
Das deutsche Tarifsystem ist stark auf konfliktvermeidende Lösungen und Schlichtungsverfahren ausgerichtet.
- Quote paper
- Teresa Wanczura (Author), 1998, Die Struktur der Tarifverhandlungen in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30270