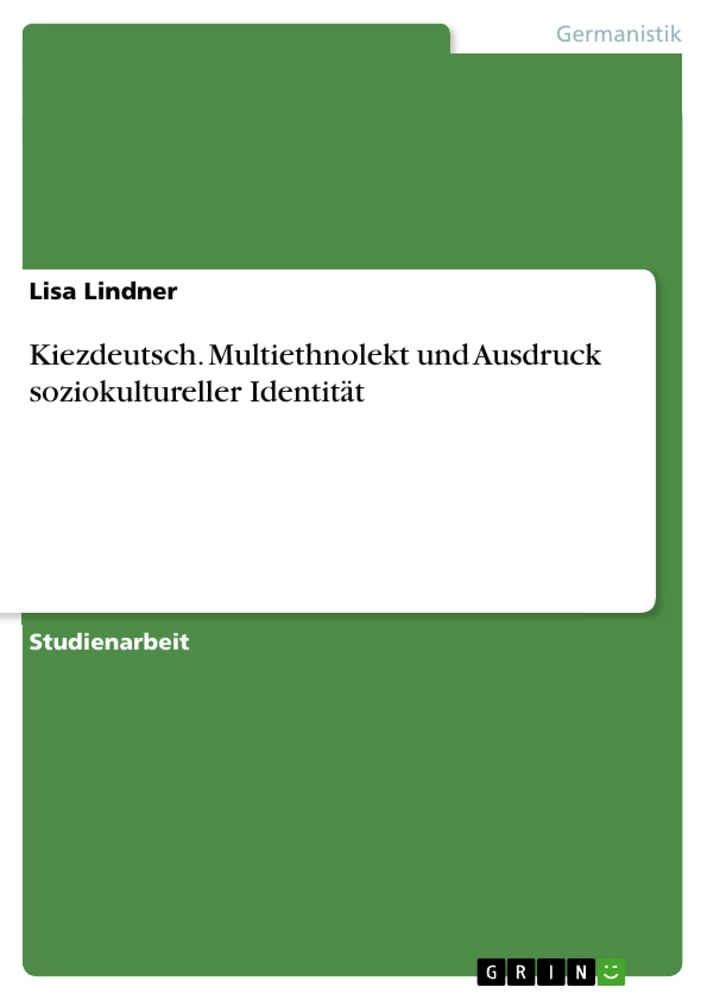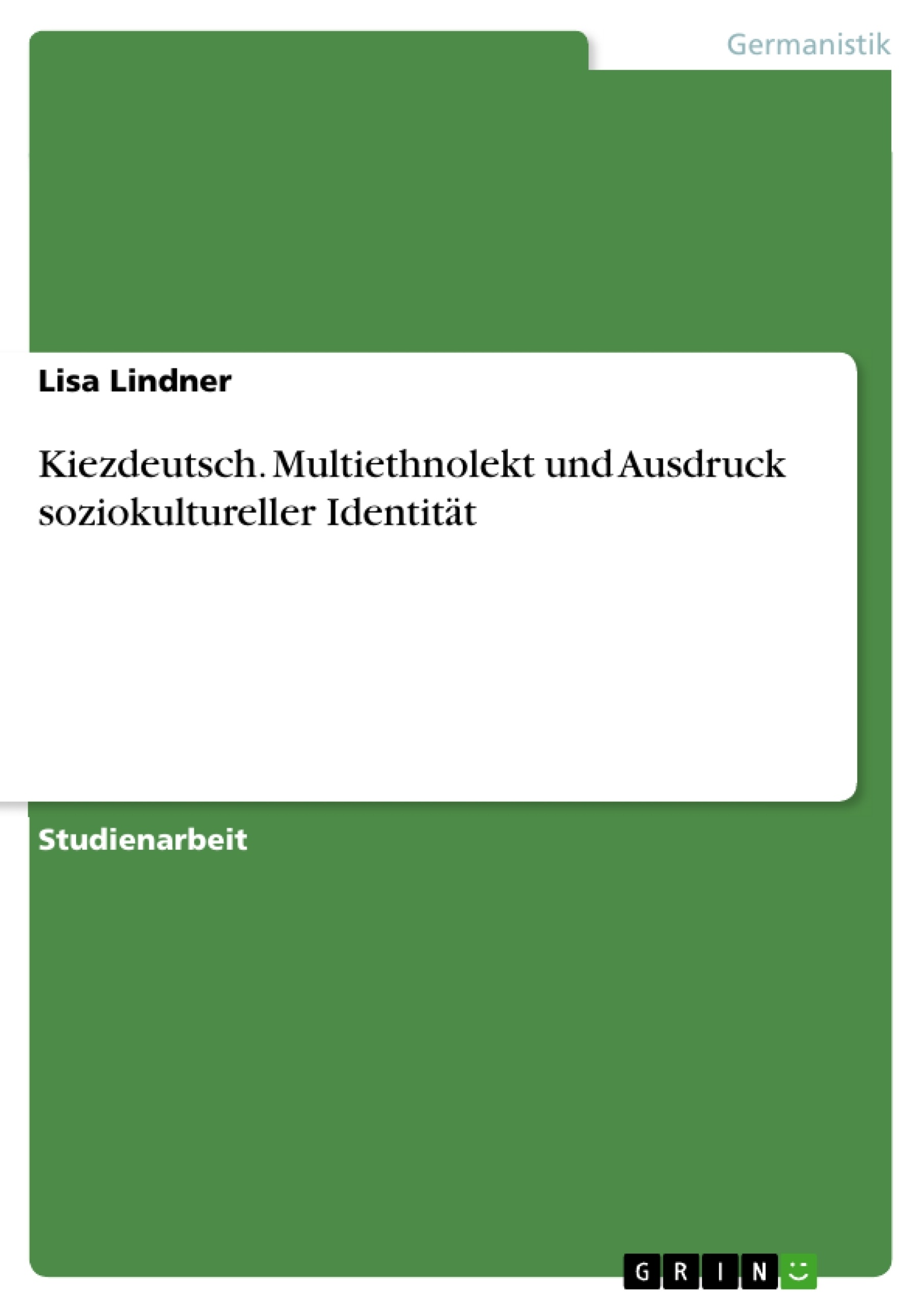Mit der Migrationswelle sogenannter „Gastarbeiter“ aus den Mittelmeerregionen gegen Ende der fünfziger Jahre lies sich ein sprachliches Phänomen beobachten, das sich vor allem in den Großstädten Deutschlands niederschlug. Durch das Aufeinandertreffen verschiedenen Sprachen und Kulturen entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein neuer multilingualer Ethnolekt, der im Allgemeinen auch als „Gastarbeiterdeutsch“, „Türkendeutsch“ oder „Kanak Sprak“ bekannt ist. Da diese gängigen Bezeichnungen in der Regel jedoch inkorrekt oder von negativem Beigeschmack sind, möchte ich auf eben jenes sprachliches Phänomen aufmerksam machen, das fortan unter der Bezeichnung „Kiezdeutsch“ geführt wird.
Die deutsche Sprache und Sprache im Allgemeinen befinden sich in einem steten Wandel, der sich sowohl im Grundwortschatz als auch vor allen Dingen in der grammatischen Struktur widerspiegelt. „Lautstrukturen verändern sich, Wörter ändern ihre Bedeutung, es entwickeln sich neue Endungen, andere entfallen, es entstehen neue Möglichkeiten der Wortstellung und der Kombination von Wörtern und Wortgruppen ebenso wie neue Beschränkungen“ (Wiese, 2012, S.30). Eben diese aufgezählten lautlichen Veränderungen und Variationen garantieren die Dynamik und Lebendigkeit der eigenen Sprache und schaffen Raum für neue Strömungen.
Unter genannten Aspekten habe ich mich im Folgenden einer sehr jungen Tendenz sprachlicher Neuerungen genähert, einem Trend, der sich in erster Linie in der Jugendsprache niederschlägt. In meiner Arbeit möchte ich mich unter anderem gegen eine weitverbreitete Meinung stellen, nämlich dass diese sprachliche Neuerung von minderer Intelligenz und einem sozial schwachen Status zeugt. Stattdessen soll diese Art von Jugendsprache als ein sprachliches Phänomen auf einer sprachwissenschaftlichen Basis betrachtet werden. „In der öffentlichen Wahrnehmung tritt der „typische Kiezdeutschsprecher“ oft klischeehaft als männlicher Jugendlicher türkischer Herkunft auf, möglichst in aggressiver Pose“ (Wiese, 2012, S. 14). Dass die Realität sehr viel anders und weitaus spannender geprägt ist, möchte ich in den folgenden Kapiteln unter Beweis stellen.
Germanistische Hausarbeit mit Rückgriff auf selbige Phänomene in der schwedischen Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Begriffsbestimmung des Ethnolekts Kiezdeutsch
- 1. Kiezdeutsch als sprachliche Interferenz
- 1.1 Dialekt, Soziolekt und Ethnolekt
- 1.2 Kiezdeutsch als Varietät der deutschen Sprache
- 2. Grammatische und syntaktische Eigenschaften und Neuerungen
- 2.1 Artikel- und präpositionslose Ortsangaben
- 2.2 Sprachliche Verkürzungen
- 2.3 Zusammenzug von „lassma“, „musstu“ und „ischwör“
- 2.4 Funktionsverbgefüge
- 2.5 Innovative Wortstellungsoptionen
- 2.6 Verwendung des Fokusmarkers,,so“
- 1. Kiezdeutsch als sprachliche Interferenz
- II. Mythos Kiezdeutsch als Zeichen mangelnder Integration
- 1. Situation der Türken in Deutschland
- 1.1 Migration und sozialer Hintergrund
- 1.2 Begriffserklärung „Kanak Sprak“
- 2. Verbreitung des Mythos
- 2.1 Mediale Verarbeitung und Repräsentation
- 2.2 Vorurteil,,Halbsprachigkeit“
- 1. Situation der Türken in Deutschland
- III. Kiezdeutsch als nationenübergreifendes Phänomen
- 1. Begriffsbestimmung „Code-switching“
- 2. Sprachliche Tendenzen Ethnolekte anderer Länder
- 2.1 Beispiel Rinkebysvenska
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen „Kiezdeutsch“ und analysiert diesen Sprachstil als multiethnischen Jugenddialekt. Ziel ist es, Kiezdeutsch als eine lebendige und innovative Form der deutschen Sprache zu präsentieren und die gängigen Vorurteile gegenüber dieser Sprachvarietät zu entkräften.
- Kiezdeutsch als sprachliche Interferenz und seine Entstehung im Kontext von Migration und multiethnischen Wohngebieten.
- Grammatische und syntaktische Besonderheiten des Kiezdeutsch, die sich von der Standardsprache abheben.
- Der Mythos von Kiezdeutsch als Zeichen mangelnder Integration und die kritische Analyse dieser Sichtweise.
- Kiezdeutsch als nationenübergreifendes Phänomen, das sich in verschiedenen Ländern beobachten lässt.
- Die Bedeutung von Code-switching und der Einfluss anderer Sprachen auf die Entwicklung des Kiezdeutsch.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kiezdeutsch ein und stellt die Problematik der gängigen Bezeichnungen wie „Gastarbeiterdeutsch“ oder „Kanak Sprak“ dar. Die Arbeit fokussiert sich auf eine sprachwissenschaftliche Analyse von Kiezdeutsch als eigenständigem Dialekt.
Kapitel I beleuchtet die sprachliche Interferenz im Kontext von Kiezdeutsch. Es werden die Begriffe Dialekt, Soziolekt und Ethnolekt definiert und Kiezdeutsch als eine Varietät der deutschen Sprache, die von einer bestimmten sozialen Gruppe in einem multiethnischen Umfeld geprägt ist, beschrieben.
Kapitel II widmet sich dem Mythos von Kiezdeutsch als Zeichen mangelnder Integration. Die Situation der Türken in Deutschland und die Entstehung des Begriffs „Kanak Sprak“ werden beleuchtet. Die Arbeit analysiert die mediale Verarbeitung und Repräsentation von Kiezdeutsch und kritisiert das Vorurteil von „Halbsprachigkeit“.
Kapitel III betrachtet Kiezdeutsch als nationenübergreifendes Phänomen. Der Begriff „Code-switching“ wird definiert und es werden sprachliche Tendenzen von Ethnolekten anderer Länder, wie zum Beispiel Rinkebysvenska, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kiezdeutsch, Ethnolekt, Jugendsprache, Migration, Integration, Sprachliche Interferenz, Code-switching, Soziolekt, Dialekt, Sprachvariation, Sprachwandel, Kanak Sprak, Rinkebysvenska.
- Quote paper
- Lisa Lindner (Author), 2012, Kiezdeutsch. Multiethnolekt und Ausdruck soziokultureller Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302894