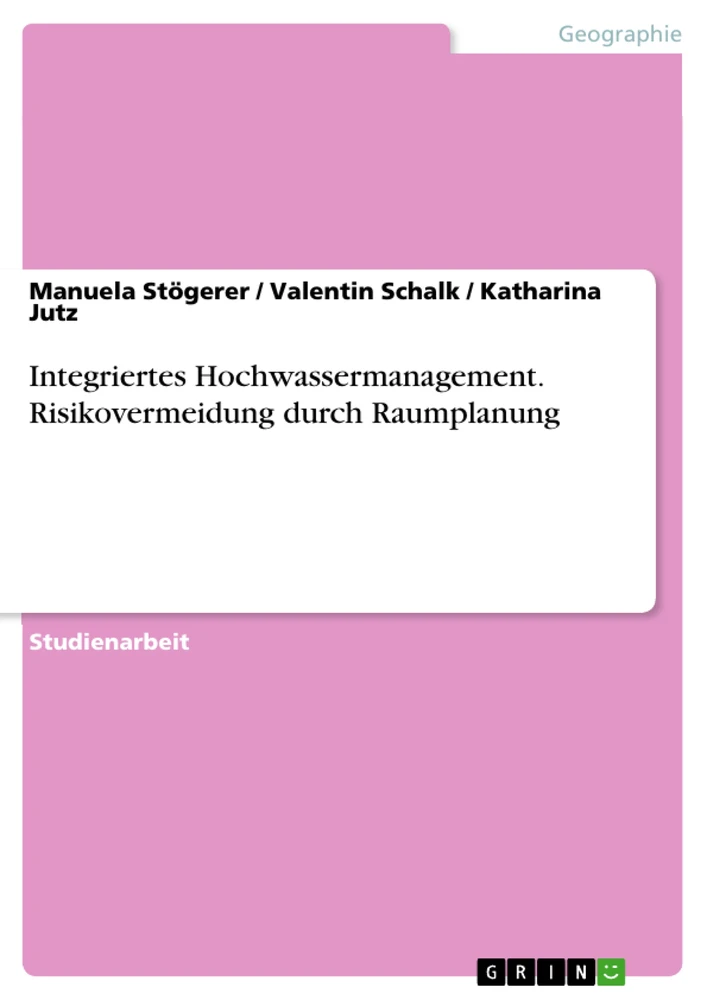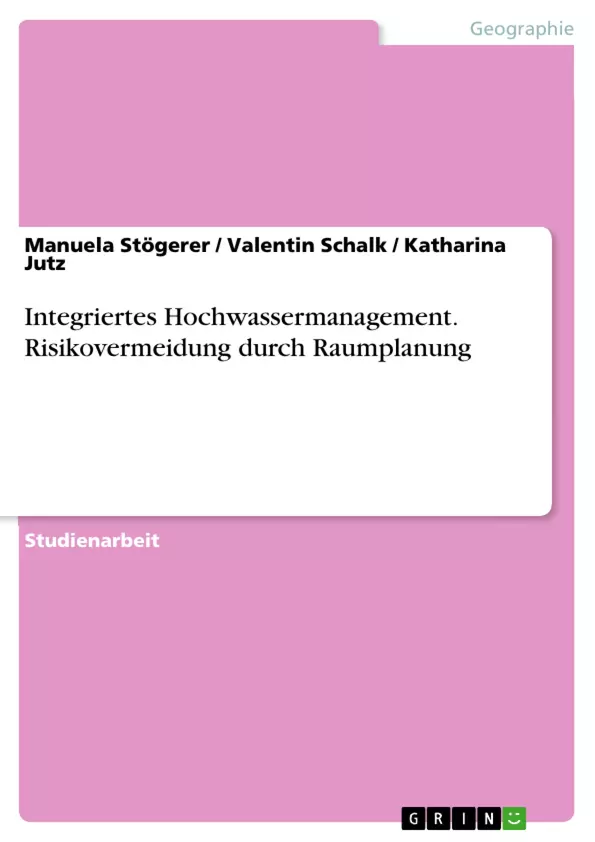Wasser war seit jeher eine maßgebliche Grundlage des menschlichen Lebens und Wirtschaftens. Die Multifunktionalität des Flussgebiets zur Energiegewinnung, Transport von Gütern oder fruchtbare Ackerböden machten die Flusslandschaften damals wie heute zu attraktiven Siedlungsgebieten. Viele alte Siedlungskerne befinden sich daher in direkter Nähe zu Flüssen.
Dass diese jedoch nicht nur positiven Einfluss auf Siedlungen haben können, zeigen historische sowie aktuelle Hochwasserereignisse. Berichte über Ausmaß und Schäden deuten immer wieder darauf hin, wie wichtig und aktuell die Auseinandersetzung mit dem Thema Hochwasser ist. In Österreich wurde die Problematik vor allem durch die verheerenden Hochwässer in den Jahren 2002 und 2005 bewusst.
Um Hochwässer beschreiben und verstehen zu können, ist es wichtig einige wesentliche Faktoren, die bei Hochwasserereignissen zusammen spielen, zu nennen. Neben klimatischen oder geologischen Faktoren sind vor allem aktuelle räumliche Entwicklungen für das Entstehen von Hochwasserrisiken verantwortlich:
Steigender Bodenverbrauch, der durch Bevölkerungswachstum und wirtschaftlichen Entwicklungsdruck entsteht, führt in Kombination mit restriktiven naturräumliche Gegebenheiten zu beengten Räumen. Vor allem Geminden in alpinen Tallagen und Flusslandschaften haben Schwierigkeiten, Flächen für intensive und vielfältige Nutzungen bereit zu stellen. In Österreich sind beispielsweise 39% der Fläche für den Dauersiedlungsbereich geeignet, in Salzburg liegt der Wert lediglich bei 20 % des Bundeslandgebiets. Die Folge davon sind oft Siedlungsgrenzen, welche in Hochwasserbereiche ausufern.
Tritt Hochwasser aus dem Flussbett aus, entstehen Schäden erst wenn das Hochwasser auf etwas zu Schädigendes trifft. Erst durch die Interaktion von Gefährdung und Verletzbarkeit (Vulnerabilität) entsteht das Hochwasserrisiko. In Europa stieg in den letzten Jahrzehnten das Hochwasserrisiko vor allem durch das erhöhte Schadenspotential, das die Schadensummen in die Höhe treibt. Dafür verantwortlich sind beispielsweise vollausgebaute Kellergeschoße, Besitz teurer Maschinen oder ähnliches. Bei hochwasserbedingten Schäden unterscheidet man zwischen direkten und indirekten Schäden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Integriertes Hochwassermanagement
- 2.1. Risikokreislauf
- 2.1.1. Hochwasserereignis
- 2.1.2. Bewältigung
- 2.1.3. Regeneration
- 2.1.4. Prävention
- 2.1. Risikokreislauf
- 3. Fokus Raumplanung
- 3.1. Informationsbeschaffung
- 3.1.1. HORA Risikozonierung
- 3.1.2. Gefahrenzonenpläne
- 3.1.2.1 Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung
- 3.1.2.2 Der Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung
- 3.2. Rechtliche Grundlagen
- 3.2.1. Die Rechtsgrundlage auf europäischer Ebene
- 3.2.2. Die Rechtsgrundlagen auf Bundesebene
- 3.2.3. Die Rechtsgrundlage auf Landesebene
- 3.3. Maßnahmen
- 3.3.1. Passive Maßnahmen
- 3.3.2. Technische Maßnahmen
- 3.1. Informationsbeschaffung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Thema des integrierten Hochwassermanagements und beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Prävention, Bewältigung und Regeneration im Umgang mit Hochwasserereignissen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Raumplanung und der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Integriertes Hochwassermanagement als ganzheitlicher Ansatz
- Bedeutung der Raumplanung bei der Hochwasserprävention
- Rechtliche Grundlagen auf EU-, Bundes- und Landesebene
- Analyse verschiedener präventiver und technischer Maßnahmen
- Risikokreislauf bei Hochwasserereignissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Integriertes Hochwassermanagement ein und beschreibt den Entstehungsprozess dieser Arbeit, inklusive der beteiligten Personen und der angewendeten Forschungsmethoden. Es wird auf die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Recherche in Fachliteratur sowie die durchgeführten Exkursionen und Experteninterviews hingewiesen.
2. Integriertes Hochwassermanagement: Dieses Kapitel definiert das Konzept des integrierten Hochwassermanagements und beschreibt den Risikokreislauf, der Hochwasserereignisse, Bewältigung, Regeneration und Prävention umfasst. Es werden die einzelnen Phasen detailliert erläutert, wobei der Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen des Kreislaufs hervorgehoben wird. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der komplexen Herausforderungen im Umgang mit Hochwasser.
3. Fokus Raumplanung: Das Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Raumplanung im Hochwassermanagement. Es beschreibt die Informationsbeschaffung, inklusive der Nutzung von Risikozonierungen (HORA) und Gefahrenzonenplänen (von Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Bundeswasserbauverwaltung). Die relevanten rechtlichen Grundlagen auf europäischer, bundesstaatlicher und Landesebene werden detailliert analysiert. Schließlich werden verschiedene passive und technische Maßnahmen zur Hochwasserprävention im Kontext der Raumplanung erörtert, und deren Wirksamkeit und Grenzen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Integriertes Hochwassermanagement, Hochwasserrisiko, Raumplanung, Gefahrenzonenpläne, Rechtliche Grundlagen, Prävention, Bewältigung, Regeneration, Risikozonierung, HORA, EU-Hochwasserrichtlinie, passive Maßnahmen, technische Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Integriertes Hochwassermanagement"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit dem Thema des integrierten Hochwassermanagements. Es analysiert die verschiedenen Aspekte der Prävention, Bewältigung und Regeneration im Umgang mit Hochwasserereignissen, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Raumplanung und der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themenschwerpunkte: Integriertes Hochwassermanagement als ganzheitlicher Ansatz; Bedeutung der Raumplanung bei der Hochwasserprävention; Rechtliche Grundlagen auf EU-, Bundes- und Landesebene; Analyse verschiedener präventiver und technischer Maßnahmen; Risikokreislauf bei Hochwasserereignissen; Informationsbeschaffung über Risikozonierungen (HORA) und Gefahrenzonenpläne; Passive und technische Maßnahmen im Hochwasserschutz.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel zum integrierten Hochwassermanagement mit dem Risikokreislauf (Ereignis, Bewältigung, Regeneration, Prävention). Ein zentrales Kapitel konzentriert sich auf die Raumplanung, inklusive Informationsbeschaffung (HORA, Gefahrenzonenpläne), rechtlichen Grundlagen (EU, Bund, Land) und Maßnahmen (passiv, technisch). Es schließt mit einem Fazit ab. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die Raumplanung im integrierten Hochwassermanagement?
Die Raumplanung spielt eine zentrale Rolle im Hochwassermanagement. Das Dokument analysiert die Informationsbeschaffung durch Risikozonierungen (wie HORA) und Gefahrenzonenpläne (von Wildbach- und Lawinenverbauung und der Bundeswasserbauverwaltung). Es untersucht die relevanten rechtlichen Grundlagen auf verschiedenen Ebenen und erörtert verschiedene passive und technische Maßnahmen zur Hochwasserprävention im Kontext der Raumplanung.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die rechtlichen Grundlagen des Hochwassermanagements auf europäischer, bundesstaatlicher und Landesebene. Es analysiert die entsprechenden Gesetze und Verordnungen, die die Maßnahmen zur Hochwasserprävention und -bewältigung regeln.
Welche Arten von Maßnahmen zur Hochwasserprävention werden diskutiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen passiven und technischen Maßnahmen zur Hochwasserprävention. Es erörtert die jeweilige Wirksamkeit und Grenzen dieser Maßnahmen im Kontext der Raumplanung.
Was ist der Risikokreislauf im Hochwassermanagement?
Der Risikokreislauf umfasst die Phasen Hochwasserereignis, Bewältigung, Regeneration und Prävention. Das Dokument beschreibt detailliert den Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Phasen und betont die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes.
Welche Informationsquellen wurden verwendet?
Die Einleitung erwähnt die Verwendung von Fachliteratur, Exkursionen und Experteninterviews als Informationsquellen für die Erstellung des Dokuments.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Integriertes Hochwassermanagement beschäftigen, insbesondere für Fachleute in den Bereichen Raumplanung, Wasserwirtschaft, Katastrophenschutz und Politik.
- Citation du texte
- DI Manuela Stögerer (Auteur), Valentin Schalk (Auteur), Katharina Jutz (Auteur), 2012, Integriertes Hochwassermanagement. Risikovermeidung durch Raumplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302973