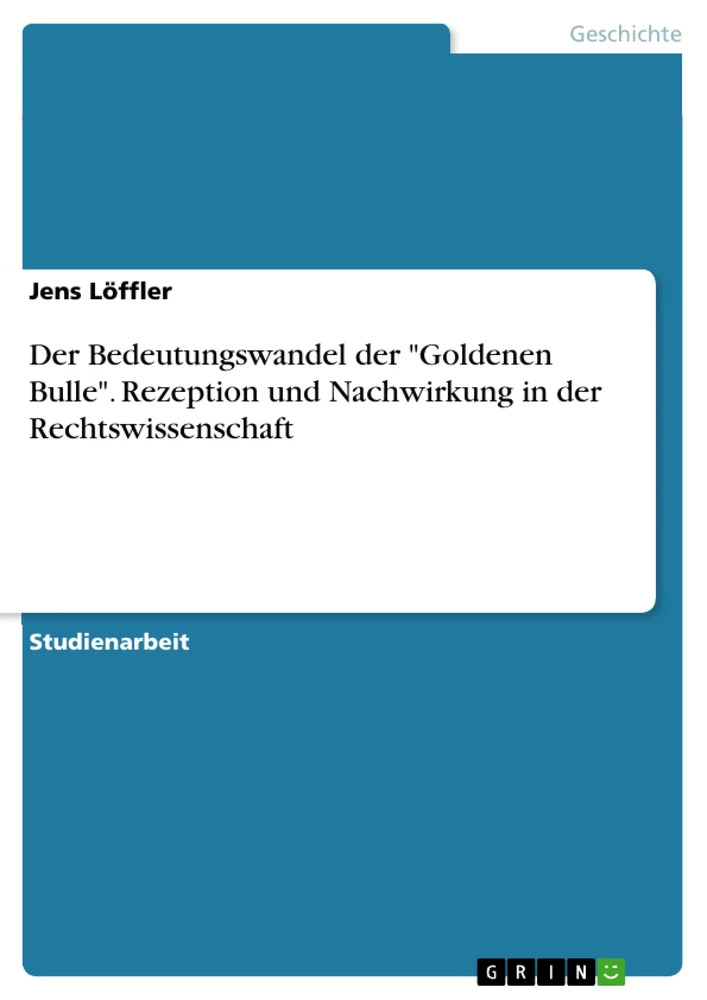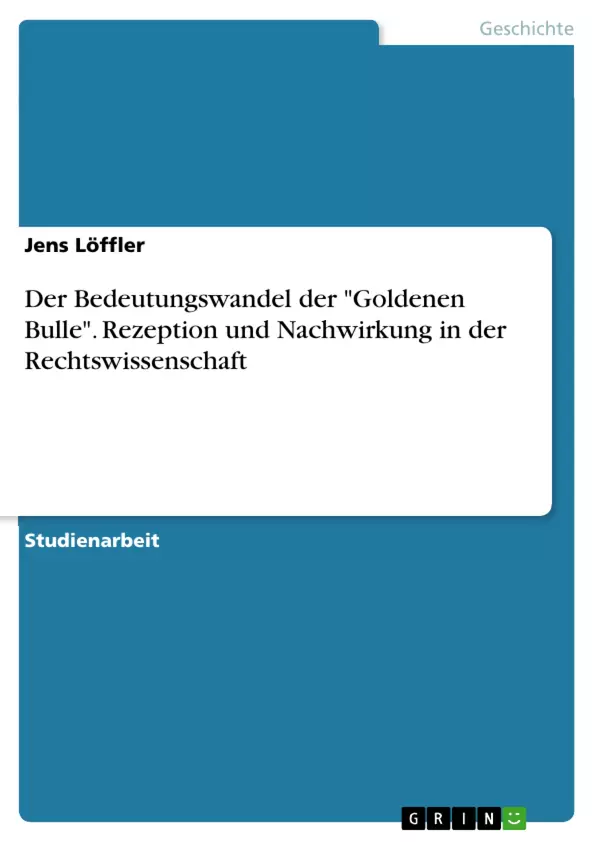Eine Untersuchung zur Rezeption der Goldenen Bulle bis in die Gegenwart sowie zu ihrer rechtsgeschichtlichen Bedeutung.
Vor nunmehr 653 Jahren wurde auf dem Reichstag in Metz der zweite und letzte Teil der Goldenen Bulle verabschiedet. Ein Reichsgrundgesetz, das 450 Jahre lang bestand hatte und dessen Anteil an der Beständigkeit des Heiligen Römischen Reiches nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich die Sicht der Rezipienten auf dieses Gesetzeswerk immer wieder. Allein in den Werken des wohl bekanntesten Autors der je über die Goldene Bulle schrieb, in Goethes Werken nämlich, lassen sich mehrere Phasen ausmachen. Deshalb sollen in dieser Hausarbeit Rezeption und Nachwirkung der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. behandelt werden, um eine Übersicht über die verschiedenen Stadien ihrer Wahrnehmung zu bieten.
Den Anfang wird dabei die zeitgenössische Chronistik bilden. Mit Hilfe von neuen Erkenntnissen, die in der historischen Kommunikationsforschung gewonnen wurden, wird dabei die bisherige Sicht, die Goldene Bulle sei kaum oder nur am Rande rezipiert worden, widerlegt beziehungsweise relativiert werden. Weiterhin wird von Interesse sein, wie sich das Bild welches die betroffenen Gruppen von dem Gesetzeswerk hatten, wandelte. Dafür werden die verschiedenen Überlieferungskonstellationen herangezogen. Im Folgenden soll ein Blick in die juristische Fachliteratur zwischen dem Ende des 15. und 18.Jahrhunderts Aufschluss darüber geben, welche Bedeutung die Goldene Bulle in der Bewertung durch die Rechtswissenschaft einnahm, die naturgemäß zu den wichtigsten Rezipienten gehört. Hier sollen vor allem die Entwicklungen, die zwischen Peter von Andlau und Stephan Pütter im Umgang mit dem Gesetzeswerk stattfanden, kurz dargestellt werden.
Abschließend werden die Nachwirkungen der Bulla Aurea unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Welche Folgen ergaben sich für Innen- und Außenpolitik des Reiches? Fand die Wirkung der Goldenen Bulle mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen 1806 ebenfalls ein Ende oder war sie darüber hinaus präsent? Um diese Fragen zu beantworten wird neben den einschlägigen Quellen das aktuellste Werk „Die Goldene Bulle: Politik, Wahrnehmung, Rezeption“ (hg. v. Ulrike Hohensee u.a.) als Sekundärliteratur dienen, das interessante neue Forschungsansätze bietet. Auch die bekannten Beiträge von Bernd-Ulrich Hergemöller, Karl Zeumer und Erlin Ladewig Petersen werden herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeitgenössische Rezeption
- Bedeutungzunahme und Bedeutungswandel nach 1400
- Rezeption der Goldenen Bulle in der Rechtswissenschaft
- Nachwirkung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rezeption und Nachwirkung der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV., einem Reichsgrundgesetz, das über 450 Jahre bestand und die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches nachhaltig prägte. Die Arbeit analysiert, wie die Sichtweise auf die Goldene Bulle im Laufe der Jahrhunderte verändert wurde, und beleuchtet die Bedeutung des Gesetzeswerks in der zeitgenössischen Chronistik, in der Rechtswissenschaft und in der Politik.
- Die zeitgenössische Rezeption der Goldenen Bulle, insbesondere im Kontext der mittelalterlichen Kommunikationsgeschichte
- Die Bedeutung der Goldenen Bulle in der Rechtswissenschaft zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert
- Die Nachwirkungen der Goldenen Bulle auf die Innen- und Außenpolitik des Heiligen Römischen Reiches
- Die Rolle der Goldenen Bulle in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zwischen Kaiser und Kurfürsten, Kaiser und Papst sowie Kaiser und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Goldene Bulle als ein zentrales Gesetzeswerk des Heiligen Römischen Reiches vor und skizziert den zeitlichen Rahmen der Untersuchung. Sie erläutert die Relevanz der Goldenen Bulle für die Geschichte des Reiches und die Forschungsfrage der Arbeit, welche die Entwicklung der Wahrnehmung des Gesetzeswerks im Laufe der Jahrhunderte beleuchten möchte.
Zeitgenössische Rezeption
Dieses Kapitel analysiert die zeitgenössische Rezeption der Goldenen Bulle anhand von Chroniken, die über den Reichstag in Metz berichten, auf dem das Gesetzeswerk verabschiedet wurde. Es zeigt, dass die Chronisten zwar die Pracht und den Prunk des Hoftages betonen, aber den inhaltlichen Aspekt der Goldenen Bulle nur am Rande behandeln. Die Forschung geht davon aus, dass die Zeitgenossen die Bedeutung des Gesetzeswerks nicht vollständig erkannten. Neuere Forschungen zur Kommunikationsgeschichte stellen diese Annahme allerdings infrage und zeigen, dass die Visualisierung der Inhalte in Form von Zeremonien und Ritualen eine wichtige Rolle bei der Rezeption der Goldenen Bulle spielte. Das Kapitel beleuchtet exemplarisch die Bedeutung von Zeremonien wie der Belehnung des französischen Thronfolgers und der Zelebrierung der Weihnachtsmesse für die Vermittlung der Inhalte der Goldenen Bulle.
Bedeutungzunahme und Bedeutungswandel nach 1400
Dieses Kapitel untersucht die Rezeption der Goldenen Bulle in der Zeit nach 1400 und beleuchtet die Veränderungen in der Wahrnehmung des Gesetzeswerks.
Rezeption der Goldenen Bulle in der Rechtswissenschaft
Dieses Kapitel behandelt die Rezeption der Goldenen Bulle in der juristischen Fachliteratur zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert und analysiert die Bedeutung des Gesetzeswerks für die Rechtswissenschaft. Die Kapitel beleuchtet die Entwicklungen im Umgang mit der Goldenen Bulle, insbesondere die unterschiedlichen Interpretationen von Peter von Andlau und Stephan Pütter.
Schlüsselwörter
Die Goldene Bulle, Kaiser Karl IV., Heiliges Römisches Reich, Reichsgrundgesetz, Rezeption, Nachwirkung, Chroniken, Kommunikationsgeschichte, Rechtswissenschaft, Innenpolitik, Außenpolitik, Frankreich, Kurfürsten, Papst.
- Arbeit zitieren
- Jens Löffler (Autor:in), 2009, Der Bedeutungswandel der "Goldenen Bulle". Rezeption und Nachwirkung in der Rechtswissenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303013