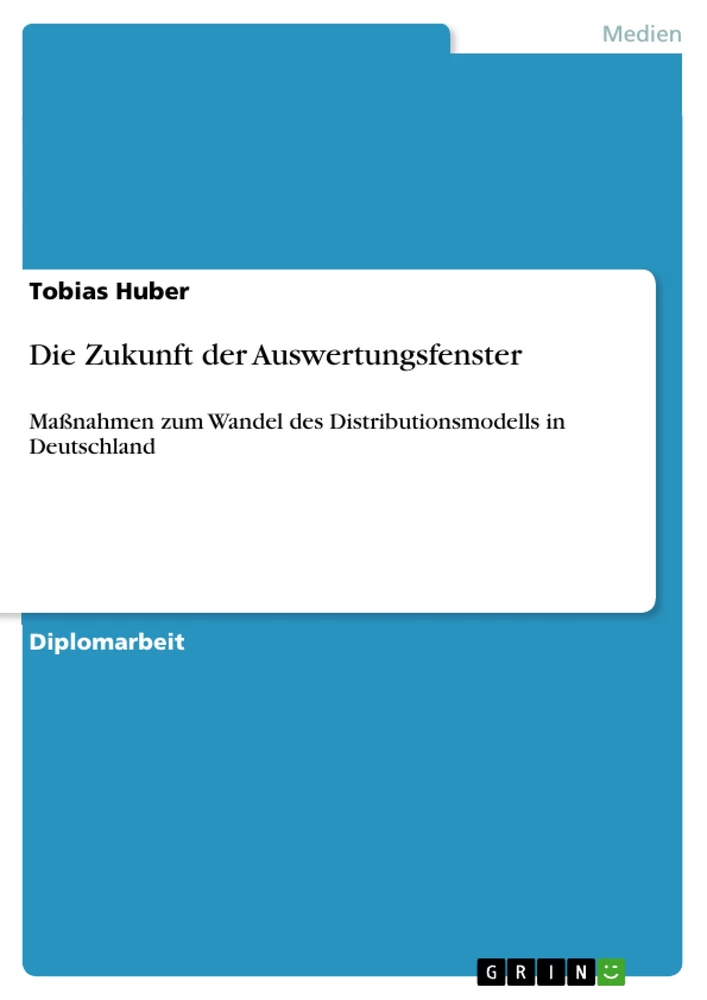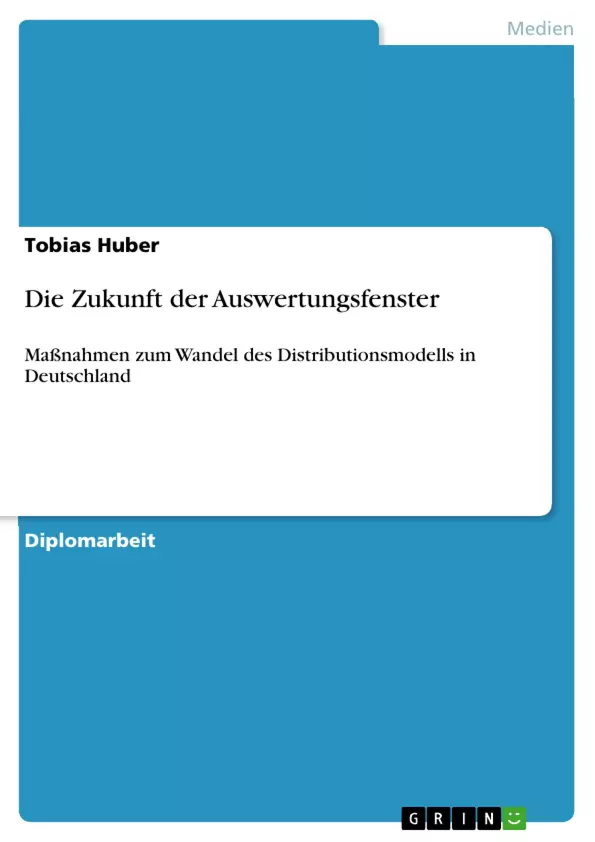Schon mehrmals kam es in der Geschichte des Kinofilms zu Umbrüchen und Veränderungen, doch noch nie zuvor traten diese in einer Geschwindigkeit auf, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten ist. Die technologischen, sozialen und gesetzlichen Veränderungen führen zu Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer der Branche wohl oder übel stellen müssen. Nicht zuletzt deshalb werden teils mit großem Aufwand Experimente zu alternativen Auswertungsformen durchgeführt. Im Vorwort einer neuen, umstrittenen Studie der Europäischen Union, „New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?“, heißt es: „These changes [...] significantly threaten the situations of equilibrium established over many years, but also represent opportunities to break longstanding deadlocks.“
Ziel dieser Arbeit ist es, diese Chancen und Risiken zu identifizieren und differenziert zu analysieren, um daraus Handlungsempfehlungen für die Filmwirtschaft zu entwickeln. Diese sollen helfen, den zukünftigen Veränderungen der Distributionslandschaft bestmöglich zu begegnen. Dazu werden die aktuelle Situation und sich abzeichnende Entwicklungen in Deutschland dargestellt und unter Einbeziehung von Experten- Einschätzungen kritisch bewertet. Auf die von Prof. Dr. Hennig-Thurau gestellte Frage will diese Arbeit so eindeutig wie möglich antworten: „Warum sind Filme nicht da verfügbar, wo ich sie sehen (und dafür bezahlen) will?“
Inhalt
1. Distributionsmodelle im Wandel
2. Theoretische Grundlagen der verwendeten Werkzeuge
2.1. Das Experteninterview
2.2. Die Szenario-Technik
2.3. Der Szenario-Trichter
2.4. Die Chancen-Risiken-Analyse
3. Der aktuelle Stand des Distributionsmodells in Deutschland
3.1. Definition des Untersuchungsfeldes
3.2. Die Verwertungskette
3.3. Filmförderung und Filmproduktion in Deutschland
3.4. Die Bedeutung des FFG
3.5. Die Funktionsweise der FFG Sperrfristen
3.6. Der Antrag zur Sperrfristenverkürzung
3.7. Selbst bestimmte Auswertungsfenster
3.8. Kino-Auswertung
3.9. Bildträger- und VoD-Auswertung
3.10. Entgeltliche und unentgeltliche Fernsehsender
3.11. Aktueller Stand zur Filmpiraterie
4. Entwicklungstendenzen der Branchen-Umwelt
4.1. Digitalisierung und Internet
4.2. Home-Entertainment versus Kinoerlebnis
4.3. Experimente zu alternativen Release-Strategien
4.4. Die Politik der Majors
4.5. Entwicklung neuer Endgeräte
4.6. Politisch-rechtliche Entwicklungen auf europäischer Ebene
4.7. Politisch-rechtliche Entwicklungen auf nationaler Ebene
4.8. Entwicklung der Filmpiraterie
5. Entwicklung von Szenarien
5.1. Szenario 1: Das Ubiquitätsmodell
5.2. Szenario 2: Beibehaltung der aktuellen Auswertungsfenster und Sperrfristen
5.3. Trendszenario: Individualisierung, Flexibilisierung und Verkürzung der Auswertungsfenster
6. Chancen und Risiken einer Veränderung des deutschen Distributionsmodells
6.1. Soll-Zustand des deutschen Distributionsmodells
6.2. Vorschläge von Fred Breinersdorfer
6.3. Chancen und Risiken des Superticket-Konzepts
6.4. Chancen einer Preisstaffelung
6.5. Risiken der Machtausübung durch Branchenführer
6.6. Chancen und Risiken von Day-and-date Releases
6.7. Risiken für Kinobesitzer
6.8. Risiko des Recoupment-Verlusts
6.9. Chance des Recoupment-Gewinns
6.10. Chance einer schnelleren Zweitauswertung
6.11. Chancen zur Bekämpfung der Filmpiraterie
7. Abwägung und Handlungsempfehlungen
7.1. Flexibilisierung und Verkürzung der FFG Sperrfristen
7.2. Individuellere Handhabung der Auswertungsfenster
7.3. Verbesserung des Online-Angebots
8. Abschließende Diskussion
9. Quellen
9.1. Bibliographie
9.2. Filmographie
9.3. Web-Quellen
9.4. Rechtsquellenverzeichnis
10. Abkürzungsverzeichnis
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
12. Anhangsverzeichnis
1. Distributionsmodelle im Wandel
Warum sind Filme nicht da verfügbar, wo ich sie sehen (und dafür bezahlen) will? Das ist den aktiven Abnehmern von heute nicht mehr verständlich zu machen. Ein Marktmodell gegen die Interessen der Konsumenten aufrechtzuerhalten, ist eine schwierige Sache und riskiert letztlich das Zusammenbrechen des gesamten Markts.[1]
Vor nicht weniger als dem Kollaps der Filmindustrie warnt Prof. Dr. Hennig-Thurau hier in Bezug auf die aktuellen Veränderungsprozesse im Distributionsmodell für Kinofilme. Er kommentiert damit ein Thema, das unter Branchenmitgliedern hoch emotional diskutiert wird – die technologischen, sozialen und gesetzlichen Entwicklungen werden je nach Standpunkt extrem unterschiedlich interpretiert. Schon mehrmals kam es in der Geschichte des Kinofilms zu Umbrüchen und Veränderungen, doch noch nie zuvor traten diese in einer Geschwindigkeit auf, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten ist.[2] Die technologischen, sozialen und gesetzlichen Veränderungen führen zu Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer der Branche wohl oder übel stellen müssen. Nicht zuletzt deshalb werden teils mit großem Aufwand Experimente zu alternativen Auswertungsformen durchgeführt. Im Vorwort einer neuen, umstrittenen Studie[3] der Europäischen Union, „New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?“, heißt es: „These changes [...] significantly threaten the situations of equilibrium established over many years, but also represent opportunities to break longstanding deadlocks.“
Ziel der Arbeit ist es, diese Chancen und Risiken zu identifizieren und differenziert zu analysieren, um daraus Handlungsempfehlungen für die Filmwirtschaft zu entwickeln. Diese sollen helfen, den zukünftigen Veränderungen der Distributionslandschaft bestmöglich zu begegnen. Dazu werden die aktuelle Situation und sich abzeichnende Entwicklungen in Deutschland dargestellt und unter Einbeziehung von Experten-Einschätzungen kritisch bewertet. Auf die von Prof. Dr. Hennig-Thurau gestellte Frage will diese Arbeit so eindeutig wie möglich antworten: „Warum sind Filme nicht da verfügbar, wo ich sie sehen (und dafür bezahlen) will?“[4]
Auch wenn durch die enge Verknüpfung der verschiedenen Faktoren eine Vielzahl von Themenbereichen tangiert werden, würde eine Analyse aller Aspekte des momentanen Wandels im Distributionsmodell zu weit führen. Im Fokus der Untersuchung steht daher die Veränderung der zeitlichen Abfolge der Auswertungsfenster von Kinofilmen im deutschen Markt.
Zur wissenschaftlichen Analyse der Situation wurden drei Instrumente verwendet, die zu Beginn kurz theoretisch dargestellt werden: Das Experteninterview, das Szenario-Modell und die Chancen-Risiken-Analyse. Bei der Auswahl der befragten Experten wurde darauf geachtet, je einen Vertreter für die unterschiedlichen Branchenteile zu wählen. Ihre Aussagen wurden methodisch analysiert und als ergänzende Quellen für die nachfolgenden Punkte verwendet. Das weitere Vorgehen entspricht grundsätzlich dem Vorschlag Prof. Dr. Bernhard Ungerichts zur Entwicklung von Zukunfts-Szenarien. Zuerst wird demnach die aktuelle Situation in Deutschland beschrieben und das Untersuchungsfeld definiert, wobei die Sperrfristen des Filmförderungsgesetzes besondere Beachtung finden. Anschließend werden die wichtigsten Einflussfaktoren identifiziert und beschrieben. Diese finden wiederum Verwendung in der folgenden Entwicklung von drei Szenarien.[5] Darauf aufbauend werden in Punkt 6. die Chancen und Risiken für das Distributionsmodell in Deutschland analysiert, wobei einzelne Aspekte aus aktuellen Fachartikeln genauso einbezogen werden, wie die geführten Experteninterviews. Zuletzt folgen gemäß dem System Ungerichts konkrete Handlungsempfehlungen sowie abschließend eine differenzierte Bewertung, die unter Einbezug der behandelten Themen einen Zukunftsausblick auf den deutschen Markt geben soll.
Zur Unterstützung des Leseflusses wird auf die gleichzeitige Nennung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
2. Theoretische Grundlagen der verwendeten Werkzeuge
Zur wissenschaftlichen Betrachtung eines komplexen Themenbereichs ist die Verwendung von systematischen Methoden unerlässlich. Im Folgenden werden die Funktions- und Vorgehensweisen von drei Instrumenten dargestellt, die in dieser Arbeit zum Einsatz gekommen sind: das Experten-Interview dient neben Artikeln aus Fachzeitschriften und Statistiken zur Informationsbeschaffung, die Szenario-Technik zur qualitativen Zukunftsprognose und darauf aufbauend schließlich die Chancen-Risiken-Analyse zur Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen.
2.1. Das Experteninterview
Obwohl es eine Fülle an Sachbüchern gibt, die sich mit den Themen Filmförderung und Filmauswertung beschäftigen, ist die Quellenlage speziell zu den Auswertungsfenstern bzw. zu den Sperrfristen im Filmförderungsgesetz unergiebig. Gleichzeitig schreiten die Entwicklungen mit hoher Geschwindigkeit voran: Um den Erfordernissen „einer sich rasant verändernden Mediennutzung“[6] Rechnung zu tragen, wird die Laufzeit der neuen Version des Gesetzes neuerdings nur drei und nicht wie bisher fünf Jahre betragen. Man wolle damit der Branche „die Chance geben, sich auf ein neues Miteinander zu verständigen, um die strittigen Fragen der Vergangenheit auf eine neue Grundlage zu stellen.“[7]
Zur Überprüfung genau dieser strittigen Fragen zu aktuellen Themen sind nach Prof. Dr. Bernhard Ungericht, Professor am Institut für Internationales Management in Graz, vor allem „qualitative Experteneinschätzungen“[8] aus unterschiedlichen Fachrichtungen nützlich. Als Experten beschreiben Meuser und Nagel jemanden, der „in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Ausarbeitung, die Implementierung und/oder die Kontrolle einer Problemlösung“[9]. Darüber hinaus haben Experten „privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungsprozesse, Politikfelder usw.“[10].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Inhomogenität der Filmbranche führt dabei dazu, dass sich in dem breiten Meinungs-Spektrum Aussagen teilweise widersprechen. Doch „es ist der gemeinsam geteilte institutionell-organisatorische Kontext der Experten, der die Vergleichbarkeit der Interviewtexte weitgehend sichert“.[11] Um einen möglichst umfassenden Überblick zu erhalten, wurden repräsentativ Vertreter der Branchen-Bereiche Filmproduktion, Kinobesitzer, Film-Verleih, Videothek, Pay-TV und frei empfangbarer Fernsehveranstalter befragt. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die entsprechenden Personen in ihrer täglichen Arbeitswelt bei Veränderungen der Auswertungsfenster direkt mit den Konsequenzen zu tun hatten und haben. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zwischen den Interviews zu erreichen, erhielten alle Experten ähnliche Leitfragen. Entsprechend der Antworten wurden einzelne Aspekte vertieft und ausgeweitet. Die Fragestellung orientiert sich an der weiteren Struktur der Arbeit:
1. Ausgehend von Ihrer Branche: schaden oder nützen Ihnen die Auswertungsfenster in ihrer momentanen Form?
2. Welche Chancen oder Risiken sehen Sie in der Abschaffung der Auswertungsfenster-Praxis?
3. Wie ist Ihrer Meinung nach die zukünftige Entwicklung der Filmbranche im Hinblick auf das Distributionsmodell?
Selbstverständlich ist die Anzahl der befragten Experten zu gering und die Untersuchung zu unvollständig, um eine generalisierte Aussage über die Entwicklung des Distributionsmodelles in Deutschland treffen zu können und es wird auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Dennoch können die einzelnen Thesen dabei helfen, akute und reale Probleme der Filmbranche zu identifizieren. Um die Thesen der Experteninterviews zu extrahieren, wurde nach dem gängigen Prinzip zur Interview-Auswertung von Meuser und Nagel vorgegangen.[12] Von zentraler Bedeutung ist dabei, die Gesprächsinhalte nach „thematischen Einheiten, also über die Texte verstreute Passagen“[13] zu gliedern. Die einzelnen Schritte gestalten sich gemäß Meuser und Nagel wie folgt:
1. Transkription: Die Interviews wurden audiographisch aufgezeichnet und transkribiert. Nachzulesen sind sie im Anhang Punkt 10.2. auf S. 74.
2. Paraphrase: Die sequenzielle Paraphrasierung der transkribierten Texte erfolgte in dieser Arbeit zur leichteren Weiterverarbeitung in einer Excel-Tabelle. Jeder Interviewpartner erhielt dabei eine Farbe, die weiter im Regenbogensystem fortschreitet, je nachdem, welchem Zeitpunkt in der Auswertung die Branche des Experten zuzuordnen ist.
3. Kodieren: Die paraphrasierten Textbausteine wurden nun in jedem Interview thematisch geordnet und mit „Kodes“ versehen, wobei die Auflösung der Sequenzialität „erlaubt und notwendig“[14] war. Die Kategorien sind: Neutrale Aussagen, positive Bewertung der Gegenwart, kritische Bewertung der Gegenwart, Chancen in der Zukunft, Risiken in der Zukunft.
4. Thematischer Vergleich: Unter Einbeziehung aller geführten Interviews wurden anschließend die einzelnen Textbausteine in die Kategorien eingegliedert. Dabei ist besonders anzumerken, dass sich bereits durch die Farbkodierung deutlich zeigt, welche Auswertungsformen einer tendenziell negativen und welche einer tendenziell positiven Zukunft entgegenblicken.
5. Soziologische Konzeptualisierung: Losgelöst von verwendeten Begrifflichkeiten wurde versucht, „im Rekurs auf theoretische Wissensbestände“[15] in Form von themenrelevanten Büchern und Artikeln aus Fachzeitschriften das Expertenwissen zu verdichten. Dopplungen in den Aussagen wurden dabei zusammengefasst.
6. Theoretische Generalisierung: Schließlich wurden die einzelnen Kategorien ihrem Inhalt entsprechend geordnet und ihrem Sinnzusammenhang nach verknüpft. Dabei ergaben sich kleinere Themenbereiche, die von mehreren Experten als wichtig erachtet wurden und sich als solche auch in dieser Arbeit wiederfinden.
2.2. Die Szenario-Technik
Um „wichtige künftige Entwicklungen zu erkennen“[16] eignet sich besonders die Szenario-Technik. Dabei handelt es sich um ein theoretisches Modell, das normalerweise in der Unternehmensführung Anwendung findet, hier jedoch auf alle an der Verwertung eines Kinofilms beteiligten Branchenmitglieder in ihrer Gesamtheit angewendet werden soll.[17] Als Szenario bezeichnet man „in sich konsistente, alternative Bilder der Zukunft, die in einem kreativen Prozess entwickelt werden, an dem mehrere Teilnehmer (mit unterschiedlichen Perspektiven) beteiligt sind.“[18] Die Erstellung eines solchen Zukunftsbildes ist besonders in der Filmbranche, die sich im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaftssektoren durch eine hohe Unsicherheit und Komplexität auszeichnet, sinnvoll und notwendig.[19] Selbst wenn keine der erarbeiteten Konstellationen zu 100% eintritt, können aus dem resultierenden Überblick langfristig sinnvolle Handlungsstrategien abgeleitet werden. In Prof. Dr. Bernhard Ungerichts „Strategiebewusstes Management. Konzepte und Instrumente für nachhaltiges Handeln“ wird die Vorgehensweise an Hand eines Sechs-Punkte-Systems dargestellt.[20] Daran anknüpfend wird hier beschrieben, wie diese Punkte jeweils umgesetzt wurden.
1. Definition des Untersuchungsfeldes: Der Versuch einer kurzen Eingrenzung des Untersuchungsfelds erfolgt in Punkt 3.1.[21]
2. Identifizierung der wichtigsten Einflussgrößen auf das Untersuchungsfeld: Die Identifizierung erfolgt an Hand einer Darstellung des aktuellen Stands des Distributionsmodells in Deutschland in Punkt 3.2. bis 3.10.[22]
3. Ermittlung von Entwicklungstendenzen bzw. -möglichkeiten: In Punkt 4. Werden aktuelle Entwicklungstendenzen dargestellt und analysiert.[23]
4. Bildung und Auswahl alternativer Annahmebündel: Auf Basis der entwickelten Einflussgrößen und Entwicklungstendenzen werden in Punkt 5. zwei Extremszenarien sowie ein Trendszenario entworfen.[24]
5. Interpretation und Auswertung der ausgewählten Umfeld-Szenarien hinsichtlich ihrer Konsequenzen: Die Auswertung erfolgt in dieser Arbeit in Punkt 6. in Form einer differenzierten Chancen-Risiken-Auflistung.[25]
6. Konzipierung von Maßnahmen: Auf Basis der Chancen und Risiken wird zuletzt in Punkt 7. eine kritische Abwägung getroffen und ein grober Maßnahmenkatalog erstellt.[26]
2.3. Der Szenario-Trichter
Der Grund für die Entscheidung, in dieser Arbeit drei Basis-Szenarien zu kreieren, wird am sogenannten Szenario-Trichter deutlich. Dabei handelt es sich um eine visuelle Darstellung der Möglichkeitsspielräume in Form von Ellipsen in einem Koordinatensystem.[27] Die Szenarien sind als Graphen in dem System aus Entwicklungs-Skala (y-Achse) in Abhängigkeit der Zeit (x-Achse) visualisiert. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto größer werden die Ellipsen der Möglichkeitsspielräume. Die Graphen der zwei Extrem-Szenarien bilden jeweils die obere und die untere Kante des dadurch entstehenden Trichters. Die Mitte zwischen den beiden Verläufen ist das wahrscheinlichste Zukunftsbild, das in dieser Arbeit auch die Basis für einen differenzierten Zukunftsausblick bilden soll.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4. Die Chancen-Risiken-Analyse
Um die Branche vor dem von Prof. Dr. Hennig-Thurau angesprochenen Zusammenbruch zu bewahren, ist die Konfrontation mit besonderen Gefahren und eine aktive Reaktion darauf unbedingt notwendig.[28] Bereits aufgetretene und möglicherweise zukünftig auftretende Umwelt-Veränderungen müssen identifiziert und in konkrete Punkte übersetzt werden, denn Diskontinuitäten eröffnen, besonders wenn sie früh genug erkannt werden, oft ungeahnte Chancen.[29] Um einen Überblick zu schaffen, werden alle relevanten Aspekte generalisiert dargestellt und analysiert. Darauf aufbauend können Abwägungen getroffen werden, welche konkreten Schritte sich daraus ableiten lassen und wo Handlungsbedarf besteht, um eventuellen Situationsverschlechterungen für die Branche entgegenzuwirken.
Die vorgestellten Techniken Experteninterview, Szenario-Entwicklung und Chancen-Risiken-Analyse bilden wirkungsvolle Instrumente, um nun ein Bild der aktuellen Lage und der zukünftigen Entwicklung zu zeichnen.
3. Der aktuelle Stand des Distributionsmodells in Deutschland
„Das heutige Distributionsmodell von Spielfilmen mit seinen Sperrfristen und passiven Konsumenten stammt aus den Achtzigerjahren.“[30] Diese Ansicht vertritt Prof. Dr. Hennig-Thurau in seinem Artikel zur Zukunft der Filmverwertung. Es habe sich aus der Reaktion der Studios auf das Aufkommen von Bildträgern entwickelt und seitdem kaum verändert.[31] Wie das System heute funktioniert und welche Besonderheiten in Deutschland bestehen, soll in den folgenden Punkten erläutert werden.
3.1. Definition des Untersuchungsfeldes
Nach Prof. Dr. Bernhard Ungericht muss vor der Identifizierung der Einflussgrößen eine Definition des Untersuchungsfeldes vorgenommen werden.[32] Gegenstand dieser Untersuchung ist die deutsche Kinowirtschaft, also alle Mitglieder der Filmbranche in Deutschland, die direkt oder indirekt mit der Verwertung eines Kinofilms beschäftigt sind. Konkret sind das Filmproduzenten, Filmverleiher, Kinobesitzer, Videothekenbesitzer, Anbieter entgeltlicher Videoabrufdienste und Anbieter unentgeltlicher Videoabrufdienste, wobei neben privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten auch Online-Angebote in die letzten beiden Kategorien gerechnet werden. Um das Untersuchungsfeld zu begrenzen wird die Verwertung von nationalen und internationalen Fernsehfilmen, Kurzfilmen und Serien jeglicher Art ausgeschlossen.
3.2. Die Verwertungskette
In Eckart Wendlings „Filmproduktion. Recoup!“ heißt es: „Film ist aus ökonomischer Sicht ein normales, ein handelbares Wirtschaftsgut [...]. Film ist aber auch ein Produkt künstlerischen Ausdrucks.“[33] Film ist also sowohl Ware, als auch Kulturgut. Der Produzent ist dabei als Initiator und wirtschaftlicher Träger definiert. In seiner Rolle als Unternehmer obliegt es ihm, den Film zu finanzieren, herzustellen und anschließend so erfolgreich wie möglich auszuwerten.
Dies geschieht in einer so genannten Verwertungskette, also einer „Abfolge von unterschiedlichen Auswertungsformen“, wobei sich „die einzelnen Stufen möglichst wenig behindern“ sollen und ein „insgesamt möglichst hoher Gesamtertrag zu erzielen ist.“[34] In den Vereinigten Staaten wird die optimale Ausnutzung aller Erwerbsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit mehrerer Branchenzweige auch „Windowing“ genannt.[35] Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, doch normalerweise spielt dabei neben dem Erfolg bei Kritikern und dem Gewinn von Preisen in erster Linie das finanzielle Recoupment eine Rolle. Denn auch wenn das deutsche Fördersystem das Risiko für Filmproduzenten signifikant senkt, ist die Produktion ohne Refinanzierung auf Dauer unmöglich. Als „Recoupment“ bezeichnet man dabei „Direct or indirect recovery of funds spent“[36], also den Rückfluss, der getätigte Ausgaben decken soll. „Die Dauer der einzelnen Verwertungsfenster wird normalerweise vom Filmverleiher bestimmt.“[37] Oft geschieht dies jedoch in Absprache mit dem Produzenten, wobei der Verleih zumeist die Vermarktung für den Film übernimmt. Klassischerweise wird ein Film nach seiner Kinoauswertung als Bildträger in Geschäften und Videotheken bzw. im Internet über Video-On-Demand angeboten, bevor ihn Bezahl-Fernsehsender und zuletzt frei empfangbare Fernsehsender zur Ausstrahlung erhalten. Anschließend erfolgt bei erfolgreichen Filmen nach Auslauf der Fernseh-Lizenz oft eine Zweitauswertung, die individuell entwickelt wird.
Bei Filmen, die mit Hilfe von Deutscher Filmförderung entstanden sind, existieren für diese Abfolge zeitliche Restriktionen, die sogenannten Sperrfristen, die nur im Ausnahmefall verändert werden können. Auch wenn sich in der Praxis zeigte, dass der Begriff oft generell für die zeitliche Staffelung der Auswertungsfenster verwendet wird, muss jedoch klar unterschieden werden, denn internationale Verwerter haben keine tatsächlichen Sperren und können Filme deshalb individuell vermarkten, also mit eigenen Sperren versehen. In der Regel halten sie sich bei erfolgreichen Filmen dennoch an die Praxis des Windowing. Ausländische Filme, bei denen hingegen keine Rückflüsse in Kinos zu erwarten sind, erscheinen oft nach wenigen Wochen auf DVD oder überspringen die Kino-Auswertung zumindest im deutschsprachigen Raum vollkommen.
3.3. Filmförderung und Filmproduktion in Deutschland
„Ohne Filmförderung gäbe es keine deutschen Filme, das kann man ganz klar sagen.“[38] Diese deutlichen Worte von Produzent Martin Hagemann, Professor an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, wurden in ähnlicher Form bereits von einer Reihe von Experten der Filmindustrie bestätigt. „Deutsche Kinofilme sind einer sehr starken amerikanischen Konkurrenz ausgesetzt.“[39], ist auf der offiziellen Webseite des FFF Bayern zu lesen. Um sich gegen die aufwendigen Hollywood-Produktionen durchzusetzen, müssten bei deutschen Filmen viel größere finanzielle Mittel eingesetzt werden, die Produzenten nur schwer ohne Hilfe von Filmförderungen aufbringen können. Die Grundlage für Förderungen wiederum bildet das Filmförderungsgesetz, kurz FFG, in dem auch die Mittelbeschaffung für die Fördergelder geregelt ist. Nach §§ 66 ff. FFG kommen diese von den Filmtheatern, der Videowirtschaft sowie den nationalen Fernsehanstalten.[40] Alle drei Bereiche haben neben Politikern der aktuellen Regierung durch ihre Mitgliedschaft in den Fördergremien direkten Einfluss auf die deutsche Kinofilmproduktion.
Die Anzahl der Erstaufführungen deutscher Spielfilme ist im Jahr 2013 mit 154 gegenüber 2012 zwar gleich geblieben, über die letzten 10 Jahre jedoch stark angewachsen: „2004 wurden lediglich 87 Spielfilme erstaufgeführt.“[41] Damit übertrifft die Anzahl deutscher Produktionen im Jahr 2012 sogar die 148 amerikanischen Erstveröffentlichungen. Das führt aber auch zu einer stärkeren Konkurrenz zwischen den einzelnen Filmen und Filmproduzenten und zu einem Überangebot, das die Erfolgschancen senkt.[42] Dies wird besonders deutlich, wenn man den Marktanteil betrachtet: Während amerikanische Produktionen durchschnittlich auf mehr als 60% kommen, haben deutsche Filme einen Anteil von nur 15 bis 29% wobei dieser meist von wenigen Erfolgsfilmen ausgemacht wird.[43] Der Einfluss Hollywoods überwiegt also den der existierenden, aber nicht besonders starken deutschen Filmindustrie.
3.4. Die Bedeutung des FFG
Als FFG bezeichnet man die Rechtsgrundlage für die deutsche Filmförderanstalt, die wiederum ein Instrument zur Förderung der „Qualität des Deutschen Films als Voraussetzung für seinen Erfolg im Inland und Ausland“[44] darstellt. Doch nicht nur die auf Kino-Spielfilme ausgerichtete FFA nimmt das FFG als Grundlage, auch die Länderförderungen wie der FFF Bayern oder die Film- und Medienstiftung NRW verwenden das Bundesgesetz als Ergänzung zu ihren jeweiligen Richtlinien. Das FFG und damit auch seine Regelungen der Sperrfristen gelten also für alle mit deutschen Bundes- oder Landes-Fördermitteln produzierten Filme.
Bei der letzten Novellierung im Januar 2014 gab es eine signifikante Neuerung: „Um dem geänderten Nutzerverhalten Rechnung zu tragen“[45], wurde die Sperrfrist für Video-on-Demand-Angebote um drei Monate verkürzt und mit der Sperrfrist für die DVD-Auswertung gleichgesetzt. Diese Verkürzung stellt ein eindeutiges Signal in Richtung der Anerkennung der medialen Entwicklung dar. „Die neuen Medien erfordern nicht nur ein viel kürzeres Umdenken, sondern sie geben auch hier das Tempo vor.“[46], meint Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien a. D. und aktueller Präsident der FFA. Die Bundesregierung zeigt, dass sie sich des Wandels im Distributionsmodell durchaus bewusst ist, auch wenn sie diesen nicht aktiv vorantreibt, wie es der Wunsch einiger Branchenteilnehmer ist.
3.5. Die Funktionsweise der FFG Sperrfristen
Um einen exklusiven Auswertungszeitraum für das Kino zu sichern, enthält das FFG Sperrfristen, die seit der Erstaufführung eines Films verstrichen sein müssen, bis mit der Auswertung in der nächsten Verwertungsstufe begonnen werden kann.[47]
Die Sperrfristen stellen also einen Schutz für das Kino, beziehungsweise für die jeweils nächste Auswertungsstufe dar. Ein Film darf vor Ablauf der jeweiligen Frist nicht über „Bildträger im Inland oder in deutscher Sprachfassung im Ausland“[48] beziehungsweise nicht im Fernsehen ausgewertet werden. Die einzig mögliche Variante ist also eine ausländische Sprachfassung im Ausland. Nach §20 Abs. 1 des FFG existiert ein sechsmonatiger Exklusiv-Zeitraum für das Kino. Wer einen Film in Deutschland in diesem Zeitraum legal sehen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als ins Kino zu gehen. Bisher gab es anschließend eine Staffelung für physische Bildträger und Online-Abrufdienste. Seit der Novellierung vom 1. Januar 2014 sind diese jedoch gleichgesetzt auf sechs Monate nach Beginn der Kinoauswertung. Ein Jahr später darf frühestens eine Ausstrahlung im Bezahlfernsehen erfolgen und erst ab dem 19. Monat sieht man den Film im frei empfangbaren Fernsehen oder bei unentgeltlichen Abrufdiensten, wobei die Dauer der Fernsehlizensierung Verhandlungssache ist. Branchenüblich sind aber zwei bis fünf Jahre, was einen Gesamtzeitraum von mindestens 42 Monaten ergibt, bevor der Film eine Zweitauswertung durch den Produzenten durchlaufen kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein erklärtes Ziel der FFA unter Präsident Neumann ist es, neue kommerzielle Verwerter wie VoD-Anbieter und Telekommunikations-Unternehmen als Beitragszahler des Fördertopfes zu gewinnen. VoD bedeutet dabei Video-On-Demand, englisch für Video auf Abruf – wozu alle Online-Dienste gehören, die Bildinhalte zum Streamen oder zum Download anbieten. „Schließlich stützt sich das FFG auf den Grundgedanken des Solidaritätsprinzips: Jeder, der vom Film profitiert, muss in Form einer gesetzlichen Filmabgabe zu dessen Entstehung beitragen.“[49] Die Regelungen werden demnach in den kommenden Jahren noch wesentlich verändert und an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden.
3.6. Der Antrag zur Sperrfristenverkürzung
„Sofern filmwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen“[50], kann nach §20 Abs. 2 eine Sperrfristverkürzung erreicht werden, indem ein formeller Antrag gestellt wird, über den ein Fachgremium entscheidet. Die Formulierung „filmwirtschaftliche Belange“ bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Gefahr des Recoupment-Verlusts durch eine Auswertung im jeweils nächsten Medium, bevor der Maximal-Rückfluss im vorhergehenden Medium erwirtschaftet wurde. Da die Filmförderung der gesamten Filmwirtschaft dienen soll, versucht man „negative Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Refinanzierungsinstrumenten“[51] zu minimieren. Wann genau dies so ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Solange ein Film jedoch noch erfolgreich im Kino läuft, ist es im Normalfall nicht sinnvoll, die DVD zu veröffentlichen. Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Verkürzung für Bildträgerauswertung und entgeltliche Videoabrufdienste auf fünf Monate, in Ausnahmefällen auf vier Monate nach regulärer Erstaufführung.
2. Verkürzung für die Auswertung durch Bezahlfernsehen auf neun Monate, in Ausnahmefällen auf sechs Monate nach Beginn der regulären Erstaufführung.
3. Verkürzung für die Auswertung durch frei empfangbares Fernsehen und unentgeltliche Videoabrufdienste auf zwölf Monate, in Ausnahmefällen auf sechs Monate nach Beginn der regulären Erstaufführung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für einen erfolgreichen Verkürzungsantrag muss der Produzent nachweisen, „dass der Verleih sich ausreichend bemüht hat, den Film erfolgreich im Kino auszuwerten und die Auswertung als abgeschlossen angesehen werden kann“.[52] Bei voller Ausnutzung der Verkürzungen kann der Film also frühestens im fünften Monat nach seiner Kinoveröffentlichung auf physischen Bildträgern sowie entgeltlichen Online-Diensten ausgewertet werden, allerdings nur, wenn trotz hinreichender Anstrengungen keine Erlöse mehr im Kino zu erwarten sind, was auf einen absoluten Misserfolg hindeuten würde. In einer Initiative der Piraten-Partei heißt es, hiervon werde „recht häufig Gebrauch gemacht“.[53]
Darüber hinaus gibt es zwei Sonder-Fälle, in denen die Sperrfrist noch weiter verkürzt werden kann. Wenn ein Fernsehveranstalter als Koproduzent agiert und einen gesonderten Antrag stellt ist die frühestmögliche Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen bereits sechs Monate nach Abnahme des Films durch den Fernsehveranstalter erlaubt. Letztere findet im Normalfall weit vor der tatsächlichen Erstausstrahlung statt. Dies ist sicherlich nur dann auch für den Produzenten sinnvoll, wenn der Film eine besondere Aktualität hat und keine längere Auswertung an Kinokassen erwartet wird, wie es bei Dokumentarfilmen vorkommt. In einem einstimmigen Beschluss des Präsidiums kann zudem für Projekte, „für deren wirtschaftlichen Erfolg auf Grund ihrer Konzeption, insbesondere ihres innovativen multimedialen Ansatzes“[54] eine gleichzeitige Vermarktung in mehreren Auswertungsstufen erforderlich ist, entschieden werden, dass die Sperrfristen keine Anwendung finden. Diese Sonderregelung hält das Fenster offen für so genannte Cross-Media-Projekte, die sich über mehrere Medienarten erstrecken und nicht in das normale Schema deutscher Produktionen passen. Dass die Entscheidung einstimmig ausfallen muss, bedeutet, dass es keinen Zweifel geben darf, dass diese Projekte nur so funktionieren. In Deutschland stellen sie aber sicherlich die absolute Ausnahme dar.
3.7. Selbst bestimmte Auswertungsfenster
Filme, die nicht unter Mitwirkung deutscher Fördermittel entstanden sind, sind grundsätzlich auch nicht an die Regelungen des FFG gebunden. Gerade amerikanische Filmverleihe, die in Deutschland eine große Marktmacht besitzen[55], können ihre Filme deshalb vollkommen unabhängig von den traditionellen Auswertungsfenstern positionieren und auswerten. Obwohl in den Jahren 2007 bis 2012 mehr als 70% der Kinobesuche internationalen Filmen zuzurechnen sind, die sich nicht an das FFG halten mussten, wurden zumindest bei erfolgreichen Filmen dennoch ausnahmslos gewisse Fenster eingehalten.[56] In Amerika halten sich Blockbuster durchschnittlich noch 3,2 Monate im Kino,[57] während man hierzulande von etwa vier Monaten spricht.[58] Nach momentanem Stand wird von den Majors bei einem Misserfolg, der sich durch schlechte Ergebnisse in anderen Märkten abzeichnet, zu Gunsten eines schnellen DVD Releases auf eine weiterführende Kinoauswertung verzichtet und der Verkauf in Deutschland vorgezogen.
Obwohl Day-and-date Releases hier theoretisch möglich wären, schaffen solche Filme es in Deutschland zumeist gar nicht auf die Leinwand, sondern werden stattdessen sofort über VoD oder auf DVD angeboten. International wird dies jedoch extrem unterschiedlich gehandhabt: Bereits 2008 setzte Warner beispielsweise in Südkorea auf einen weit vorgezogenen VoD Start von Blockbustern, um die Überhand nehmende Film-Piraterie in den Griff zu bekommen.[59] Nach momentanem Stand gelten solche Praktiken in Deutschland jedoch noch als Experimente. Eine allgemeine Orientierung am amerikanischen System ist klar zu erkennen.
3.8. Kino-Auswertung
„Die Branche definiert sich zuvörderst [sic] über ihr spezifisches Produkt – Kinofilme.“[60] Auch wenn diese im Vergleich zu den 80er Jahren nur noch einen geringen Anteil der Gesamterlöse erzielen, sind sie als Werbeträger immer noch extrem wichtig und damit mehr als nur die erste Station im Auswertungszyklus.[61] Zudem „verfügt das Kino als Genre nach wie vor über faszinierende Mechanismen, die Filme zu Kult und Schauspieler zu Stars machen“[62] und damit ein kompliziertes Geflecht aus Bezügen schaffen, das einen wesentlichen Beitrag zum Gesamt-Erfolg der Branche leistet. Ausnahmslos alle für diese Arbeit befragten Experten erachteten das Kino daher als unabkömmlichen Teil der Auswertungskette. Besonders die Verleiher sind bei ihrer täglichen Arbeit im ständigen Austausch mit den Kinos, die als Distributionspartner einen zumindest indirekten Einfluss auf die Auswertung haben – sie gilt es zu überzeugen, einen Film in ihr Programm aufzunehmen. „In den USA hat das Kino seine Vorreiterrolle sogar wieder ausbauen können, weil die VoD-Umsätze die Einbrüche beim physischen Geschäft nicht annähernd kompensieren.“[63] Meint Dr. Thomas Negele, Vorstandsvorsitzender bei HDF Kino e.V. und gibt damit Hoffnung auch für die deutsche Kinolandschaft.
Dennoch warnt er davor, die Situation zu positiv zu bewerten, da man sich durchaus in einem Konkurrenzkampf mit den Online-Angeboten um das „Zeit- und Geldbudget“[64] des Kunden befinde. „Gab es 2004 noch 1.033 Kinostandorte, sank die Zahl in 2013 bis auf 890. Das ist ein Rückgang um 19%.“[65], ist auf der Webseite der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft zu lesen. Dabei konnte sich der Umsatz an den Kinokassen in den letzten Jahren stetig steigern und erreichte 2013 erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro.[66] Zurückgeführt wird dies jedoch hauptsächlich auf die Zusatzeinnahmen durch 3D und die steigenden Ticket-Preise, denn die eigentlichen Kino-Besuche nehmen immer noch ab.[67]
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es der deutschen Kinowirtschaft nicht schlecht geht und auch wenn die Popularität bei der Bevölkerung bei Weitem nicht so hoch ist, wie beispielsweise in Frankreich, existiert zumindest innerhalb der Branche das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Auswertungsform.
3.9. Bildträger- und VoD-Auswertung
„As well as being a new technology creating a new economy, VoD is above all a new set of emerging practices that must be taken into consideration rather than being treated with contempt.“[68] Dieser Satz im Schlusswort zur Studie der Europäischen Union zu neuen Auswertungsformen weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Technologie und die damit verbundenen Veränderungen des Marktes nicht zu unterschätzen. Während sich die Kinoumsätze zwischen 2000 und 2013 langsam auf erstmals mehr als eine Milliarde Euro beliefen, steigerte sich der Home-Entertainment-Sektor in Deutschland im selben Zeitraum um ganze 88% auf 1,8 Milliarden Euro. Mit einem Umsatz-Anteil von 65% ist es immer noch der DVD-Verkauf, der den Markt bestimmt und für Umsätze bei den Verleihern sorgt. Dennoch ist ein starker Trend zum digitalen Abruf auszumachen, der sich innerhalb nur eines Jahres von 7% auf 9% steigern konnte. Da die größte Gewinnmarge aber mit dem Verkauf gemacht wird, tendieren Verleiher besonders bei wenig erfolgreichen Filmen dazu, den Verkaufsstart immer weiter nach vorne zu ziehen und wie zuletzt von 20th Century Fox versucht, sogar vor den Verleihstart in Videotheken zu legen.[69] Zwischen 2008 und 2013 haben mehr als ein Drittel der Videotheken in Deutschland geschlossen und Automaten gibt es heute sogar nur noch ein Sechstel so viele.[70] Der Anteil der Videotheken am Recoupment eines Kinofilms ist also radikal geschrumpft – besonders zu Gunsten der neuen Auswertungsformen. Nach aktuellem Stand hat das Home-Entertainment-Geschäft innerhalb der Auswertungskette also die größte Bedeutung für das Recoupment, wobei Videotheken fast keine und VoD-Erlöse nur eine geringe Rolle spielen, während die DVD weiterhin erfolgreich ist.
3.10. Entgeltliche und unentgeltliche Fernsehsender
„Kino und Fernsehen sind heute Geschwister. Sie zanken sich, aber eigentlich gehören sie zusammen.“[71] meint MDR-Intendant Udo Reiter in einem Interview über die Rolle der Sender bei der deutschen Filmproduktion. Ihre Vertreter sitzen in den Bundes- sowie in den meisten Länder-Fördergremien und haben so entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinolandschaft. Als Finanzierungspartner sind öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten wesentlich beteiligt an nationalen Kinoproduktionen.[72] Auch Pay-TV- und Privat-Sender sind in der Produktion involviert. Ihr Schwerpunkt liegt dennoch auf Lizenz-Käufen, mit denen sie gerade bei erfolgreichen Filmen einen signifikanten Anteil am Recoupment leisten. Auch wenn sie am Ende der Verwertungskette stehen, sind Fernsehanstalten in Deutschland ein wichtiger Bestandteil des Kino-Systems.
3.11. Aktueller Stand zur Filmpiraterie
„If we’re giving cinemas the chance to make a long run and sell a lot of tickets, what we’re actually doing is creating a gap for piracy.“[73] So beschreibt Time Warner CEO Jeffrey Bewkes die momentane Situation und spricht damit das Problem der Filmpiraterie an, das die Filmbranche bereits seit der Einführung der VHS-Kassette beschäftigt.[74] International gibt es Probleme mit dem Angebot raubkopierter physischer Datenträger, die von unautorisierten Händlern angeboten werden. In Deutschland ist es jedoch besonders die Internetpiraterie, die sich nicht zuletzt durch die problemlose und von staatlicher Seite kaum zu ahndende Verfügbarkeit etabliert hat und der Branche beträchtlichen Schaden zufügt.
Die tatsächlichen Gründe für den Konsum von qualitativ meist minderwertigen Raubkopien werden immer wieder diskutiert. Viele sehen jedoch „die langen Fristen von der Veröffentlichung von Filmen bis zur legalen Erwerbsmöglichkeit“[75] als Hauptursache für die Verbreitung dieser Praxis. Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer der Cineplex Deutschland GmbH ist der Meinung: „Es scheint als habe man den Kampf gegen die Piraterie aufgegeben und um deren Auswirkungen gering zu halten, will man nun das Fenster zurückfahren – eine fatale Haltung.“[76] Zwar kann die Filmindustrie immer wieder Erfolge auf gesetzlicher Ebene verbuchen, letztlich gestaltet sich die tatsächliche Eindämmung durch strafrechtliche Verfolgung aber immer noch sehr schwierig. Auf die Abmahnung von Nutzern illegaler Inhalte spezialisierte Anwaltskanzleien setzen auf die „Zusammenarbeit mit renommierten Technologiepartnern bei der Ermittlung und forensischen Beweissicherung von Rechtsverletzungen“[77]. Über Drittanbieter werden die IP-Adressen illegaler Anbieter oder Nutzer ermittelt, die über eine Anfrage beim Provider zum Anschluss-Inhaber führen. Auf diese Weise wurden in den letzten Jahren insgesamt 4 Millionen Deutsche abgemahnt, was Verleihunternehmen jährlich siebenstellige Beträge einbringt.[78]
Schwieriger sieht es bei den Betreibern der illegalen Webseiten aus. Diese können durch die unstimmige internationale Rechtslage entweder nicht belangt werden oder sind überhaupt nicht fassbar, da ihre Datenzentren weltweit verteilt liegen. Ein Erfolg war dahingehend eine aktuelle Entscheidung des EuGH zur verpflichtenden Sperrung von Plattformen mit illegalen Inhalten durch die Internetanbieter.[79] Dennoch hat sich das Problem in den letzten Jahren kaum gebessert. Laut einer Umfrage vom April 2014 unter Fachpublikum stimmten bei der Frage, wie groß das Problem Online-Filmpiraterie sei, immer noch 55% mit „Riesig, wer illegale Downloads will, findet sie nach wie vor“.[80] Dabei ist besonders auffällig, wie sich Internetseiten und Anbieter raubkopierter Filme immer weiter weg vom Download über ein P2P Netzwerk und hin zu einer User-orientierten, perfekt designten Benutzeroberfläche bewegen. Der open source media player Popcorn-Time[81] beispielsweise steht in seiner Bedienfreundlichkeit und der visuellen Präsentation legalen Anbietern wie maxdome oder iTunes in nichts nach. Unterschiede bestehen in der Illegalität und der mäßigen Qualität des Contents – und darin, dass Nutzer des Programms ohne ihr Wissen in das illegale Netzwerk integriert und zu Anbietern gemacht werden, was in Hinblick auf die geltende Rechtslage ein schweres Vergehen darstellt. Die Qualität steigert sich dabei beständig, sowohl was das Bild als auch was den Ton angeht. Zwar sind mit kino.to, movie2k, gwarez und 1load einige der in Deutschland bekanntesten illegalen Portale mittlerweile offline, ihre Nachfolger erfreuen sich jedoch immer noch größter Beliebtheit.[82]
Wie viel Schaden tatsächlich durch Piraterie entsteht, ist umstritten. Eine neue Studie geht von einem etwa 19% schmäleren Boxoffice aus, wenn Filme bereits vor Kinostart im Netz zu finden sind.[83] Das wäre ein jährlicher Verlust von vielen Millionen Euro für die deutsche Filmwirtschaft. Gleichzeitig gibt es jedoch immer wieder Experten, die einen raubkopierten Film als Marketing-Tool befürworten. Dies kann jedoch nicht pauschalisiert werden. Auch, wenn es im Einzelfall zutrifft, dass Mund-zu-Mund Propaganda im Netz die Kinoauswertung positiv beeinflusst, hat die Filmpiraterie generell eine eher negative Auswirkung.[84] Fest steht, dass sie nach momentanem Stand immer noch eine Rolle spielt und bei Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung des Distributionsmodells beachtet werden sollte.[85]
Das deutsche Distributionsmodell hat in den letzten Jahren einige signifikante Entwicklungen durchlaufen, deren Abschluss noch in weiter Ferne liegt. Auch wenn sich diese für die Branchenmitglieder sehr unterschiedlich auswirken, ist die Branche im Allgemeinen funktionstüchtig und intakt.
4. Entwicklungstendenzen der Branchen-Umwelt
„The film industry is going through a period of far-reaching change during which its business models will no doubt have to evolve.“[86] Um herauszufinden, wohin sich die Geschäftsmodelle gerade entwickeln, müssen die wichtigsten Einflussgrößen, die für die Veränderungen verantwortlich sind, identifiziert werden. Diese umfassen einerseits die Aspekte der Makro-Umwelt, die das gesamte Geschäftsumfeld tangieren. Andererseits gehören dazu die Aspekte der Mikroumwelt, die sich aus den einzelnen Branchenmitgliedern zusammensetzt, welche sich mit ihren unabhängigen Entscheidungen und Bestrebungen gegenseitig beeinflussen. Die folgende Auflistung verzichtet auf eine konkrete Unterscheidung und geht vielmehr nach Themengebieten vor, in denen akute Veränderungen zu beobachten sind.
4.1. Digitalisierung und Internet
„Je nach Produkten oder Dienstleistungen treten insbesondere durch die technologischen Entwicklungen in den einzelnen Marktsegmenten starke Veränderungen auf.“[87] Wie in diesem Punkt erläutert werden soll, trifft dies auf die Filmbranche in besonderem Maße zu und macht den technologischen Fortschritt zum wahrscheinlich wichtigsten Makro-Einfluss. In der Filmherstellung hat die Digitalisierung zu einer Vereinfachung von Dreh und Postproduktion geführt. Digitale Kino-Kameras haben den 35mm Film beinahe ersetzt und beständig erscheinen verbesserte Versionen auf dem Markt. Digitale visuelle Effekte werden seit mehr als zwanzig Jahren verwendet, um Filme aufzuwerten und haben mit den dazugehörigen Studios eine ganz eigene Branche inklusive einer Reihe neuer Berufsbilder hervorgebracht, die heutzutage nicht mehr aus der Filmwirtschaft wegzudenken sind. In den Kinos ist die Digitalisierung der Kinoprojektoren nach Stand 2014 zu 95% vollzogen.[88] Die Einführung von DCPs hat die Distributionskosten für den Verleih signifikant reduziert und dazu geführt, dass auch kleinere Kinos leichter an Filmkopien kommen, da sie nicht mehr warten müssen, bis sie eine nicht mehr gespielte Rolle aus einem größeren Kino bekommen. Dies hat auch einen maßgeblichen Einfluss auf den Zeitfaktor – Filme durchlaufen ihre Auswertungszeit erheblich schneller, als vor der Digitalisierung.
Der Markt für entgeltliche Videoabrufdienste im Netz ist verhältnismäßig neuer Vertriebsweg und existiert erst seit der Etablierung des Internets. Je weiter die VoD-Angebote wachsen, desto mehr geraten traditionelle Videotheken unter Druck. „Es wird immer ein paar Leute geben, die bei uns DVDs leihen, wenn man eine gute Auswahl hat und ein bisschen Rahmenprogramm macht.“[89] Meint Herr E., Besitzer einer Münchner Videotheken-Kette, und räumt seiner Branche damit Chancen auf einen konstant kleinen Marktanteil ein. Wie klein dieser jedoch ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Auch wenn deutsche Anbieter bereits erhebliche Investitionen in neue Abo-Modelle getätigt haben und auch ausländische Anbieter wie Netflix auf den Markt drängen, meint Andreas Heyden, Geschäftsführer der Onlinevideothek maxdome, in einem aktuellen Interview: „Es ist noch viel Luft nach oben, denn VoD ist in Deutschland noch nicht so etabliert wie in den USA oder UK.“[90] Die Entwicklung ist in diesem Segment also bei weitem noch nicht abgeschlossen.
4.2. Home-Entertainment versus Kinoerlebnis
Die Frage, ob der Home-Entertainment Markt sich gegenüber dem Kino komplementär oder substituierend verhält, ist unter Experten umstritten. Eckhard Wendling sieht „das Verhalten der Zuschauer, die oftmals von Kinogängern zu ambitionierten Cineasten im eigenen Home-Entertainment geworden sind“[91], als einen signifikanten Grund für die zunehmende Verkürzung der Auswertungsfenster. Der Münchner Institutsdirektor für Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Thomas Hess hingegen bemerkt keine eindeutige Tendenz zur Kannibalisierung der Auswertungsformen.[92] Home Cinema wird seiner Meinung nach „nur eine geringe Substitution der Kinobesuche zur Folge haben."[93] Fest steht, dass die technologische Entwicklung der Sektoren Home-Cinema und Kino in den letzten Jahren ebenso schnell vorangeschritten ist, wie die der Filmproduktion und neue Qualitätsstandards in der Herstellung haben eine Wechselwirkung mit den Standards der Abspielgeräte. Abgesehen von der bereits erwähnten Digitalisierung der Kino-Projektoren legte James Camerons Avatar[94] den Grundstein für den Hollywood-Trend, Blockbuster im 3D-Format anzubieten. Dies brachte und bringt den Kinobesitzern, die ihre Säle dementsprechend aufgerüstet haben, ein Einnahme-Plus und stellt für viele Zuschauer einen Mehrwert dar.[95] Dazu hat sich auch der Ton in mehreren Schritten weiterentwickelt und mit dem Dolby-Atmos-System zuletzt eine signifikante Aufwertung erfahren. Die Verbesserung des Angebots und der Abspielqualität in Kinos ist also konstant fortgeschritten und wird dies auch in Zukunft tun.
Seit der Einführung der VHS-Kassette haben sich jedoch auch im Home-Entertainment-Bereich Ton- und Bildqualität bei sinkenden Preisen kontinuierlich verbessert. Nach der Einführung der DVD wurden mit der Blu-ray Filme erstmals für ein Massenpublikum in High Definition angeboten. Die 1920 Pixel Bildbreite des HD Standards kommen dabei den 2000 Pixeln Bildbreite, die den aktuellen DCI-Standard für digitales Kino darstellen, extrem nahe. Zudem etablieren sich zunehmend Heim-Projektoren und kostengünstige Großbild-Fernseher, die das Erlebnis der Kinoleinwand zwar nicht substituieren, aber imitieren. Neuere Modelle sind oft sogar 3D-fähig und machen auch in dieser Hinsicht dem Kino Konkurrenz. Durch die flächendeckende Internet-Verfügbarkeit sind physische Datenträger und passende Abspielgeräte ohnehin optional – dem VoD-Markt ist der Weg ins Wohnzimmer geebnet. „PriceWaterhouseCoopers prognostiziert, dass die digitale Distribution im Jahr 2018 an DVD und Blu-ray vorbeiziehen wird.“[96] Doch damit ist die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. „Nach DVD, Blu-ray und 3D soll nun 4K bzw. Ultra-HD der neue Heimkinotrend werden.“[97] Bereits seit Frühjahr 2014 bietet Netflix neben der eigenproduzierten Serie „House of Cards“[98] auch eine Reihe von Natur-Dokumentationen in dem neuen Format an, während nur ein kleiner Prozentsatz der Kinosäle in Deutschland bisher in 4K abspielt.[99],[100] Hier sieht Vorstandsvorsitzender von HDF Kino e.V. Dr. Thomas Negele den großen Nachteil der Kinos gegenüber Anbietern wie Netflix: „Die liefern nur den Content, der User muss für das Equipment sorgen.“[101] Auch wenn der Content für 4K-Home-Media momentan noch Mangelware ist, deutet alles auf die Entwicklung eines neuen Blu-ray Formats mit noch mehr Speicherplatz hin, sodass 3D-Filme theoretisch sogar in HFR, also erhöhter Bildfrequenz und damit verbesserter Qualität abgespielt werden können, was auch für Kinos noch eine Ausnahme darstellt. Eine Verbesserung soll dabei auch für den Ton stattfinden und im Juni 2014 kündigte Dolby die Entwicklung des in deutschen Kinosälen ebenfalls seltenen Dolby Atmos für das Wohnzimmer an.[102]
Insgesamt schreitet der Home-Entertainment-Bereich rasant voran und rückt auch bei moderater Kunden-Investition dem sich vergleichsweise langsam steigenden Qualitätsstandard vieler Kinos immer näher.
4.3. Experimente zu alternativen Release-Strategien
Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, erfolgt die Auswertung eines Films als Zusammenspiel mehrerer Branchen-Sparten. In Deutschland ist es zumeist der Verleih, der sich verantwortlich zeichnet für die strategische Platzierung und das optimale Marketing eines Produkts, um den eigenen Gewinn und damit zumeist auch den Gewinn für den Produzenten zu maximieren. Selbstverständlich profitieren von gutem Marketing aber auch alle anderen an der Verwertungskette Beteiligten vom Video-Verleih bis hin zum Free-TV Sender.
Der wohl radikalste Ansatz zur Veränderung dieses historisch gewachsenen Auswertungsprozesses ist der sogenannte Day-and-date Release. Die Auswertung des Films beginnt dabei in mehreren Auswertungsstufen gleichzeitig – klassischer Weise im Kino und auf VoD-Plattformen und damit auf allen mobilen Endgeräten. Der Ansatz zielt also darauf ab, zeitliche, territoriale oder mediale Beschränkungen außer Acht zu lassen und die Kanäle, in denen ein Konsument potentiell am meisten für das Produkt zahlt, gleichzeitig zu bedienen. Ähnliche Experimente gibt es zum so genannten Premium-VoD: Den Film „Welcome to New York“[103] gab es beispielsweise nicht im Kino zu sehen, sondern nur zum Download zu einem Preis von sieben Euro.[104] Die Ansichten innerhalb der Branche zu diesem Thema sind extrem gespalten. Dennoch wird aktuell weiter diskutiert und nach neuen Möglichkeiten geforscht. „Rather than undercutting its theatrical release, its VoD availability and the resulting buzz it created is credited with giving the movie a boost in theaters.“[105], schreibt der Hollywood Reporter über den Film „Margin Call“[106], der 2012 mit seinem Day-and-date Release für Aufsehen sorgte. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat das europäische Parlament kürzlich mit großem finanziellem Aufwand eine Studie zu diesem Thema in Auftrag gegeben und wurde dabei von Teilen der europäischen Verwertungsindustrie unterstützt. „New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?“[107] sollte neue Distributionswege auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüfen, wobei neun Filme in 15 Territorien untersucht wurden. Von den insgesamt 86 Veröffentlichungen waren 39 als Day-and-date Releases im Kino und auf VoD-Plattformen zu sehen. Eine eindeutige Schlussfolgerung gibt es jedoch nicht und so titelt die Fachzeitschrift Blickpunkt:Film: „Debatte um Simultanstarts bleibt ohne Ergebnis“[108]. Der Abschlussbericht vom Mai 2014 präsentierte vornehmlich die positiven Ergebnisse der Studie, während Verbände wie die AG Kino-Gilde starke Kritik äußerten und sie in Frage stellten.[109] „Ich halte diese Initiative ehrlich gesagt für einen Skandal. Meiner Ansicht nach wird von EU-Seite viel zu leichtfertig mit diesem Thema umgegangen.“[110] meint beispielsweise Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer der Cineplex Deutschland GmbH. Die Einschätzung der Studie zu ihrer eigenen Bedeutung verhält sich anders: „These experiments do not seem to endanger the economics of cinema in Europe. They will no doubt help it to adapt to these changes.“
Man kann trotz der Kritik davon ausgehen, dass die Experimente zu neuen Auswertungsformen weitergehen und sogar ausgeweitet werden, umfassende Day-and-date Releases „wird es aber in nächster Zukunft bei uns nicht geben.“[111]
4.4. Die Politik der Majors
International erfolgreiche Blockbuster aus den Vereinigten Staaten werden im Wesentlichen von einer kleinen Anzahl an Studios produziert, die auch Majors genannt werden. Diese sind nach momentanem Stand 20th Century Fox, Walt Disney Studios, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros und Universal Studios. Ihr Einfluss, besonders auf die europäischen Kinomärkte, ist enorm. „Wir haben seit vielen Jahren 80 Prozent Marktanteil für Hollywood-Produktionen. Das ist zu viel!“[112], meint Wolfgang Börnsen, Kultur und medienpolitischer Sprecher der CDU/CSU- Fraktion in einem Interview. Jede Veränderung in der Studiopolitik hat demnach auch Relevanz für die Industrie hierzulande. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von VoD: „Die Studios in den USA stehen unter dem Zwang, einen massiven Einbruch beim physischen Home-Entertainment-Geschäft zu kompensieren, weshalb die digitale Distribution derart gepusht wird.“[113] Auch wenn keine konkreten Zahlen vorliegen, gehen viele Experten davon aus, dass diese noch keineswegs rentabel ist, was Time Warner CEO Jeffrey Bewkes in einem Interview bestätigte.[114] Angebote großer Unternehmen in Deutschland, wie zum Beispiel maxdome oder Lovefilm, stellen demnach vermutlich einen Versuch dar, zukünftige Markanteile zu sichern und müssen ihre tatsächliche Wirtschaftlichkeit erst noch beweisen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass sich die internationalen Bemühungen und Investitionen um Marktanteile in dem rasch wachsenden Segment in Zukunft noch steigern werden. Ähnlich sähe es bei einer flächendeckenden Einführung von Day-and-date Releases in den Vereinigten Staaten aus. Ungeachtet der Gefahr eines Gewinneinbruchs müssten Unternehmen auf dem deutschen Markt folgen und der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen anpassen, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Verleihe und Produzenten nicht weiter einzuschränken.
Dass amerikanische Majors schwache Filme teilweise schon nach wenigen Wochen aus dem Kino abziehen und Produktionen, die sich in anderen Territorien als Misserfolg herausgestellt haben, sogar direkt auf Datenträgern oder über Bezahldienste vermarkten können, stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber deutschen Produktionen dar. Geförderte Filme müssen sich in jedem Fall an die Vorschriften des FFG halten und können die Vermarktung nur im Rahmen der in Punkt 3.5. beschriebenen Sperrfrist-Verkürzungs-Regelungen flexibilisieren. Die Politik der Majors hat also nicht nur auf Grund ihrer Marktmacht, sondern auch durch die besondere gesetzliche Stellung einen wesentlichen Einfluss auf die deutsche Filmbranche, der sich in Zukunft auf Grund ihrer Kapitalmacht tendenziell eher ausweiten wird.
4.5. Entwicklung neuer Endgeräte
Die Anzahl der Bildschirme, über die man in Deutschland täglich visuell angesprochen wird, hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Es wird immer selbstverständlicher, dass man an öffentlichen Orten oder in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen, Zügen, Bussen, U-, S- und Tram-Bahnen Bewegt-Bilder findet. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, an all diesen Orten über tragbare Geräte selbst bestimmten Content zu konsumieren. Bereits 2012 war die Anzahl von einer Milliarde Smartphone Nutzern erreicht und bis Ende 2015 soll sie sogar die zwei Milliarden Marke überschreiten.[115] Mehr als ein Viertel der Menschheit hätte demnach ein Mobiltelefon mit Möglichkeit zum Abspielen von filmischem Content.
Darüber hinaus hat sich der deutsche Tablet-Markt seit 2014 endgültig zum Massenmarkt entwickelt. Selbstverständlich werden auch Tabletop Systeme zum Konsum von Medien verwendet, Tablets und Laptops unterscheiden sich aber hinsichtlich der Nutzungsschwerpunkte, die bei den transportablen Geräten stärker vom Video-Konsum geprägt sind.[116] Die hohe und immer noch wachsende Anzahl an Abspielgeräten geht einher mit einer steigenden Nachfrage nach Content. Auch wenn dieser neben Kinofilmen aus einer Vielzahl anderer Content-Arten wie Games, Nachrichten und Serien besteht, ist das dennoch ein gutes Zeichen für die Filmwirtschaft.
4.6. Politisch-rechtliche Entwicklungen auf europäischer Ebene
Wie auch andere Waren und Dienstleistungen unterliegen audiovisuelle Medien – Film, Fernsehen, Video, Radio – bestimmten EU-weit geltenden Regeln, die gewährleisten, dass sie im europäischen Binnenmarkt unabhängig vom Übertragungsweg [...] zu einheitlich fairen Bedingungen frei zirkulieren können.[117]
Mit dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenwachsen und der Erweiterung der Europäischen Union gewinnt der gesamteuropäische Binnenmarkt gegenüber dem nationalen Binnenmarkt für die Filmbranche zunehmend an Bedeutung. Dabei ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Ziel festgelegt, „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt“[118] zu leisten.
Dies äußert sich in den europäischen Förderungen MEDIA und EURIMAGES, die die langfristige Bildung von europäischen Kooperationen zum Ziel haben, sowie einer Reihe von Richtlinien zur Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten.[119] Letztere haben unter anderem den Zweck, vergleichbare Bedingungen für neue audiovisuelle Medien in allen Ländern zu schaffen und den Medienpluralismus zu sichern. Dabei werden den nationalen politischen Organen jedoch große Spielräume gelassen. In einem aktuellen Fall wandte sich deshalb der Oberste Gerichtshof in Österreich an den EuGH, mit der Bitte, „einige Fragen zu anzuwendenden EU-Vorschriften zu beantworten“[120]. Konkret ging es dabei um strafrechtliche Konsequenzen und Befugnisse bei der Sperrung von Webseiten, die illegalen Content anbieten, was die wachsende Bedeutung der gesamteuropäischen Rechtsprechung deutlich herausstellt. Zudem gibt es Anstrengungen, den europäischen Filmmarkt und seine Funktionsweise zu überprüfen: „Increasing the number of experiments in this framework will make it possible to relax the rules and adjust them to the specific requirements of each work, while maintaining an overall balance within the system.“[121], heißt es dazu in der Zusammenfassung der aktuellsten Studie „New Approaches for greater Diversity of Cinema in Europe?“.
Auch wenn eine Entwicklung zum europäischen Binnenmarkt stark umstritten ist[122], steigen die Bemühungen der Europäischen Union, gute Bedingungen für einen film-kulturellen Raum zu schaffen, der sich vom amerikanischen Konkurrenzmarkt abhebt. Weitere gesetzliche Entwicklungen in dieser Richtung sind zu erwarten.
4.7. Politisch-rechtliche Entwicklungen auf nationaler Ebene
Auf nationaler Ebene nimmt der Gesetzgeber vor allem durch das bereits in Punkt 3.3. behandelte FFG Einfluss auf die Filmbranche. Veränderungen desselben werden seit der letzten Novellierung im Dreijahres-Takt durchgeführt, wobei die politische Arbeit der Filmwirtschaft sicherlich entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung haben wird.
Der zweite Sektor, auf den der nationale Gesetzgeber wesentlichen Einfluss hat, ist die in Punkt 3.10. angesprochene strafrechtliche Verfolgung von Internet-Piraterie. Hierbei sorgte zuletzt das so genannte Anti-Abzock-Gesetz der damaligen Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger für Aufsehen in der Branche, da es nicht zum Schutz der Filmindustrie vor Piraterie, sondern zum Schutz der Verbraucher vor überzogenen Anwaltsgebühren gedacht war. Dass dieses seinen Zweck weitgehend verfehlte, zeigt sich an der immer noch florierenden Abmahn-Praxis einiger Kanzleien.[123]
Doch auch, wenn die für das Gesetz verantwortliche FDP nicht mehr im Bundestag und in der Bundesregierung ist, kann davon ausgegangen werden, dass mit zunehmender Relevanz des Themas auch auf nationaler Ebene weitere gesetzliche Regelungen mit weitreichenden Konsequenzen für die zukünftige Entwicklung der Filmbranche getroffen werden.
4.8. Entwicklung der Filmpiraterie
Wie bereits in Punkt 3.10. beschrieben, stellt die Filmpiraterie immer noch ein wesentliches Problem und damit einen Einflussfaktor auf die zukünftigen Entwicklungen des Distributionsmodells dar. Doch auch wenn die strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urhebergesetz durch das Angebot oder den Download von Filmen in den letzten Jahren stark zugenommen hat, hat dies auf die tatsächliche Aktivität der File-Sharer nur bedingten und nicht nur positiven Einfluss. Der amerikanische Rechtsanwalts-Verband American Bar Accociation – einer der größten Berufsverbände weltweit – warnt mit einem im Juli 2014 veröffentlichten Artikel: „The [American Bar Association] does not believe that legislative action directly targeting consumers would prove effective in reducing piracy or counterfeiting at this time.“[124] Im Einklang mit dieser Aussage schrecken amerikanische Majors vor einem massenhaften Verklagen von File-Sharern bisher zurück. Gibt es keine signifikanten Veränderungen in der internationalen Distribution, kann wohl auch in Zukunft mit einem starken illegalen Markt gerechnet werden, wobei sich dessen Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Angebot stetig verbessern.
Die behandelten Einflussfaktoren auf die Branchenumwelt zeigen deutlich in Richtung einer weiter fortschreitenden Digitalisierung und technologischen Entwicklung, wobei Gesetzgeber auf nationaler und europäischer Ebene zwar mit einer gewissen Verzögerung aber durchaus engagiert auf die Entwicklungstendenzen reagiert.
5. Entwicklung von Szenarien
Um aus den unterschiedlichen und teils gegensätzlichen Entwicklungstendenzen eine realistische Zukunftsaussicht erarbeiten, werden nun nach Anleitung Prof. Dr. Bernhard Ungerichts alternative Annahmebündel in Form von zwei Extremszenarien erstellt, aus denen ein Trendszenario abgeleitet werden soll. Auf Basis der bisherigen Kenntnisse gibt es zwei extreme Richtungen, die in den folgenden Punkten erläutert werden sollen:
1. Das Ubiquitätsmodell. Es erfolgt eine radikale Veränderung des Fenster-Modells und Veröffentlichungen in mehreren Medien zugleich werden die Regel. Kaum ein Film ist noch exklusiv im Kino zu sehen.
2. Beibehaltung der aktuellen Auswertungsfenster und Sperrfristen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen bleiben auch in Zukunft weitgehend auf ihrem heutigen Stand. Nur wenige Filme bilden Ausnahmen.
5.1. Szenario 1: Das Ubiquitätsmodell
„What’s good for consumers has to be the priority.“[125] Dieser Ausspruch von Time Warner-CEO Jeffrey Bewkes deckt sich in etwa mit dem deutschen Sprichwort „Der Kunde ist König“ und damit auch mit der gestellten Forderung von Prof. Dr. Hennig-Thurau nach einem so genannten Ubiquitätsmodell, in dem die Verfügbarkeit von Filmen ohne Einschränkungen gewährleistet wird. Der wirtschaftliche Begriff Ubiquität kommt dabei vom lateinischen „ubiquitas“, was mit Allgegenwart zu übersetzen ist.[126] „Die Konsumenten als Content-Abnehmer wollen diese Veränderung und fordern sie massiv, nicht selten auch mit drastischen Methoden.“[127] Nach Meinung von Bewkes ist dabei die Art, wie genau die Bilder auf den Bildschirm kommen und wie hoch die Qualität ist, dem durchschnittlichen Konsumenten weitgehend egal, was auch einen Grund für die ausufernde Piraterie darstelle.[128]
Für das Szenario 1 wird von einem Ubiquitätsmodell in Form einer internationalen Durchsetzung und umfassenden Einführung von Day-and-date Releases innerhalb einer sehr kurzen Periode von wenigen Jahren ausgegangen. Dies schließt mit ein, dass die momentan existierenden Sperrfristen durch das FFG in der kommenden Novellierung vollkommen abgeschafft werden und demnach nach amerikanischem Vorbild keine Restriktionen für die Verwertung von deutschen Kinofilmen mehr existieren. Auch wenn die Mehrheit der Experten davon ausgeht, dass dieses Szenario nicht eintritt, hat eine Entwicklung in diese Richtung nicht zuletzt durch die bereits erwähnten Anstrengungen der Gesetzgeber an Wahrscheinlichkeit zugenommen. Die große Hoffnung ist, dass das breite Angebot auch zu einer erhöhten Zahlungsbereitschaft beim Kunden führt.
Konkret würde dies bedeuten, dass ein Kinofilm direkt zu Beginn seiner Kinoauswertung im Pay-TV und online zu sehen ist. Einzig unentgeltliche Modelle wie Free-TV dürfen erst später ausstrahlen. Abgesehen davon darf es jedoch keine territorialen oder medialen Einschränkungen geben. Unterschiedliche Qualitätsstufen und Sprachfassungen müssen genau wie Untertitel verfügbar sein. Wer den Film zudem kaufen will, soll dies in Form einer digitalen Kopie als auch eines physischen Datenträgers können.
Das Ubiquitätsmodell stellt also quasi das Utopia für Endnutzer dar – Kinofilme sind ohne Zeitverzögerung in beinahe allen Kanälen zugänglich.
5.2. Szenario 2: Beibehaltung der aktuellen Auswertungsfenster und Sperrfristen
Der Begriff Extremszenario ist für das zweite Szenario auf den ersten Blick unpassend, denn es wird dabei davon ausgegangen, dass sich an den bestehenden Regelungen und Gegebenheiten auch in Zukunft kaum etwas ändert. Begreift man jedoch, dass beinahe alle in dieser Arbeit behandelten Faktoren auf eine langfristige Veränderung hindeuten, kann eine Nicht-Veränderung der aktuellen Situation als eher unwahrscheinlicher Extremfall bezeichnet werden.
In diesem Szenario ändern sich die Auswertungsfenster in ihrer heutigen Form nicht mehr und Experimente zu Day-and-date Releases werden aus diversen Gründen vollkommen eingestellt. Die Sperrfristen in Deutschland bleiben in ihrer jetzigen gesetzlichen Form erhalten und alle Branchenteilnehmer arrangieren sich mit dem Auswertungszyklus in seiner jetzigen Form.
Konkret würde das bedeuten, dass ungeachtet des Konsumentenanspruchs und sich verschiebender Marktanteile einzelner Branchenteilnehmer ein Film nach seiner exklusiven Kinoauswertung die aktuell übliche Verwertungskette vom Verkauf physischer Datenträger, über entgeltliche Videoabrufdienste bis hin zu unentgeltlichen Abrufdiensten durchläuft, bevor eine Zweitauswertung stattfinden kann. Dieses Modell funktioniert seit den 80er Jahren hervorragend und trotz aller Kritik ist die Chance gegeben, dass es in seiner jetzigen Form noch viele weitere Jahre funktionieren könnte. Auch die Piraterie würde wahrscheinlich in ihrer Bedeutung gleich bleiben oder je nach Erweiterung des Online-Angebots leicht ab- oder zunehmen. Letztlich ist sie, wie Herr F. es formuliert, „nichts, was ein Geschäftsmodell zur Auflösung zwingen könnte.“
5.3. Trendszenario: Individualisierung, Flexibilisierung und Verkürzung der Auswertungsfenster
Betrachtet man nun die beiden Extremszenarien unter Einbeziehung der Expertenmeinungen und des examinierten Untersuchungsfeldes, so lässt sich eine Tendenz zu einer weiter fortschreitenden Flexibilisierung der Auswertungskette in Deutschland und damit eine Anpassung an das sich ebenfalls weiterentwickelnde amerikanische Modell erkennen.
Beinahe alle Experten befürworten eine individuellere Produkt-Auswertung, um jeweils noch bessere Ergebnisse zu erzielen und die Platzierung zu optimieren. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Film erfolgsabhängig entweder schon wenige Wochen nach Kinostart als Datenträger und auf entgeltlichen Abrufdiensten angeboten werden kann oder eine lange und ausgedehnte Kino-Auswertung ohne Parallelangebote bekommt, bevor er irgendwann zum nächsten Schritt übergeht. Je nachdem ob Verleihe dies für sinnvoll erachten, ist auch eine gleichzeitige Kino- und Datenträger- beziehungsweise VoD-Auswertung denkbar. Wie bereits beschrieben, ist diese Art der individuellen und erfolgsabhängigen Vermarktung von Filmen in vielen amerikanischen Unternehmen, allen voran den US-Majors, bereits die Regel. Kostenintensive und erfolgreiche Blockbuster wertet man auch dort noch nach dem traditionellen, in Deutschland üblichen Schema mit Exklusiv-Fenstern für das Kino aus, während Filme, die im amerikanischen Markt gefloppt sind, hierzulande oft direkt auf Datenträgern und Abrufdiensten erscheinen.
Abgesehen von der individuellen Auswertung werden sich die momentan üblichen Exklusiv-Fenster für die Kinos verkürzen. Zwar sieht man aus Rücksicht auf bestehende Verwertungsstrukturen und Kino-Besitzer oder aus Angst vor Recoupment-Verlusten auch in näherer Zukunft von internationalen Day-and-date Releases größerer Filme ab, doch Drei-Wochen-Fenster, wie Jeffrey Katzenberg, Chef von DreamWorks Animation sie für das Jahr 2024 voraussieht sind keinesfalls unrealistisch. Der aktuelle Branchenstandard von etwa vier Monaten vom Kinostart bis zur DVD-Veröffentlichung wird bereits seit mehreren Jahren immer wieder von Studios unterschritten.[129] Dennoch sehen viele Verleiher keinen grundsätzlichen Verkürzungsbedarf: „Kein Kino zwingt uns isoliert, die vier Monate einzuhalten, es handelt sich vielmehr um branchenüblichen Umgang miteinander.“[130]
Die FFG Sperrfristen, die für den Großteil der deutschen Produktionen gelten, bilden nach Ansicht einiger Experten in ihrer jetzigen Form einen Wettbewerbsnachteil. Auch wenn sie die Verwertungsstruktur in Deutschland schützen sollen, wird eine Anpassung an die wirtschaftliche Realität gefordert. „Sperrfristen flexibel zu handhaben, unterschiedliche Filme über unterschiedliche Strategien zu verwerten wird längst praktiziert.“[131] Diese Flexibilisierung wird vermutlich in den kommenden Jahren, spätestens zur nächsten Novellierung des FFG, weiter ausgebaut werden. Kreative Ansätze, eine von Herr B. vorgeschlagene besucherbasierte Verkürzungs-möglichkeit[132], die kleineren Filmen helfen und dennoch den Markt für größere Filme regeln würde, sind dabei wünschenswert, aber schwer umzusetzen.[133] „Ich brauche keine Flexibilisierung, ich würde die Sperrfristen schlicht und ergreifend abschaffen.“[134], meint hingegen Herr F. im Interview. Er vertritt die Meinung, dass die Herangehensweise der Langzeit-Auswertung nicht mehr zur heutigen Zeit passe. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die gängigen Möglichkeiten der flexiblen Sperrfristen-Verkürzung weiter ausgebaut werden.
Fest steht zudem, dass durch die weiter fortschreitenden Entwicklungen der Druck auf die Auswertungsfenster insgesamt weiter steigen wird, was letztlich zu einer Verkürzung führen wird. Wie stark diese in den nächsten Jahren voranschreitet und ob es irgendwann tatsächlich zu einer kompletten Abschaffung kommt, ist bei den Experten stark umstritten, denn im extremsten Fall gäbe es besonders einen großen Verlierer: Die Kinos. Ihre Bedeutung für die Branche ist jedoch zu groß, als dass man es sich leisten könnte, keine Rücksicht auf sie zu nehmen, weshalb es aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft einen Schutz in Form einer kurzen Sperrfrist von zwei bis drei Monaten geben wird, bevor Filme gleichzeitig in den verschiedenen Plattformen angeboten werden und zuletzt in unentgeltlichen Fernsehen laufen.
Die drei vorgestellten Szenarien bilden Zukunftsaussichten, die die im Folgenden aufgelisteten Chancen und Risiken für die Filmbranche veranschaulichen und bereits darauf hindeuten, welche Maßnahmen auf Seiten der Filmbranche getroffen werden sollten.
6. Chancen und Risiken einer Veränderung des deutschen Distributionsmodells
Der folgende Punkt beschäftigt sich nach dem Ansatz von Prof. Dr. Bernhard Ungericht mit der Interpretation und Auswertung der ausgewählten Umfeld-Szenarien hinsichtlich ihrer Konsequenzen in Form einer differenzierten Chancen-Risiken-Analyse. Dabei wird zu Beginn ein realistischer Soll-Zustand definiert, der ungeachtet seiner absoluten Erreichbarkeit zumindest angestrebt wird und als Vergleich dient. Die Sortierung erfolgte nicht gesondert nach Chancen und Risiken der Makro- und Mirkoumwelt, sondern nach Themengebieten, in denen diese auftreten. Dabei wurde versucht, nach dem Vorschlag Ungerichts, die „identifizierten Chancen und Risiken hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit [...] und hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit“[135] zu sortieren. Eine Mehrfachnennung einzelner Aspekte ist durch die Überschneidung und enge Verknüpfung der Untersuchungsfelder kaum vermeidbar.
6.1. Soll-Zustand des deutschen Distributionsmodells
„Die Content-Anbieter können nicht alles haben - neue Standards mit geringeren Kosten, höheren Margen und weniger Piraterie und zugleich keinen Konflikt mit bestehenden Vertriebsmodellen.“[136] Ein Zustand, in dem alle Probleme der Filmwirtschaft zur Zufriedenheit aller Branchenmitglieder und der Konsumenten gelöst werden, stellt eine Utopie dar. Dennoch soll an dieser Stelle mit Hilfe von Verallgemeinerungen und unter Berücksichtigung relevanter Einzelinteressen ein Soll-Zustand entwickelt werden, der für einen Großteil der Branche genauso wie für einen Großteil der Konsumenten erstrebenswert ist.
Prof. Dr. Henig-Thurau argumentiert aus der Sicht der Endnutzer und beschreibt den Idealzustand indirekt als denjenigen, in dem Medienprodukte, insbesondere Filme ohne zeitliche, lokale oder mediale Einschränkung zu einem angemessenen Preis verfügbar sind, wobei mediale Verfügbarkeit im Kontext des aktuellen technologischen Standards gesehen werden muss. Dies entspricht zumindest in etwa dem entwickelten Szenario 1, wobei nach aktuellem Stand die Filmindustrie aus diversen Gründen jedoch nicht bereit ist, dieses Angebot bereitzustellen.[137] Zudem fordern Kunden in Bezug auf Kinofilme ein breites Angebot mit interessanten Themen und Storys, Fortsetzungen und einer qualitativ hochwertigen Machart,[138] Produkte also, die abgesehen von einigen Ausnahmen durchwegs teuer in der Entwicklung und Herstellung sind. Um diesen Produktionsaufwand leisten und gleichzeitig Verluste von weniger erfolgreichen Filmen ausgleichen zu können, ist ein langfristig stabiles Geschäftsmodell notwendig, das kalkulierbare, hohe Gewinne abwirft.
Hier stellt sich jedoch das Problem des Arrow-Informations-Paradoxons.[139] Im Wesentlichen ist die Bereitschaft der Kunden, Geld für ein Informations-Produkt auszugeben, verhältnismäßig gering, weil sie dessen tatsächlichen Wert nicht kennen und kein Risiko eingehen wollen. Im Fall des Kinofilms bedeutet das, dass der Eintritts-, Leih oder Kaufpreis ein bestimmtes, niedriges Level nicht überschreiten darf. Erhält der Kunde das Produkt jedoch zur freien Verfügung, wie es zum Beispiel mit Hilfe von Filmpiraterie möglich ist, sinkt seine Bereitschaft, nachträglich Geld auszugeben, gegen Null, denn er hat das Produkt, wenn auch vielleicht in schlechter Qualität, bereits erhalten. Mit Hilfe von Marketingmaßnahmen, Fortsetzungen, Verfilmungen bekannter Stoffe und Faktoren wie bekannte Schauspieler, Produzenten oder Regisseure wird versucht, die Sicherheit auf Konsumentenseite so weit wie möglich zu erhöhen. Dennoch gibt es auf Basis dieses Paradoxons immer wieder Forderungen, das Kino-System umzustellen und an das Free-TV Modell oder gar an das Modell der Internet-Piraten anzupassen, die sich vollständig über Werbung finanzieren.[140]
Abzusehen ist eine solche Markt-Veränderung jedoch nicht und da Kunden nicht zur Investition gezwungen werden können, bleibt bei der Filmauswertung ein erhebliches Risiko auf Seiten der Verleiher und Produzenten. Das wiederum führt dazu, dass Risikominimierung ein wesentliches Interesse der Filmwirtschaft darstellt und zusätzliche Risiken durch Veränderungen des Distributionsmodells extrem kritisch betrachtet werden. Insofern besteht also ein Interessenskonflikt mit dem Anspruch des Kunden nach verfügbarem Content, seiner geringen Bereitschaft zur Investition und dem Streben der Filmindustrie nach einem verlässlichen, rentablen System, in dem jede Sparte ihre Nische hat.
Ein Soll-Zustand, der den beschriebenen Gegebenheiten Rechnung trägt, wäre folgender: Kunden sind bereit, für den Content, den sie bekommen, mehr Geld als momentan üblich auszugeben, um das Risiko der Filmwirtschaft auszugleichen. Diese wiederum verbessert ausgleichend das Angebot und die Verfügbarkeit der Inhalte, um den Kundenansprüchen entgegenzukommen ohne dabei den Bankrott der Kinos zu riskieren, sodass letztlich das Überleben aller Branchensparten bei maximaler Kundenzufriedenheit und minimaler Piraterie gesichert ist. Die Fragen sind nun, wie Kunden dazu gebracht werden können, mehr Geld auszugeben, wie viel Geld das sein müsste und welche sonstigen Maßnahmen notwendig wären, um den Optimal-Zustand des Minimum-Risiko-Filmgeschäfts zu erreichen.
6.2. Vorschläge von Fred Breinersdorfer
Auf der Suche nach einer Distributionsform, die den beschriebenen aktuellen Problemen begegnet, finden sich immer wieder kreative, wenn auch radikale Ansätze, von denen im Folgenden zwei vorgestellt werden sollen. Fred Breinersdorfer, ein bekannter Deutscher Drehbuchautor, Produzent und Anwalt skizzierte 2013 auf der Filmkunstmesse Leipzig eine Idee, die er später in der Süddeutschen Zeitung ausführte. Er will „dem illegalen ein legales Gratisangebot gegenüberstellen"[141]. Dabei sollen Rechteinhaber und Urheber angemessen beteiligt werden.[142] „Wenn die Internetganoven mit Werbung Millionen scheffeln, warum sollte man das Ganze nicht auch rechtmäßig organisieren können?“[143], ist die berechtigte Frage. Seine Kritik zielt darauf ab, dass VoD Plattformen gerade für kleine Filme wenige Chancen bieten. Das große Problem ist dabei die komplizierte Rechteverteilung, die zumeist bereits für die Finanzierung territorial verteilt worden ist. „Jeder hortet exklusiv die eigenen Rechte - und nutzt sie im Zweifel lieber nicht, als sie anderen anzubieten.“[144] Hier sieht Breinersdorfer den Staat in der verantwortlichen Position. Eine umfassende Zwangslizenz, wie sie in anderen Bereichen bereits existiert, würde eine radikale Veränderung des deutschen Distributionsmarktes, aber gleichzeitig auch eine Chance zur Eindämmung der Piraterie und zu Gewinnen für Produzenten kleinerer Produktionen bedeuten. Da der Gesetzgeber in dieser Hinsicht jedoch keine Initiative zeigt, ist dieses Konzept zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch.
Ein weiterer Vorschlag, den Breinersdorfer in der Süddeutschen Zeitung ausführt, ist die Anpassung der Filmwirtschaft an das System der Musikindustrie. Verwertungsgesellschaften sollten dabei einen so genannten "One-Stop-Shop"[145] schaffen, in dem nicht exklusive Lizenzen für Filme erworben und abgerechnet werden können. Damit wäre im Sinne des entwickelten Soll-Zustandes ein breites Feld für legale und kreative Internet-Angebote verschiedenster Art eröffnet, die auf diversen Plattformen mit unterschiedlichen Recoupment-Formen arbeiten und ihre Gewinne anschließend bei der offiziellen Verwertungsstelle abrechnen könnten. Auch hier bietet sich eine große Chance, der Internet-Piraterie mit einem qualitativ hochwertigen, ausdifferenzierten Konzept zu begegnen. Der Aufwand einer Umstellung auf dieses Konzept ist jedoch auch hier zu groß, um eine realistische Alternative zum aktuellen System zu bieten.
6.3. Chancen und Risiken des Superticket-Konzepts
Der befragte Experte Herr D., Geschäftsführer der Xxxxxxx, sieht im Konzept des so genannten Super- oder Megatickets die einzige realistische Chance, wie Kinos an den zukünftigen Einnahmen durch neue Auswertungsformen beteiligt werden können.[146] Dabei handelt es sich um ein Paket, das neben dem Kinobesuch eine digitale Version des Films sowie variierende Extras wie Popcorn oder Merchandising beinhaltet.[147] Im großen Maßstab erprobt wurde das Ganze erstmals 2013 mit dem Blockbuster World War Z[148], wo die für 50$ angebotenen Tickets beinahe vollständig ausverkauft waren.[149] Auch wenn sie letztlich weniger als 5% zu den Gesamteinnahmen von mehr als 200 Mio. Dollar beigetragen haben, kann der Versuch als Erfolg gewertet werden und neben Paramount unterstützen nun auch Warner, Sony und Universal ein vergleichbares Konzept der kanadischen Kette Cineplex.[150]
In Deutschland hingegen hält sich die Begeisterung in Grenzen. Einer aktuellen Blickpunkt:Film Umfrage unter Branchen-Insidern zufolge überwiegen die Skeptiker hierzulande: „24 Prozent lehnen das Konzept ab, da sie der Meinung sind, dass es nur wenige Kunden ansprechen, aber den Druck auf Auswertungsfenster erhöhen würde.“[151] Letzteres zeigt, dass die Befragten die Verkürzung der Auswertungsfenster als Gefahr wahrnehmen. 34,6 Prozent sehen weniger die Vorteile für die Kinos als das Marketing für Digitale Distribution, während nur 17,3 Prozent die Idee für zumindest interessant halten. Knapp ein Viertel der Befragten schließlich befürwortet das Superticket, „da es nicht nur ein Mittel gegen Raubkopien darstellt, sondern den Kinos auch neue Umsatzchancen eröffnet.“[152] Diesen beiden realistischen Chancen steht im Endeffekt nur das Risiko gegenüber, die Entwicklung und Popularität der digitalen Distribution zu beschleunigen, was sich gemäß dem entwickelten Trend-Szenario ohnehin nicht aufhalten lässt und auch nicht unbedingt einen Nachteil darstellt. Ganz im Sinne des geschilderten Soll-Zustands werden die Einnahmen für die Verwerter bei gleichzeitigem Mehrwert für den Verbraucher erhöht, was eine Durchsetzung des Superticket-Konzepts zumindest wünschenswert macht.
6.4. Chancen einer Preisstaffelung
Bei einem Event zur Zukunft des Kinos im Jahr 2013 äußerte Steven Spielberg, einer der erfolgreichsten Hollywood-Regisseure und -Produzenten aller Zeiten, eine Idee, auf die hier nur ganz kurz eingegangen werden soll. Seiner Meinung nach könnte eine Maximierung der Rückflüsse erreicht werden, wenn Kinos und Studios die Eintrittspreise von den Kosten des Films abhängig machten. „You're gonna have to pay $25 for the next 'Iron Man,'[153] you're probably only going to have to pay $7 to see 'Lincoln'[154] "[155]. Rein logisch würde diese Unterscheidung auch in Hinblick auf den Soll-Zustand der erhöhten Ausgaben für Filmprodukte Sinn ergeben, da die Produktionskosten und damit auch der Production Value von Iron Man weder mit politischen Dramen wie Lincoln noch mit durchschnittlichen deutschen Produktionen zu vergleichen sind. Da die Kosten einer Kinokarte für beide jedoch gleich sind, fällt die Entscheidung vielleicht eher auf das Produkt mit dem höheren Wert.
Letztlich lässt sich jedoch kaum einschätzen, ob es sich bei diesem Konzept um eine Chance für kleinere Filme handelt, die durch den vergleichsweise günstigeren Preis an Attraktivität gewinnen, oder ob dies nur dazu führt, dass die Major Studios ihre Gewinne weiter erhöhen, was einen Nachteil für die deutsche Filmindustrie darstellen würde.
6.5. Risiken der Machtausübung durch Branchenführer
Die deutsche Filmwirtschaft besteht aus einer Vielzahl von Branchenteilnehmern unterschiedlicher Größen, die ein kompliziertes Geflecht aus Produktions- und Verwertungs-Einheiten bilden. Beinahe alle großen Firmen, zu denen auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gerechnet werden können, sind in mehreren Branchensparten vertreten. Dazu kommt eine Vielzahl mittelständischer und kleiner Unternehmen, die sich auf ein Segment spezialisiert haben. Die FFA sieht es dabei als ihre Aufgabe, „Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films und zur Verbesserung der Struktur der deutschen Filmwirtschaft zu initiieren und zu unterstützen“[156]. Auch wenn Experten die im FFG geregelten Sperrfristen als nicht mehr zeitgemäß ansehen, gibt es auch Risiken, die bei einer Abschaffung der Sperren eingegangen würden. „Als Sender könnte ich Druck auf Sie als Produzent ausüben, mir den Film zu überlassen, obwohl eine weitere Kinoauswertung noch erfolgreich wäre.“[157], meint beispielsweise der Leiter der BR Redaktion Kinofilm Herr C. Er spricht dabei von dem häufigen Fall, dass sich Länder-Rundfunkanstalten durch ihren Finanzierungsbeitrag bei deutschen Spielfilmproduktionen eine risikoreiche Machtposition erkaufen: „Würde man die gesetzlichen Regelungen vollkommen abschaffen, kann es natürlich sein, dass die Marktführer das ausnutzen.“[158], meint Herr A. von der Firma Wildbunch. Damit ist auch die Produktion deutscher Spielfilme durch amerikanische Unternehmen gemeint. Auch wenn sie theoretisch das Kapital hätten, ohne Förderung zu produzieren, müssen sie sich momentan zumindest noch oft an die Sperrfristen des FFG halten. Ändert sich das, birgt dies das Risiko, dass sie ihr Kapital und ihre Marktmacht dazu nutzen, mittlere und kleinere Wettbewerber vom Markt zu drängen – beispielsweise mit einer radikalen Einführung von Day-and-date Veröffentlichungen.[159]
Ungeachtet dessen setzt sich die Piratenpartei für die vollständige Abschaffung der Sperrfristen ein. Sie brachte 2013 eine entsprechende Initiative vor, in der sie erläuterte, dass der Mehrwert eines Kinobesuchs eben nicht primär in seiner Exklusivität bestehe, die durch den problemlosen Zugang zu Raubkopien ja ohnehin nicht mehr gegeben sei. Sie argumentieren gegen die Aussagen mehrerer Experten, dass die Kinokultur auch ohne staatliche Förderung lebensfähig und eine "institutionelle Förderung wie bei Theater oder Oper“ angebrachter wäre als „eine künstliche Verknappung von Kulturgütern“[160].
Solange noch Sperrfristen existieren, sind zumindest deutsche Produktionen mit Förderanteil vor einem Missbrauch geschützt, auch wenn das Trendszenario auf eine Rückentwicklung hindeutet. Ob bei einer vollkommenen Abschaffung die negativen oder die positiven Folgen überwiegen, hängt letztlich von dem Umgang der unterschiedlichen Branchenteilnehmer miteinander sowie von zusätzlichen gesetzlichen Regelungen ab.
6.6. Chancen und Risiken von Day-and-date Releases
Im Szenario 1 beschriebenen Extremfall der generellen Einführung von Day-and-date Releases wird zwar das Free-TV exkludiert und davon ausgegangen, dass auf allen Plattformen in irgendeiner Weise gezahlt werden muss, dennoch besteht eine nicht zu unterschätzende Gefahr, dass der Gesamtgewinn sinkt, je näher man die Auswertungsschritte zusammenlegt. Keiner der befragten Experten traf eine eindeutige Aussage dazu und auch Time Warner CEO Jeffrey Bewkes antwortet auf die direkte Frage des Moderators, wann es denn für Blockbuster so weit wäre, sehr ausweichend: „This is a dangerous question.“[161] Die deutsche Filmbranche schätzt das Risiko als zu groß ein und kein Major Studio hat sich bisher zu diesem Schritt durchgerungen, obwohl sich die Diskussion darüber bereits über mehrere Jahre hinzieht. Das wiederum bedeutet, dass man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgeht, dass durch eine Umstellung tatsächlich signifikante Gewinne erwirtschaftet werden könnten. Die großen Chancen liegen ähnlich wie bei einer generellen Verkürzung der Auswertungsfenster: „Die Kosten für Werbung können gesenkt werden, wenn nicht in jeder Auswertungsphase neu und separat geworben werden muss.“[162]
Dabei gäbe es Vorteile besonders für kleinere Produktionen mit einer ohnehin limitierten Auswertung: „Day-and-date releases can make certain films accessible in the whole of a given territory, rather than being limited to some towns even though promotion is nation-wide.“[163] Durch die punktuelle Kinoauswertung kann der national erwirtschaftete VoD-Revenue als zusätzlicher Gewinn gesehen werden. Hinzu kommt die Einsparung durch geringere Kosten für Filmkopien und die bereits angesprochenen Synergien beim Marketing.
Auch wenn Day-and-date Releases für größere und erfolgreiche Produktionen auf Grund des nicht einschätzbaren Risikos momentan noch nicht attraktiv sind, bieten sie eine umso größere Chance für kleine Produktionen. Diese können so ihren Markt bei einem breiteren Publikum finden und dabei gleichzeitig die negativen Auswirkungen der Filmpiraterie eindämmen.
Ob eine umfassende Einführung von Day-and-date Releases aber tatsächlich zu höheren oder niedrigeren Gesamteinnahmen führt, hängt dabei von einer Vielzahl von Faktoren ab und kann wohl erst nach einer tatsächlichen Umsetzung abschließend beantwortet werden.
6.7. Risiken für Kinobesitzer
Kinos gehören zu den größten und wichtigsten sozialen und kulturellen Veranstaltungsorten, und der Kinofilm als besonders ästhetisches Kulturgut ist nach wie vor das spannendste, erlebnisreichste Medium in unserer Gesellschaft, das wie kaum ein zweites Gemeinschaftserlebnisse und den Gemeinschaftssinn fördert.[164]
So beschreibt Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann in seiner Rolle als Vorsitzender der FFA die Stellung des Kinos in Deutschland. Wie bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit erwähnt, ist jene Institution dennoch abgesehen vom Video-Verleih diejenige Auswertungsform, die sich als besonders bedroht sieht. Dabei gab es in der Filmgeschichte bereits diverse Phasen, in denen von einem Kino-Sterben die Rede war. Zu Beginn der 1980er Jahre mit Aufkommen der VHS-Kassette, in den 90er Jahren beim Aufkommen der großen Multiplexe und schließlich seit einigen Jahren im Zuge der Digitalisierung[165] - noch 2011 mussten in Deutschland Kinos mit insgesamt 59 Leinwänden schließen.[166] Branchenmitglieder beurteilen die Situation laut einer Umfrage von 2012 in etwa dreigeteilt: Ein Drittel glaubt an ein Ende des Kinosterbens nach Abschluss des digitalen Rollouts, ein Drittel ist der Meinung, dass das Sterben nur durch ein Eingreifen der lokalen Politik aufzuhalten sei und ein weiteres Drittel hält die Vorgänge für natürlich, da in der mittlerweile vergangenen Blütezeit des Kinos Überkapazitäten geschaffen wurden, die jetzt wieder abgebaut werden. "Die Marke Kino wird durch diese Entwicklung marginalisiert!", warnt Frank Völkert, Vorstand der FFA[167]. Je geringer die Flächenpräsenz von Kinos sei, desto geringer wäre die Wahrnehmung. Dabei gibt es von staatlicher Seite erhebliche Anstrengungen, der Schließung von Kinos entgegenzuwirken. Allein 2013 wurde eine Fördersumme von mehr als 6,7 Millionen Euro in Form von kombinierten Zuschüssen und zinslosen Darlehen bewilligt.[168] Gefördert wurde dabei vor allem die Digitalisierung, die mit einer Marktdurchdringung von 95% im Jahr 2014 als nahezu abgeschlossen bezeichnet werden kann.[169] Die Schließung weiterer Leinwände ginge im Optimalfall also in den nächsten Jahren stark zurück.
Was bleibt, sind die Bedrohungen, die von den in dieser Arbeit beschriebenen Veränderungen des Distributionsmodells ausgehen. Das größte Risiko ist, dass das Kino als Auswertungsform gegenüber Online-Angeboten an Attraktivität verliert und somit nicht mehr rentabel ist. Neben den Ticket-Erlösen gehen den Kino-Betreibern ja auch die Nebenerlöse durch ihre Konzessionen verloren. Ideen wie die im Trendszenario[170] beschriebene individuelle Handhabung der Auswertungsfenster und die Verkürzung der Sperrfristen sieht Herr D., Geschäftsführer der Xxxxxxx-Gruppe, dabei sehr kritisch: „Sicherlich wird es im Einzelfall kleinere Filme geben, bei denen eine Sperrfristenverkürzung das Kinoergebnis nicht wesentlich beeinflusst, aber wo will man hier die Grenze ziehen?“[171] Er plädiert für einen notwendigen Schutz der Kinos und erhält dabei Rückhalt von staatlicher Seite – in der aktuellen Novellierung des FFG gab es keine Bestrebungen, die Auswertungsstufe Kino zu gefährden „und wir [die Kinobetreiber, Anm. d. Verf.] würden uns sicherlich auch dagegen wehren, falls dies angestrebt werden sollte.“[172] Angestrebt wird dies in politischer Hinsicht vor allem von der Piratenpartei, die der aktuellen Situation und den staatlichen Subventionen kritisch gegenübersteht und die Abschaffung der Sperrfristen fordert.[173] Sie sieht mehr als die Risiken die Chancen für den Markt bei einer Anpassung an die reellen Forderungen der Kunden. Auch Herr A. vom Filmverleiher Wildbunch erkennt hier zumindest ein gewisses Potential: „Seitens der Kinos gibt es natürlich die Bedenken, dass bei einer Auflösung der Exklusivität Zuschauer verloren gehen [...]. Das ist möglicherweise aber gar nicht so.“[174]
In Hinblick auf den Soll-Zustand wird das Kino zumindest seine Rolle als „Veredelungsfunktion“ [175] von Filmprodukten in jedem Falle beibehalten und auch wenn zukünftig eventuell mit Umsatzeinbußen gerechnet werden muss, gibt es beim momentanen Trend-Szenario keinen Grund für Kino-Existenz-Ängste.
6.8. Risiko des Recoupment-Verlusts
Für den folgenden Punkt wird von einer Verkürzung der Auswertungsfenster bei einer gleichzeitigen Schutzfrist für Kinos ausgegangen. Die ausreichende Erwirtschaftung von Gewinn ist die Grundlage für den Fortbestand der Filmbranche und bis auf wenige Ausnahmen das Ziel aller Filmschaffenden. Ein Problem dabei stellt sich darin, dass „die verschiedenen Teile der Branche nicht nur vertikal, sondern auch horizontal in der Verwertungskette miteinander in Konkurrenz stehen“.[176] Ein populäres Beispiel dafür bildet Sönke Wortmanns „Deutschland. Ein Sommermärchen“[177], das bereits zwei Monate nach Kinostart im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Möglich war dies durch die 100%ige Finanzierung durch den WDR beziehungsweise die WDR Media Group ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln – die Regelungen des FFG fanden hier also keine Anwendung. Viele Kinobesitzer drohten ähnlich wie im Fall von Love Steaks[178] deshalb im Vorfeld bereits mit einem Boykott und der Vorsitzende des Hauptverbandes der deutschen Filmtheater schätzt, dass letztlich „eine halbe bis dreiviertel Millionen Kinozuschauer weniger“ den Film dadurch im Kino sahen.[179] Zwar erreichte der Sender im Dezember 2006 einen Marktanteil von 31%, der Verlust an Kinoeinnahmen stand jedoch in keinem Verhältnis zu den Zuschauerzahlen. Zudem erschien der Film erst nach seiner Fernseh-Ausstrahlung auf DVD, wobei von weiteren Einbußen ausgegangen werden kann. Das hier geschehene, nennt Eckhard Wendling „Kannibalisierungseffekt durch Gleichzeitigkeit“[180] – kein Einzelfall in der deutschen Film- und Fernsehgeschichte. Das Beispiel steht jedoch stellvertretend für das von einigen Experten gesehene Risiko des Recoupment-Verlusts durch Veränderung der historischen Auswertungskaskaden. Dieses Risiko wird umso größer, je näher die einzelnen Schritte zusammenrücken, beziehungsweise je mehr Auswertungsschritte gleichzeitig stattfinden. Seit der Veröffentlichung von Sönke Wortmanns Film ist die Verkürzung zumindest teilweise fortgeschritten, auch wenn die Schutzfrist für Kinos in der letzten Novellierung nicht verändert wurde.
Dennoch ist die Angst im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Arbeit tendenziell übertrieben, zumal der Schaden im beschriebenen Fall ja durch eine Free-TV Ausstrahlung entstand, die auch im entwickelten Trend-Szenario nach einer ausreichenden Verwertung durch VoD und Datenträger stattfinden würde. Die oft zitierten Kannibalisierungseffekte[181] treten nur unter speziellen Umständen bei besonders erfolgreichen Filmen und damit in absoluten Ausnahmefällen ein.
6.9. Chance des Recoupment-Gewinns
Betrachtet man die Entwicklung in Amerika, so ist das übliche Fenster für die Kinoverwertung seit den 1980er Jahren nach einer schrittweisen Verkürzung bei etwa vier Monaten stehen geblieben und auch in Deutschland hat man sich auf diesen Standard verständigt.[182]
Dennoch sind beinahe alle zu dieser Arbeit befragten Experten der Meinung, dass diese Strategie nicht für jeden Film gleichermaßen passt. Die in Punkt 3.3. beschriebene Verschärfung der Konkurrenz-Situation[183] hat zur Folge, dass gerade Low-Budget Produktionen, unter denen auch viele deutsche Filme sind, am Start-Wochenende nicht gegen die starke Konkurrenz bestehen können. „Das führt dazu, dass viele Filme im kleinen und mittleren Segment gar nicht mehr ins Kino kommen.“[184] Dabei gäbe es eine realistische Möglichkeit, das Recoupment solcher Filme zu steigern, in dem man sie nach einer kurzen, beispielsweise sechswöchigen Exklusivzeit, über VoD anbietet und so noch direkt von der Kinoauswertung und den getätigten Werbemaßnahmen profitiert. Vorschläge sind unter anderem, den Film anschließend entweder über eine etwas teurere Premium-VoD-Möglichkeit zum Leihen anzubieten oder aber direkt zu seiner normalen Weiterverwertung überzugehen. In jedem Fall spielt der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle für den Wert des Produkts, denn Marketingmaßnahmen sind teuer und je näher die Weiterverwertung am Kinostart lägen, desto deutlicher wäre der Effekt noch. Der erfahrene und erfolgreiche Filmproduzent Herr B. sieht einen Vorteil für das Gesamt-Recoupment, „weil man den restlichen Schwung der Werbung noch mitnimmt und der Film im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer und Konsumenten ist.“[185] Bleibt der Film zu lange unbeworben und kommt anschließend als DVD oder VoD auf den Markt, muss eine große Summe aufgewendet werden, um wieder denselben Aufmerksamkeitsstand beim Zuschauer zu erreichen. In den meisten Fällen ist eine solche Investition nicht rentabel, weswegen bei weniger erfolgreichen Filmen oft auf weitere Werbemaßnahmen verzichtet wird. „Die Amerikaner machen es vor: Erfolgreiche Filme halten sich an die Sperrfristen, wenn ein Film aber floppt, wird der Video-Start vorgezogen.“[186]
Die individuelle Verkürzung der Auswertungsfenster birgt für bestimmte Filme also eine große Chance zur Recoupment-Maximierung und auch wenn dahingehend keine eindeutigen Aussagen möglich sind, zeigt das Trend-Szenario eine eindeutige Entwicklung in diese Richtung, die auch im Sinne des Soll-Zustandes wäre. Dennoch müsste man „am Ende des Tages [...] dann die Rechnung machen und abwägen, ob sie aufgeht oder nicht.“[187]
6.10. Chance einer schnelleren Zweitauswertung
Eine weitere Chance für zusätzliche Einnahmen durch eine Verkürzung der Auswertungsfenster ergibt sich bei der Zweitauswertung. „Niemand mehr wertet im Kino die vollen 18 Monate aus. Beim Kino-Dokumentarfilm würden schon sechs Monate vollkommen ausreichen.“[188], meint Herr C. Ein schnelleres Durchlaufen der einzelnen Auswertungsstufen ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich keine signifikanten Gewinne mehr erwirtschaftet werden und eine Wiederaufnahme des Verwertungszyklus Erfolg verspricht. Oft ist es der Fall, dass die Produktionen bis zur Möglichkeit eines zweiten Durchlaufs stark an Aktualität und damit an Attraktivität eingebüßt haben. Dazu tragen neben den langen Auswertungszeiträumen der Sender natürlich auch die Sperrfristen bei. Eine stärkere Flexibilisierung, beziehungsweise Möglichkeiten, die Fristen zu verkürzen, bieten also auch hier eine Chance zur Maximierung der Rückflüsse, wenn auch nur eine geringe.
6.11. Chancen zur Bekämpfung der Filmpiraterie
Während sich z.B. die Musikindustrie weitgehend auf die Gegebenheiten des digitalen Wandels eingestellt hat, ist eine entsprechende Anpassung bei der Filmindustrie größtenteils ausgeblieben.[189]
Die Kritik der Piratenpartei am Distributionssystem ist ein zentraler Punkt ihrer Agenda. Bei ihren Vorstößen zur gesetzlichen Veränderung zeigen sie unter anderem auch einige der bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit erwähnten Chancen zur Bekämpfung der illegalen Piraterie auf, die in diesem Punkt zusammengefasst werden sollen. Die Verkürzung der Auswertungsfenster wird genau wie ihre Extremform, das Day-and-date Release, von Experten als eine wirksame Waffe der Filmbranche gegen Raubkopierer betrachtet. „Viele der „Piraten“ stehlen die Filme auch nicht mit kriminellem Hintergedanken, sondern weil kein legales Angebot besteht.“[190], meint Herr F. im Interview und geht davon aus, dass sich ein signifikanter Teil der illegalen Zugriffe eindämmen ließe, wenn man die Zugriffmöglichkeiten verbessern würde. Andere Branchenteilnehmer, besonders die Kinobesitzer, sehen in der Verkürzung jedoch ein Existenzrisiko und fordern stattdessen ein härteres Vorgehen der Justiz,[191] was sich aus den in Punkt 4.8. genannten Gründen jedoch schwierig gestaltet.[192] Dennoch sehe F. den Interessenskonflikt „auf dem Weg der Harmonisierung.“ Wenn die Chancen zur Anpassung der Verwertungsfenster an die Realität genutzt werden, wie es in dem in dieser Arbeit beschriebenen Trendszenario und Soll-Zustand der Fall ist, werde die Piraterie schon bald dort sein, „wo heute gesetzlich und gesellschaftlich der Ladendiebstahl eingeordnet wird“.
Auch wenn es eine Vielzahl von Risiken gibt, die die Rentabilität des aktuellen Geschäftsmodells gefährden, bestehen auch eine Reihe von Chancen, die in den kommenden Jahren genutzt werden müssen, um negative Entwicklungen zu vermeiden.
7. Abwägung und Handlungsempfehlungen
Nach dem Modell Prof. Dr. Bernhard Ungerichts werden in diesem Punkt unter Einbezug der entwickelten Szenarien die Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen und konkrete Maßnahmen dargestellt, die dazu führen könnten, die aktuelle Situation der deutschen Distributionslandschaft zu verbessern.
7.1. Flexibilisierung und Verkürzung der FFG Sperrfristen
Bezogen auf den deutschen Markt richtet sich die wohl wichtigste Handlungsempfehlung an die Politik beziehungsweise die FFA. Zum einen ist eine allgemeine Verkürzung der Sperrfristen unter dem Druck des Nutzeranspruchs überfällig und notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit geförderter, deutscher Produktionen gegenüber der internationalen Konkurrenz nicht zu gefährden. Wenn signifikante Änderungen von Politik und Industrie erst eingeleitet werden, wenn es durch den Druck der US-Majors nicht mehr anders geht, ist es eigentlich zu spät. Insofern wäre es sinnvoll, nach Vorschlag der Verbände ANGA, BITKOM und eco „die Nicht-Anwendung der Sperrfristen weniger an gesetzlich festgeschriebene Konditionen zu binden, sondern vielmehr Raum für individuelle Verhandlungen zwischen dem Hersteller und dem jeweiligen Auswerter zu schaffen.“[193] Wie weit und wie schnell die Verkürzung fortschreiten soll, muss mit Hilfe aussagekräftiger Studien ermittelt und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, um den Markt nicht „durch die Verpflichtung zu anachronistischen Geschäftsmodellen“[194] zu behindern. Die Anführung erfolgreicher Beispiele zur Darstellung der Funktionstüchtigkeit des aktuellen Systems geht vorbei an der Realität, denn der überwiegende Anteil deutscher Produktionen befindet sich, was den Kino-Erfolg angeht, im mittleren, kleinen und kleinsten Segment.[195] Gerade diese Filme würden auch von einer Flexibilisierung der Sperrfristen profitieren, die weiter als nur bis vier Monate nach Kinostart reicht. Eine Möglichkeit, schon nach wenigen Wochen die Distribution vom Kino in andere Auswertungsformen zu verlegen, ist eine realistische Chance für Verleiher und Produzenten, auch bei Publikums-Misserfolgen noch Recoupment zu generieren. Diese aus Unbeweglichkeit oder grundloser Angst vor einer Schädigung des Kinogeschäfts zu blockieren, kann als absichtliche Benachteiligung verstanden werden, die angesichts der Fördersummen, die in diese kleinen, meist unrentablen Filme investiert werden, keinen Sinn ergibt. Der Flexibilisierungsprozess selbst muss zudem vereinfacht und beschleunigt werden, um im entscheidenden Moment keine wertvolle Zeit zu verlieren. Dabei bedeutet eine Flexibilisierung keinesfalls eine Gleichsetzung mit dem amerikanischen System. Ein Schutz der Kinoauswertung bei erfolgreichen Filmen ist sinnvoll und sollte unter allen Umständen beibehalten werden, um die für die gesamte Filmwirtschaft wichtige Marke Kino zu erhalten und nicht zu marginalisieren, denn letztlich spielt ein faktisch nicht messbarer aber nichtsdestotrotz vorhandener Reiz des Kino-Films auch bei anderen Auswertungsstufen eine wertsteigernde Rolle.
7.2. Individuellere Handhabung der Auswertungsfenster
Eng zusammen mit den Sperrfristen hängt auch die allgemeine Handhabung der Auswertungsfenster. Dabei richtet sich die Handlungsempfehlung besonders an die Filmverleiher und Kinobesitzer. Neue Auswertungsformen bilden einen schnell wachsenden Teil der Distributionskette und auch wenn die Ergebnisse aktueller Experimente zu Day-and-date Releases wenig Mut machen, ist eine individuellere Gestaltung der Auswertungskette unter besonderem Miteinbezug von VoD Angeboten, wie sie im Trendszenario beschrieben wurde, auf Dauer absehbar. Sich gegen diese Entwicklung zur Wehr zu setzen, ist kontraproduktiv und zerstört Chancen, wie beispielsweise bei Love Steaks[196] geschehen. „Selbst das neue FFG [...] empfiehlt einen innovativen Umgang mit den Sperrfristen“ meint der Produzent Stefan Arndt im Gespräch mit den Lola-Nominierten 2014. „Wir müssen die Möglichkeiten nutzen, die sich durch Digitalisierung, Netz und soziale Netzwerke bieten.“[197] Kinos hätten abgesehen von dem in Deutschland mit verhaltener Zustimmung bedachten Super-Ticket[198] durchaus Möglichkeiten, sich in Form von Zusammenschlüssen an den neuen Auswertungsformen zu beteiligen, bevorzugen es jedoch, die Sache so weit es geht zu blockieren. Ein Umdenken ist an dieser Stelle notwendig, denn auf veränderte Distributionsumstände mit neuen Mitteln zu reagieren ist eine rein logische Schlussfolgerung. Sollte dies nicht passieren, tritt im schlimmsten Fall das ein, wovor Prof. Dr. Hennig-Thurau warnte: Der Zusammenbruch des Marktes.[199]
7.3. Verbesserung des Online-Angebots
Die individuellste Auswertungsstrategie ist sinnlos, wenn die Möglichkeiten, den Film zum Publikum zu transportieren, zu gering sind. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, das Angebot bestehender Plattformen signifikant auszuweiten oder neue Plattformen zu schaffen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn sich auch der Umgang mit Lizenzen auf die Online-Verwertung ausrichtet und die Einzelinteressen von Lizenznehmern zu Gunsten eines höheren Gesamt-Recoupments zurückgestellt werden. Dass auch die großen VoD-Unternehmen im Moment noch wenig Gewinn abwerfen und für Lizenzen verhältnismäßig wenig Geld ausgeben können, wird sich mit einer Etablierung von klaren Marktführern und Systemen wahrscheinlich ändern, sodass letztlich die Hoffnung besteht, dass eine Entwicklung vom Trendszenario Flexibilisierung zum Soll-Szenario der ausreichenden Rückflüsse bei gleichzeitiger Kundenzufriedenheit stattfinden wird.
8. Abschließende Diskussion
Ein wichtiges Ziel der Arbeit war es, die Gründe für die Beschaffenheit des aktuellen Distributionsmodells in Deutschland herauszuarbeiten und die Frage von Prof. Dr. Hennig-Thurau zu beantworten, warum die Verfügbarkeit von Filmen immer noch eingeschränkt ist. Dazu wurde die Funktionsweise des Systems in seinem aktuellen Zustand beschrieben und herausgearbeitet, wie die Distribution in Deutschland zu ihrem jetzigen Stand gelangt ist. Weiter wurden Einflussfaktoren identifiziert und die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen einzelner Bereiche wie Technologie, Politik und Nutzerverhalten genauer beleuchtet. Ein Trendszenario versammelte schließlich alle bisher gesammelten Informationen in einer realistischen Zukunftsaussicht.
Diese Zukunftsaussicht zeigte, dass die Auswertungsfenster in ihrer jetzigen Form dem Druck des Nutzer-Anspruchs zumindest langsam nachgeben und sich verkürzen werden und auch in Hinblick auf die Sperrfristen ein Individualisierungs- und Flexibilisierungsprozess stattfinden wird. Gesetzgebung und Förderungen fügen sich langsam in den Entwicklungsfluss ein und unterstützen den Fortschritt, dessen Chancen und Risiken unter Einbeziehung der geführten Experteninterviews in Punkt 6. dargestellt wurden.[200] Dabei ist besonders die Chance des Recoupment-Gewinns mit Hilfe diverser Konzepte hervorzuheben. Auch wenn nicht alle Ideen realisierbar sind[201], bieten sie dennoch interessante Denkanstöße, um bestehenden Problemen auf kreative Weise zu begegnen. Hinsichtlich der Risiken kommt der Filmpiraterie und dem Risiko des Recoupmentverlusts besondere Bedeutung zu. Letzteres hängt eng zusammen mit der nicht zu unterschätzenden Gefahr für die Auswertungsstufe Kino.
Die Chancen und Risiken wiederum führen zum Hauptziel der Arbeit: Die Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen, die die Zukunft der Branche sichern sollen.[202] So lange keine folgenschweren Fehler begangen werden, sind Experimente mit Auswertungsformen absolut sinnvoll, denn darauf zu hoffen, dass die beschriebenen Entwicklungen spurlos an der Branche vorbeiziehen, ist realitätsfern und riskant. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies ohne Rücksicht auf Verluste passieren soll. Der Vorschlag, Kinos mit Hilfe einer gesetzlichen Sperrfrist zu schützen, ergibt durchaus Sinn. Der Schutz hat nicht nur mit ethischem Handeln gegenüber langjährigen Branchenpartnern zu tun, sondern auch mit den nicht absehbaren Risiken für die gesamtdeutsche Filmindustrie, die eine Marginalisierung der Auswertungsstufe Kino mit sich bringen würde. Dennoch wird dazu geraten, die Fristen für weniger erfolgreiche Filme zu flexibilisieren und insgesamt zu verkürzen. Zudem wird die individuellere Handhabung von Auswertungsfenstern in Zukunft eine tragende Rolle spielen.
Auch wenn die Ergebnisse durchaus als valide betrachtet werden können, erhebt diese Arbeit weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf absolute wissenschaftliche Objektivität, denn letztere könnte nur mit Hilfe einer umfassenden und standardisierten Befragung von Branchenmitgliedern erreicht werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Subjektivität wurde hier stattdessen versucht, in Interviews und Artikeln recherchierte Informationen in wissenschaftlicher Weise zu extrahieren und kontextbezogen angemessen darzustellen.
Ob sich die weiteren sozialen, technologischen und gesetzlichen Entwicklungen für die Filmbranche als positiv herausstellen, wird in hohem Maß von der Anpassungs- und Investitionsbereitschaft derselben abhängen, wobei gerade die konservative Haltung vieler Kinobesitzer ein großes Risiko darstellt. Weitere Experimente und Studien wird es zwar unzweifelhaft geben, letztlich können aber auch diese keine 100% Aussage darüber treffen, welche Maßnahmen den jeweiligen Branchenteilen auch zukünftig Erfolg bescheren werden, denn wie so oft spielt auch das Glück eine wesentliche Rolle und gemäß einem Sprichwort, das bereits Cicero in seinen Tusculanae disputationes zitiert: „Fortes fortuna adiuvat.“[203] oder zu deutsch: Das Glück hilft den Mutigen.
9. Quellen
9.1. Bibliographie
Arrow, Kenneth J. (1971): Essays in the Theory of Risk-Bearing. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.
Behrmann, Malte (2008): Filmförderung im Zentral- und Bundesstaat. Eine vergleichende Analyse der Filmförderungssysteme von Deutschland und Frankreich unter besonderer Berücksichtigung der Staatsverfasstheit. Berlin: Avinus Verlag.
Berauer, Wilfried (2013): Filmstatistisches Jahrbuch 2013. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Bleicher, Joan Kristin (2013): Die mediale Zwangsgemeinschaft. Der deutsche Kinofilm zwischen Filmförderung und Fernsehen. Berlin: Avinus Verlag.
Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (2009)3: Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Castendyk, O., & Goldhammer, K. (2013). Produzentenstudie 2012: Daten zur Film- und Fernsehwirtschaft in Deutschland 2011/2012. Berlin: Vistas Verlag GmbH.
Cicero, Marcus Tullius (1997): Tusculanae disputationes. In Kirfel, Ernst Alfred (Hrsg.) Gespräche in Tusculum: Lat. /Dt. Stuttgart: Philipp Reclam jun. Verlag.
Diller, Hermann; Fürst, Andreas; Ivens, Björn (2011): Grundprinzipien des Marketing. Nürnberg: Wissenschaftliche Gesellschaft für Innovatives Marketing.
Dördrechter, Nikolai (2006): Piraterie in der Filmindustrie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH.
Gaitanides, M. (2001). Ökonomie des Spielfilms. München: Fischer Verlag.
Herrmann, A.; Huber F. (2009): Produktionsmanagement. Grundlagen – Methoden – Beispiele. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
Jacobs, Olaf (2011): Finanzierung von Film- und Fernsehproduktionen. Strategien zur erfolgreichen Mittelbeschaffung. Bamberg: Erich Schmidt Verlag.
Meuser, M., & Nagel, U. (2009): Das Experteninterview. Konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlagen. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth, & D. Jahn (Hrsg.): Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaften: Neue Entwicklungen und Anwendungen (S. 465-479). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.
Pepels, W. (2012): Handbuch des Marketing. München: Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH.
Popp, Wolfgang; Parke, Lennart; Kaumanns, Ralf (2008): Rechtemanagement in der digitalen Medienwelt. In Cromm, Bernhard (Hrsg.): Media Perspektiven, 9/2008. Frankfurt/Main: ARD-Werbung Sales & Services.
Schreyögg, Georg (2010): Grundlagen des Managements. Basiswissen für Studium und Praxis. Heidelberg: Gabler Verlag.
Simon, Herrmann; von der Gathen, Andreas (2010): Das große Handbuch der Strategieinstumente. Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Frankfurt / New York: Campus Verlag.
Stender-Monhemius, Kerstin (2002): Marketing. Grundlagen mit Fallstudien. München / Wien: Oldenburg (Management für Studium und Praxis).
Ungericht, Bernhard (2012): Strategiebewusstes Management. Konzepte und Instrumente für nachhaltiges Handeln. München: Pearson Studium.
Vollmuth, Hilmar J. (2003)6: Controling Instrumente von A - Z. Planegg / München: Rudolf Haufe Verlag.
Wendling, Eckhard (2008): Filmproduktion. Eine Einführung in die Produktionsleitung. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. Recoup! Filmfinanzierung - Filmverwertung. Grundlagen und Beispiele. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
9.2. Filmographie
Avatar - Aufbruch nach Pandora / Avatar (OT), Kinofilm, Regie: James Cameron, USA 2009.
Der große Crash - Margin Call / Margin Call (OT), Kinofilm, Regie: J. C. Chandor, USA 2011.
Deutschland. Ein Sommermärchen (OT), Kinofilm, Regie: Sönke Wortmann, Deutschland 2006.
House of Cards (OT), Webserie, Regie: Diverse, USA 2013.
Iron Man (OT), Kinofilm, Regie: John Favreau, USA 2008.
Lincoln (OT), Kinofilm, Regie: Steven Spielberg, USA 2012.
Love Steaks (OT), Kinofilm, Regie: Jakob Lass, Deutschland 2013.
Welcome to New York (OT), Kinofilm, Regie: Abel Ferrara, Frankreich / USA, 2014.
World War Z (OT), Kinofilm, Regie: Marc Foster, USA / Malta 2012.
9.3. Web-Quellen
5th Cinema; Blaisdell, Nathan (11.03.2013): “Day-and-date” Film Release. What it is. Why it’s the future. Auf http://5thcinema.com/blog/2013/03/day-and-date-release/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Anwalt.de (04.08.2014): Abmahnungen Waldorf Frommer. Auf http://www.anwalt.de/rechtstipps/eine-ganz-ruhige-kugel-abmahnung-waldorf-frommer-so-reagieren-sie-richtig_061232.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie (2014): Filmförderung. Auf http://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/filmfoerderung/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Bereitsgestestet.de (15.05.2014): Stehen Videotheken bald vor dem aus? Auf http://bereitsgetestet.de/index.php/special/item/stehen-videotheken-bald-vor-dem-aus.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Bitkom (23.07.2012): Stellungnahme ANGA, BITKOM und eco zu dem Referentenentwurf für ein Siebtes Gesetz zur Änderung des Filmförderungsgesetzes („FFG 2014“). Auf http://www.bitkom.org/files/documents/Stellungnahme_FFG-Novelle_2014_ANGA_BITKOM_eco.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Bundesregierung (17.06.2013): Kulturstaatsminister Bernd Neumann: FFG-Novelle justiert Filmförderungssystem neu. Auf http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Pressemitteilungen/BPA/2012/11/2012-11-07-bkm-ffg-novelle.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Business Dictionary (kein Datum): recoupment. Auf http://www.businessdictionary.com/definition/recoupment.html, letzter Zugriff: 25.08.2014
Charlie Rose (10.05.2012): Jeff Bewkes, CEO Time Warner. Hall of Fame baseball player Yogi Berra, former major league baseball player Ron Guidry and author Harvey Araton on Driving Mr. Yogi: Yogi Berra, Ron Guidry and Baseballs Greatest Gift. Auf http://www.charlierose.com/watch/60072386, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Cine-Bulletin (06.07.2010): Auswertungskaskade: Die Lage spitzt sich zu. Auf http://www.cine-bulletin.ch/pdf/archives/CB%20416-417%20juin-juillet%202010.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
CNRS (GREG HEC); Paris, Thomas (12.05.2014): New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Auf http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Das Erste; Burgschat, Mareike; Hilbert, Jörg (20.08.2014): Video: Abmahnanwälte nicht zu stoppen. Auf http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/abmahnanwaelte-nicht-zu-stoppen-100.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
De Jure (30.11.2009): Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Auf http://dejure.org/gesetze/AEUV/167.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Deutscher Filmförderfonds (2013): Sperrfristen. Auf http://dfff-ffa.de/sperrfristen.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Deutschlandradio Kultur (28.01.2014): "Ohne Filmförderung gäbe es keine deutschen Filme". Auf http://www.deutschlandradiokultur.de/kino-ohne-filmfoerderung-gaebe-es-keine-deutschen-filme.1008.de.html?dram:article_id=275794, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Digitalfernsehen (29.09.2011): Fox hält an umstrittenem Video-Auswertungsfenster fest. Auf http://www.digitalfernsehen.de/Fox-haelt-an-umstrittenem-Video-Auswertungsfenster-fest.67656.0.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
DVD Demystified (27.06.2013): DVD Frequently Asked Questions (and Answers). Auf http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Europäische Union (kein Datum): Audiovisuelles und Medien. Auf http://europa.eu/pol/av/index_de.htm, letzter Zugriff: 25.08.2014.
FFF Bayern (07.06.2010): Richtlinien für die Bayerische Film- und Fernsehförderung (Vergaberichtlinien). Auf http://www.fff-bayern.de/fileadmin/user_upload/downloads/FFF/Allgemein/Richtlinien/Richtlinien_FFF_Bayern_dt_Stand_07.06.2010.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Film- und Medienstiftung NRW (27.05.2010): Förderungsrichtlinien der Film- und Medienstiftung NRW GmbH. Auf http://www.filmstiftung.de/wp-content/uploads/2011/05/richtlinienfms2012.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (11.01.2013): FFA Info: Zahlen aus der Filmwirtschaft. Auf http://www.ffa.de/downloads/publikationen/ffa_intern/FFA_info_1_2013.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (2013): FFA Kinobesucher 2012. Auf http://www.ffa.de/downloads/publikationen/kinobesucher_dt_2012.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (2014): FFA Sperrfristen. Auf http://www.ffa.de/index.php?page=foerderbereiche_sperrfristen_antrag, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (2014): Filmförderungsgesetz 2014. Auf http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (2014): Richtlinie für die Antragstellung auf Verkürzung der Video- bzw. Fernsehsperrfristen. Auf http://www.ffa.de/downloads/richtlinien/D06.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (31.12.2012): FFA Jahresbericht 2012. Auf http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2012.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Filmförderanstalt (31.12.2013): FFA Jahresbericht 2013. Auf http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Financial Times; Garrahan, Matthew (05.10.2008): Warner in online move to stop DVD piracy. Auf http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4085db1a-92f5-11dd-98b5-0000779fd18c.html#axzz380NvLEhN, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Frankfurter Allgemeine Zeitung; Frickel, Thomas (14.02.2011): Sie pressen den Film in ihr Format. Auf http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/deutsches-kino-sie-pressen-den-film-in-ihr-format-1593034.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Frankfurter Allgemeine Zeitung; Reiter Udo (20.02.2011): Ohne das Fernsehen ist der Film verloren. Auf http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/filmfoerderung-oeffentlich-rechtlich-ohne-das-fernsehen-ist-der-film-verloren-1594876-p2.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Frankfurter Allgemeine Zeitung; Schipper, Lena (30.07.2013): Noch lange nicht die letzte Vorstellung. Auf http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/regionales-kinosterben-noch-lange-nicht-die-letzte-vorstellung-12312840.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Hollywood Reporter; Miller, Daniel (18.01.2012): Sundance 2012: The Day-And-Date Success Story of 'Margin Call'. Auf http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-2012-margin-call-video-on-demand-zach-quinto-283033, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Hollywood Reporter; O'Falt, Chris (19.12.2013): The 3 Biggest Problems Indies Face With Day-and-Date Releasing. Auf http://www.hollywoodreporter.com/news/3-biggest-problems-indies-face-666871, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Maybury, Rick. O (1997): VHSTORY - Home Taping Comes of Age. Auf http://www.rickmaybury.com/Altarcs/homent/he97/vhstoryhtm.htm, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (01.07.2014): AG Kino-Gilde macht Front gegen verzerrtes Bild von Day&Date-Experimenten. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/ag-kino-gilde-macht-front-gegen-verzerrtes-bild-von-dayunddate-experimenten/381806, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (01.08.2014): Illegale Downloads vor Kinostart schaden dem Boxoffice. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/illegale-downloads-vor-kinostart-schaden-dem-boxoffice/383184, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (03.04.2014):Thomas Negele zu den Herausforderungen des Kinogeschäfts. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zu-den-herausforderungen-des-kinogeschaefts/345621/seite-5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (08.04.2014): "Nicht weiter die Schlachten der Vergangenheit schlagen". Auf http://www.mediabiz.de/film/news/nicht-weiter-die-schlachten-der-vergangenheit-schlagen/345804, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (08.05.2014): Die Produzenten der Lola-Nominierten im Interview. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/die-produzenten-der-lola-nominierten-im-interview/346852, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (08.08.2013): vote/quote: Skepsis beim "SuperTicket". Auf http://www.mediabiz.de/film/news/vote-quote-skepsis-beim-superticket/336489, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (09.04.2014): Netflix startet 4K-Streaming. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/netflix-startet-4k-streaming/345817, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (11.02.2014): Status quo von Ultra-HD und 4K Blu-ray. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/status-quo-von-ultra-hd-und-4k-blu-ray/343615, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (11.04.2014): "Die Marke Kino wird marginalisiert!" Auf http://www.mediabiz.de/film/news/die-marke-kino-wird-marginalisiert/345942, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (12.06.2013): UPDATE: FFG-Novelle ohne Gegenstimmen verabschiedet. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/update-ffg-novelle-ohne-gegenstimmen-verabschiedet/334178, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (13.05.2014): Goldmedia: Tablets im Massenmarkt angekommen. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/goldmedia-tablets-im-massenmarkt-angekommen/347028, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (13.06.2013): Central in Ludwigsburg feiert 100-jähriges Bestehen. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/central-in-ludwigsburg-feiert-100-jaehriges-bestehen/334212, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (14.04.2014): Gerd Hansen: Risiken bei transmedialem Erzählen. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/risiken-bei-transmedialem-erzaehlen/346011/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (15.04.2013): Andreas Heyden, maxdome: "Netflix wird es nicht einfach haben". Auf: http://www.mediabiz.de/video/news/andreas-heyden-maxdome-netflix-wird-es-nicht-einfach-haben/346056, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (16.02.2012): vote/quote: Keine klare Einschätzung rückläufiger Leinwandzahlen. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/vote-quote-keine-klare-einschaetzung-ruecklaeufiger-leinwandzahlen/315867, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (16.08.2012): Wichtiges Signal für die gesamte Filmwirtschaft. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/wichtiges-signal-fuer-die-gesamte-filmwirtschaft/322839, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (16.10.2013): Drehbuchautor fordert: Filme gratis ins Netz! Auf http://www.mediabiz.de/film/news/drehbuchautor-fordert-filme-gratis-ins-netz/339269, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (17.06.2013): Filmförderungsgesetz 2014 - 2016: Die wichtigsten Änderungen, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (18.10.2012): Eine Milliarde Smartphone-Besitzer weltweit. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/eine-milliarde-smartphone-besitzer-weltweit/325236, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (19.04.2013): Thomas Negele zum Status quo des Kinomarkts. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zum-status-quo-des-kinomarkts/332102/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (19.06.2014): PwC: Digital überholt DVD und Blu-ray. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/pwc-digital-ueberholt-dvd-und-blu-ray/381323, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (20.04.2014): Vote: Wie hat sich das Piraterieproblem entwickelt? Auf http://www.mediabiz.de/video/news/vote-wie-hat-sich-das-piraterieproblem-entwickelt/346321, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (20.05.2014): Debatte um Simultanstarts bleibt ohne Ergebnis. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/debatte-um-simultanstarts-bleibt-ohne-ergebnis/347270, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (20.11.2012): Kim Ludolf Koch zum Cineplex-Jubiläum: "Partnerschaftliche Kooperation". Auf http://www.mediabiz.de/film/news/kim-ludolf-koch-zum-cineplex-jubilaeum-partnerschaftliche-kooperation/326419/seite-3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (22.08.2013): "SuperTicket" vereint Kinobesuch und Download. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/superticket-vereint-kinobesuch-und-download/337060, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (25.10.2012): USA: Warner hebt Minus-Fenster für stationären Verleih auf. Auf http://www.mediabiz.de/video/news/usa-warner-hebt-minus-fenster-fuer-stationaeren-verleih-auf/325474, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (27.10.2004): Kinoerlebnis versus Home-Entertainment. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/kinoerlebnis-versus-home-entertainment/165423, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (28.03.2014): Moszkowicz: "EuGH-Entscheidung ist ein sehr wichtiger Meilenstein für die Kreativindustrie".Auf http://www.mediabiz.de/film/news/moszkowicz-eugh-entscheidung-ist-ein-sehr-wichtiger-meilenstein-fuer-die-kreativindustrie/345378, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Mediabiz Blickpunkt:Film (29.06.2012): Thesen zur Zukunft der Filmverwertung von Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau. Auf http://www.mediabiz.de/film/news/thesen-zur-zukunft-der-filmverwertung/321011, letzter Zugriff: 25.08.2014.
medienpolitik.net (03.07.2013): „Die FFG-Novelle ist auch ein Signal gegenüber Karlsruhe“. Auf http://www.medienpolitik.net/2013/07/filmpolitikdie-ffg-novelle-ist-auch-ein-signal-gegenuber-karlsruhe/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Movies.Yahoo.com; Deming, Marc (14.07.2013): Meet the $50 'World War Z' Movie Ticket: Here's What You Get. Auf https://movies.yahoo.com/blogs/movie-talk/meet-50-world-war-z-movie-ticket-162450958.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Nash Information Services; The Numbers (2014): Market Share for Each Distributor in 2013. Auf http://www.the-numbers.com/market/2013/distributors, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Piratenpartei Deutschland Landesverband Berlin (01.03.2013): Initiative i2464: Filmförderung: Keine verpflichtenden Sperrfristen für geförderte Filme. Auf https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Popcorn Time (kein Datum): Index. Auf http://www.time4popcorn.eu/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (kein Datum): SPIO Filmstatistik. Auf http://www.spio.de/index.asp?SeitID=395&TID=3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Statista (2013): Statistik Videotheken in Deutschland. Auf http://de.statista.com/statistik/daten/studie/180706/umfrage/anzahl-der-videotheken-in-deutschland/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Süddeutsche Zeitung; Breinersdorfer, Fred (14.10.2013): Verschenkt meine Filme! Auf http://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-verschenkt-meine-filme-1.1794040, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Torrentfreak; Ernesto (13.08.2014): Suing File-sharers Doesn't Work, Lawyers Warn. Auf http://torrentfreak.com/suing-file-sharers-doesnt-work-lawyers-warn-140713/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Variety; Cheney, Alexandra (28.04.2014): Jeffrey Katzenberg Predicts 3-Week Theatrical Window in Future. Auf http://variety.com/2014/film/news/jeffrey-katzenberg-predicts-3-week-theatrical-window-in-future-1201166052/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Waldorf & Frommer (kein Datum): Index. Auf http://www.waldorf-frommer.de/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Wallstreet Journal Online; Smith, Ehtan; Schuker, Lauren A. E. (12.02.2010): Studios Unlock DVD Release Dates. Auf http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704337004575059713216224640?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052748704337004575059713216224640.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Welt.de; Flade Florian; Nagel Lars-Marten (31.05.2013): Warum das Filmportal Movie2k plötzlich offline ist. Auf http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article116683739/Warum-das-Filmportal-Movie2k-ploetzlich-offline-ist.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
Weser Kurier; Apke Myriam (23.02.2014): Videotheken kämpfen ums Überleben. Auf http://www.weser-kurier.de/bremen/vermischtes2_artikel,-Videotheken-kaempfen-ums-Ueberleben-_arid,787724.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
9.4. Rechtsquellenverzeichnis
Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films (Filmförderungsgesetz – FFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2004 (BGBl. I S. 2277) zuletzt geändert durch das Siebte Gesetz zur Änderung des Filmförderungsgesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3082, in Kraft getreten am 1. Januar 2014)
10. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abb. 1: Darstellung Szenariotrichter. Quelle: Eigene Darstellung nach Vollmuth, Hilmar J. (2003): Controling Instrumente von A – Z, S. 440. S. 11
Abb. 2: Die aktuellen Sperrfristen. Quelle: Eigene Darstellung nach http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 20 FFG, letzter Zugriff am 25.08.2014. S. 18
Abb. 3: Darstellung der Verkürzungsmöglichkeiten von Sperrfristen in violetter Farbe. Quelle: Eigene Darstellung nach http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 20 FFG. Letzter Aufruf am 25.08.2014. S. 19
Tab. 1: Übersicht der geführten Experteninterviews. Quelle: Eigene Darstellung. S. 7
12. Anhangsverzeichnis
12.1. Transkribierte Interviews
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Herr A., ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie aufnehme und das aufgenommene Material für meine Diplomarbeit verwende?
Ja, das ist in Ordnung.
Schaden oder nützen Ihnen die Auswertungsfenster und Sperrfristen, wie sie momentan im FFG festgelegt sind?
Das lässt sich schwarz-weiß nicht beantworten. Eine Kaskade in der Auswertung vorzunehmen ergibt in jedem Fall Sinn. Wenn man im Independent-Bereich tätig ist und in Filme investiert, ist es insbesondere auf Grund der Konkurrenz im Erwerbsmarkt schwierig, die Refinanzierung der eingesetzten Mittel überhaupt zu bewerkstelligen und Margen zu generieren. Insofern besteht natürlich das Interesse, das Potential, das in einem Film steckt, bestmöglich auszuwerten und die Rückflüsse zu maximieren. Da hat sich historisch die Abfolge ergeben, dass man mit einer Kinoauswertung beginnt, die erst einmal eine gewisse Exklusivität genießt und nicht sofort durch andere Nutzungsarten torpediert wird. In der Vergangenheit hat sich das als freiwillige Art der Auswertung ergeben, denn bei weitem nicht alle Filme die wir auswerten kommen mit harten gesetzlichen Sperrfristen. Sehr oft handelt es sich dabei um eine Regelung, die sich die Branche selbst auferlegt. Ein Internationaler Film mit z.B. amerikanischem Produzenten kommt oft vollkommen ohne Sperrfristen bei uns an und die Art, wie wir ihn auswerten ist weitgehend hausgemacht. Natürlich haben wir es in dem Moment, in dem wir uns für eine Kinoauswertung entscheiden auch mit den Sensibilitäten der Kinos zu tun und es hat sich dort über die Jahre eine kleiner werdende aber zu Gunsten der Kinos immer noch bestehende viermonatige Sperrfrist ergeben, bis die Videoauswertung beginnt. Diese ist für nicht-deutsche Filme aber nicht gesetzlich sondern letztendlich eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die der Meinung sind, dass das für beide Seiten gut ist. Kein Kino zwingt uns isoliert, die vier Monate einzuhalten, es handelt sich vielmehr um branchenüblichen Umgang miteinander. Das geht für die nicht-deutschen Filme genauso weiter – auch im Video-Bereich geht die Länge der Auswertungsfenster eher aus einer Partei-Vereinbarung zwischen dem Videovertrieb und uns hervor, als aus einer gesetzlichen Regelung. Insofern haben alle an der Finanzierung und Auswertung eines Films Beteiligten ein veritables Interesse, dass der jeweils von ihnen bespielte Teil der Kaskade so gut wie möglich zur Refinanzierung beiträgt. Dabei ist man lange der Meinung gewesen, dass die Exklusivität gegenüber den unterschiedlichen Auswertungen eigentlich die beste Gewähr für eine optimierte Auswertung ist. Es gab international immer wieder Experimente, die versucht haben, das zu durchdringen. Ich kenne in Deutschland aber kein solches Experiment, das tatsächlich eine vollwertige Kino- und parallel DVD-, VoD oder TV-Auswertung vorgenommen hätte. In dem Moment, in dem Kinos beteiligt sind, wollen diese ihren exklusiven Zeitraum von vier Monaten gesichert sehen. Ich denke, eine Auswertungskaskade nützt den Beteiligten. Es macht aber auf Grund der technischen Entwicklungen durchaus Sinn, Denkmuster aufzubrechen und zu überlegen, ob neue Geschäftsmodelle oder angepasste Auswertungskaskaden evtl. denselben Parteien ebenfalls Rückflüsse generieren könnten.
Sie sehen also eine Chance in der neuen Sichtweise auf die Auswertungsfenster?
Die Regelungen werden sich in jedem Fall weiter bewegen müssen. Gewisse Rechte, die wir im Moment weiter hinten in der Auswertung sehen, gewinnen an Gewicht und schieben sich weiter nach vorne. Ein sehr konkretes Beispiel ist unser Film „Welcome to New York“, der aufgrund seiner Thematik im Wesentlichen für ein französischen Publikum von Interesse ist und dessen Herausbringung in Frankreich auch mit großem Marketingaufwand bedacht war. Er wurde mit einer nahezu vollwertigen Kino-Kampagne beworben, startete aber parallel zur Welt-Premiere in Cannes auf sämtlichen großen On-Demand-Plattformen in Frankreich für einen Preis von sieben Euro, was letztendlich nahezu einem Kino-Ticket-Preis entspricht. Für ein frühes Fenster von 6 Wochen gab es den Film also nur zum Streamen – vollkommen ohne Kinoauswertung. Dieses Premium-VoD war ein Versuch, den wir alle schon lange einmal vornehmen wollten. Für Deutschland ist das Ergebnis weniger kennzeichnend für zukünftige Entwicklungen, weil der Film hier trotz der enormen medialen Aufmerksamkeit beim Endkunden geringes Interesse ausgelöst hat und einfach für unser Territorium weniger geeignet war. Für Frankreich war der Film aber sehr geeignet und konnte in den ersten Tagen mehr als 100.000 views verzeichnen – für sieben Euro. Das kann man schon als ein erfolgreiches Experiment bezeichnen, denke ich. Ob der Film dieses Ergebnis an der Kinokasse erreicht hätte ist fraglich. Das Experiment als solches hat bereits ein Medienecho ausgelöst, es handelt sich zudem um einen arthousigen Film und 100.000 Views sind nicht zu unterschätzen. Es wird in Zukunft sicher breiter diskutiert werden, ob so etwas für entsprechende Filme öfters passieren könnte. Man muss in dem Zusammenhang auch sehen, dass sich die Kinolandschaft als solche ebenfalls stark verändert hat und sehr viele Filme, die sehr wahrscheinlich bei einer etwas längeren Auswertungszeit ihr Publikum im Kino finden würden, am Start-Wochenende nicht ausreichend gegen die starke Konkurrenz bestehen und schnell wieder aus den Kinos verschwinden. Das führt dazu, dass viele Filme im kleinen und mittleren Segment gar nicht mehr ins Kino kommen, weil sie dort dem Aufwand nicht gerecht werden und zu schnell wieder von der Leinwand verschwinden. Eine Kinoauswertung als solche erfolgt oft dann überhaupt nicht. Sind das nicht trotzdem Filme, die ein Publikum finden könnten? Ist die Auswertungsart von „Welcome to New York“ nicht vielleicht eine, die für solche Filme geeignet ist? Warum nicht? Sperrfristen als solche und die Auswertungskaskade ist meiner Ansicht nach weiterhin sinnvoll. Ob dieselbe Kaskade und dieselben Sperrfristen für jeden Film sinnvoll sind, ist mit Sicherheit zu überdenken.
Angenommen, man würde die Sperrfristen vollkommen abschaffen: was wären Ihrer Meinung nach die Risiken?
Wie gesagt, wir agieren bei internationalen Filmen nahezu frei von gesetzlichen Sperrfristen. Die Sperrfristen, die wir einhalten sind mit den Branchenteilnehmern in Vereinbarungen entstanden. Bei einem Film, den wir mit entsprechendem Aufwand im Kino veröffentlichen wollen, ist es selbstverständlich, dass die Bedürfnisse der Kinos einzubeziehen sind und ihnen eine Schutzfrist zuzugestehen ist, um ihre Rückflüsse zu maximieren. Ob das bei jedem Film in genau gleicher Weise erfolgen muss, finde ich allerdings fraglich. Seitens der Kinos gibt es natürlich die Bedenken, dass bei einer Auflösung der Exklusivität Zuschauer verloren gehen, weil andere, parallel stattfindende Auswertungsformen attraktiver sein könnten. Das ist möglicherweise aber gar nicht so. Möglicherweise ist eine Anbieter übergreifende, gestiegene Aufmerksamkeit allen Beteiligten an der Verwertungskette – inklusive der Kinos – zuträglich. Man kennt das durchaus in anderen Bereichen, denn Video Verkäufe werden durch eine Free-TV Ausstrahlung durchaus beflügelt. Die Leute sind alleine dadurch, dass der Film in ihrer Wahrnehmung gestiegen ist, bereit, Geld auszugeben, auch wenn er noch in einer Mediathek verfügbar ist. Die Filmauswertung ist immer ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Beteiligten. Ignoriert man die jeweils veritablen Interessen eines Partners, wird man nicht weiterkommen. Ein Durchbrechen der branchenüblichen Regelungen ohne mit den Parteien zu reden wird es zumindest von unserer Seite aus nicht geben und ich glaube auch nicht, dass das Sinn ergibt.
Schließt sich daraus nicht, dass das Risiko vernachlässigbar gering ist gegenüber der von Ihnen erwähnten Chance für spezielle Filme?
Das hat immer mit Machtverhältnissen zu tun. Wir haben von unserer Größe und Ausrichtung weniger Markteinfluss, als beispielsweise amerikanische Majors, die zusätzlich zu ihren internationalen Blockbustern – die für die Kinos enorm wichtig sind – auch große deutsche Produktionen haben. Würde man die gesetzlichen Regelungen vollkommen abschaffen, kann es natürlich sein, dass die Marktführer das ausnutzen würden. Was es braucht, ist glaube ich eine Flexibilität für die unterschiedlichen Filme, mit denen wir alle zu tun haben. Warum soll für einen kleineren Arthouse Film, der sein Publikum auf Grund der Konkurrenz-Situation nur kurzzeitig im Kino erreichen kann, nicht nach einer von mir aus sechswöchigen Exklusivzeit in einem Premium-VoD Angebot weiter seine Kunden finden? Was spräche dagegen, wenn die eigentliche Kinoauswertung zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon vorbei ist? Die Sorge ist ggf., dass die Gewohnheit entsteht, einen Film nicht mehr im Kino sehen zu müssen, wenn er so schnell auf anderem Weg verfügbar ist und dass das Publikum dann von vornherein damit plant, den Film nicht im Kino anzuschauen. Das ist eine Sorge bei jeder Verkürzung der Sperrfrist. Aber hatte es tatsächlich eine negative Auswirkung auf die Kino- bzw. Videoverwertung, dass z.B. Free- und Pay-TV näher an die Kino- und Videoauswertung herangerückt sind?
Wird es irgendwann zu einer vollkommenen Aufhebung der FFG Sperrfristen kommen?
Ich glaube nicht, dass es mittelfristig zu einer Aufhebung der FFG Sperrfristen kommt und ich glaube auch nicht, dass das ratsam wäre. Sie sind natürlich in ihrer jetzigen Ausgestaltung permanent in Diskussion und die Art der Auswertung und die Zerstückelung der Rechte wird ohnehin immer größer, insofern könnte man beispielsweise eine separate Sperrfrist für eine T-VoD Auswertung und eine S-VoD Auswertung überlegen. Aber warum soll es nicht ein Premium-VoD geben können ohne die Sperrfristen zu verletzen? Das ganze FFG geht sehr stark von einer Kinoauswertung zu Beginn aus – fraglich ist, ob das noch für jeden Film angemessen ist. Eine mit einer entsprechenden Kampagne versehenen Premium-VoD Auswertung ist sicherlich ein denkbares Modell. In diese Richtung müsste man in jedem Fall denken, denn das Publikum, das prinzipiell bereit ist, Geld für Filme auszugeben muss das nicht zwingend nur im Kino tun. Wohin genau die Reise geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube es braucht für unterschiedliche Filme eine unterschiedliche Sichtweise und dafür ein Gespräch zwischen den Parteien. Die Bedürfnisse der Kinos sind voll zu hören, aber gegebenenfalls ist für die entsprechenden Filme eine Premium-VoD Auswertung früher als vier Monate nach Start gar nicht so schlecht. Flexibilität bei allen beteiligten wird in jedem Fall erforderlich sein. Gesetzliche Regelungen sind eigentlich nicht für Flexibilität gemacht, aber ich finde es bewegt sich ohnehin relativ viel im Bereich der Sperrfristen und so weit die Flexibilität gegeben ist, funktioniert sie ja wunderbar. Auch die EU nimmt Einfluss auf die Regelungen, wogegen sich die FFA auch nicht ganz verschließen kann. Es gibt das Erfordernis für Experimente aber auch viele Ängste, die beachtet werden müssen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich aufnehme und das aufgenommene Material für meine Diplomarbeit verwende?
Absolut. Das habt ihr gut beigebracht bekommen, immer zu fragen!
Ausgehend von deinem Berufszweig, wo siehst du Chancen in der Abschaffung der FFG Sperrfristen?
Ich bin da immer sehr hin und hergerissen. Für erfolgreiche Filme wäre ein Fehlen von Sperrfristen schlecht, weil man den kleinen Kinos die Grundlage entziehen würde. Kleine Kinos bekommen große Filme meist nicht zuerst, spielen sie aber sehr viel länger sodass ein Film auch auf dem Land im Kino zu sehen ist, bevor es ihn auf DVD oder im Pay-TV gibt. Auf der anderen Seite kann es für einen Film, der floppt ein großer Vorteil sein, ihn relativ schnell auf DVD zu veröffentlichen bzw. ins Pay-TV oder Fernsehen zu schieben, um dann noch von der bestehenden Werbewirkung zu profitieren. Das heißt, auf der einen Seite finde ich die Sperrung gut, andererseits finde ich, man müsste sie viel individueller anpassen. Die Amerikaner machen es vor: erfolgreiche Filme halten sich an die Sperrfristen, wenn ein Film aber floppt, wird der Video-Start vorgezogen und plötzlich ist die DVD nach zwei oder drei Monaten im Handel. Das kann ein Vorteil für das Gesamt-Recoupment des Produzenten sein, weil man den restlichen Schwung der Werbung noch mitnimmt und der Film im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer und Konsumenten ist.
Es besteht also ein Risiko des Recoupment-Verlustes, wenn Sperrfristen dazu führen, dass ein Film nicht ins Kino gebracht werden kann?
Zumindest nicht so schnell ins Kino gebracht werden kann. Das größte Problem bei den Sperrfristen hat ja erst einmal das Fernsehen, aber natürlich hängt das Ganze auch mit den VoD, Pay-Per-View, DVD- und Blu-Ray-Rechten zusammen, denn die können ja noch am meisten von einer Kino-Promotion profitieren.
Es gibt ja auch gerade eben schon die Möglichkeit, die Sperrfristen zu verkürzen. Glaubst du, die bestehenden Regelungen sind ausreichend?
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass es eine Flexibilität gibt. Wir selbst haben diese schon in Anspruch genommen. Manchmal um ein paar Wochen, manchmal sucht man sich das ideale Datum wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten. Natürlich sind bei einem Katastrophal-Flopp vier Monate auch eine lange Zeit. Wenn man da ein bisschen schneller sein könnte, wäre das ein großer Vorteil. Die Sperrfristverkürzung um ein oder zwei Monate ist richtig. Vielleicht sollte man aber versuchen, eine besucherabhängige Möglichkeit zu schaffen, die Fristen noch weiter zu reduzieren. Ist ein Film unter einer bestimmten Anzahl an Zuschauern geblieben, sollte man einen solchen Antrag stellen können. Die Sperrzeitverkürzung ist ja eigentlich immer ein Schutz des vorangegangenen Mediums. Das FFG ist aber ja nicht mehr so daran interessiert, die DVD Auswerter zu schützen sondern agiert nach einem Schema, wie es für erfolgreiche Filme passen würde. Wenn aber die DVD bereits früher erscheint, müsste man wesentlich früher auch die TV-Ausstrahlung machen können, um für alle auch das Geld zurück zu spielen. Wenn man eine Regelung für einen Sonderantrag zur Sperrfristenverkürzung um mehr als nur ein oder zwei Monate finden würde, wäre das großartig.
Wie siehst du die zukünftige Entwicklung der Sperrfristen? Wird es durch den Druck aus Amerika langfristig zu einer Aufhebung kommen?
Die Amerikaner mussten sich mit ihren nicht geförderten Filmen noch nie an die Sperrfristen halten, tun es aber meistens trotzdem. Meistens, denn manchmal gibt es Produktionen, die floppen und nur zwei Monate später gibt es die DVD im Handel. Der Druck aus Amerika ist nicht so extrem stark, weil das FFG ihre Kernprodukte nicht betrifft. Natürlich sind amerikanische Studios auch an deutschen Produktionen beteiligt, dennoch glaube ich, dass man die Restriktionen auch nicht überbewerten sollte. Die Diskussion wird ja schon lange geführt. Ich finde die vom FFG geregelten Sperrfristen wichtig, um die kleinen Kinobetreiber zu schützen. Ein Film wie Fack Ju Göthe wurde sechs Monate lang gespielt, sodass auch jedes Hinterland-Kino eine Kopie bekam. Durch die Verbreitung von DCPs ist das Ganze aber ohnehin nicht mehr so schwierig. Früher gab es beispielsweise 50 Kopien für einen kleinen Arthouse Film aber 100 Kinos, die ihn spielen wollten, sodass die Kopien weitergeschickt wurden, was lange dauerte. Mit DCP geht das schneller. Die Sperrfrist, die garantieren sollte, dass der Film auch vollständig ausgewertet wird, ist demnach auch nicht mehr ganz aktuell. Mit sechs Monaten Sperrfrist können auch die kleinen Kinos den Film bis zuletzt spielen. Wenn aber ein Film wie Fack Ju Göthe auf DVD kommt, könnte ein Verleiher auch das Interesse haben, die Kinokopien einen Monat vorher aus den Kinos abzuziehen, um dann die DVD groß einsteigen zu lassen. Aber wie gesagt, durch die DCP ist die Sache ohnehin nicht mehr so relevant, weil heutzutage ein Stick für das Einladen auf mehrere Kino-Server verwendet wird.
Du glaubst also, die FFG-Regelung der Auswertungsfenster haben ihre Berechtigung?
Ja, das stimmt. Dennoch glaube ich, man sollte die Sperrfristen-Regelung auf Grund der neuen Markt-Situation überdenken. So, wie sie jetzt ausgelegt sind, sind sie einfach nicht mehr zeitgemäß. Man sollte die Sperrfristen nicht abschaffen aber in Zukunft flexibler gestalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr C., ist es für Sie in Ordnung wenn ich Sie aufnehme und das aufgenommene Material für meine Diplomarbeit verwende?
Ja, ist es.
Eine kritische Frage gleich zu Beginn: Glauben Sie, die öffentlich-rechtlichen Sender erleiden durch die FFG-Sperrfristen einen Nachteil?
In der vorliegender Form würde ich sagen: ja. Aber auch die Produzenten haben einen Nachteil, weil sie zum Teil unnötig lange nicht an ihre Projekte kommen. Niemand mehr wertet im Kino die vollen 18 Monate aus. Beim Kino-Dokumentarfilm würden schon sechs Monate vollkommen ausreichen. Wir (der Bayerische Rundfunk, Anm. d. Verf.) werten eine Koproduktion 5 Jahre aus, bei weniger als 5 Jahren macht es keinen Sinn, viel Geld zu investieren. Begänne diese Laufzeit schon nach 6 Monaten anstatt nach 18, bekäme der Produzent seinen Film ein Jahr früher zurück. Es würde allen Beteiligten entgegen kommen, der Produzent könnte die weitere Auswertung schneller bestimmen. Nehmen Sie den neuesten Vorschlag von Jeffrey Katzenberg, die Kinoauswertung auf 17 Tage zu beschränken – in Amerika wird das bereits heiß diskutiert. Sie haben 17 Tage exklusive Kinoauswertung und nach 17 Tagen gleichzeitig VoD, Pay-per-view, Free-TV, etc.. Für viele ist das ein Horror-Szenario und ich sage auch nicht, dass das die beste Lösung ist. Aber ich glaube, dass dies eine Richtung zeigt, wohin das Ganze gehen kann und wird. Eine Flexibilisierung der Verwertung ist unumgänglich. International sind Hunderte von Filmen ‚unterwegs‘ und eine kreative Offenheit ist gefordert.
Es besteht ja bereits eine gewisse Flexibilität in Form von Sperrfrist-Verkürzungen, die beantragt werden können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss und wird sich diese aber noch ausweiten?
Ich denke ja. Auch im Interesse der Produzenten. Gehen wir davon aus, dass ein Sender mit einem Drittel an einem Projekt beteiligt ist und der Film läuft im Kino gut, ist mein Interesse als Programm-Macher doch, den Film so bald wie möglich selbst ausstrahlen zu können. Hier bin ich aber auf die Gunst des Produzenten angewiesen, denn nur er, und nicht der Sender, kann eine Entsperrung beantragen.
Glauben Sie, es wäre sinnvoll, die Sperrfristen komplett abzuschaffen?
Es ist sicher sinnvoll in einer Branche, die vor allem über Fördersysteme funktioniert, gewisse Spielregeln festzulegen. Als Worst-Case Beispiel: Sie bieten mir ein Buch an, das wir gemeinsam verfilmen. Die Kinoauswertung funktioniert gut und nun will ich den Film schnellstmöglich im Fernsehen zeigen. Als Sender könnte ich Druck auf Sie als Produzent ausüben, mir den Film zu überlassen, obwohl eine weitere Kinoauswertung noch erfolgreich wäre. Das wäre kontraproduktiv, weswegen Spielregeln einfach wichtig sind, denn die Förderung will den Produzenten ja in die Lage versetzen, auch wirtschaftlich zu reüssieren zu können. Dennoch plädiere ich für Lösungen, Vorgänge zu beschleunigen, und Auswertungsmöglichkeiten zu optimieren. Was mich dabei stört, ist, dass wir dabei vom Gutdünken des Produzenten abhängig sind. Die Sender müssten hier auch handeln können. Eine flexiblere Gestaltung von etwaigen Sperrfristen sind zukünftig unvermeidbar, das wird letztlich auch die technologische Entwicklung erzwingen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr D., ist es in Ordnung, wenn ich Sie aufzeichne und Ihre Antworten zum Schreiben meiner Diplomarbeit verwende?
Das können wir gerne machen.
Wenn Sie von Ihrem Berufszweig ausgehen, profitieren Sie von den Sperrfristen?
Ja, das tun wir. Als Kinobetreiber müssen wir uns im Reigen der multimedialen Angebote positionieren und absetzen. Das Kino hat dabei einige Stärken. Die erste davon ist sicherlich die Qualität der Filmvorführung, also eine große Leinwand, ein hochwertiges Bild und eine Soundqualität, die sich zuhause so nicht reproduzieren lässt. Auch das Gemeinschaftsgefühl ist eine ganz wesentliche Besonderheit des Kinobesuchs. Die dritte Stärke aber die Exklusivität der Inhalte. Wer einen Film in Deutschland in den ersten vier Monaten legal sehen will, dem bleibt in der Regel nichts anderes übrig, als ins Kino zu gehen. In dem Moment, in dem die Sperrfristen verkürzt werden, bedeutet das natürlich eine Schwächung der Auswertungsstufe Kino.
Die Entwicklungen in diesem Gebiet sind im Moment heiß diskutiert. Wo sehen Sie persönlich denn die Risiken bei der Abschaffung der Sperrfristen?
Aus Kinosicht sehe ich das Risiko vor allem in einer Kannibalisierung des Kinokonsums zu Gunsten des Konsums von Filmen in anderen Medien, z.B. Video on Demand. Ob das auf Basis eines subscription-Modells stattfindet oder als EST ist dabei irrelevant – in jedem Fall findet der Konsum nicht im Kino statt. Sicherlich wird es im Einzelfall kleinere Filme geben, bei denen eine Sperrfristenverkürzung das Kinoergebnis nicht wesentlich beeinflusst, aber wo will man hier die Grenze ziehen? Ein großes Problem liegt für uns weiterhin darin, dass wir nicht nur unseren Anteil an der Kinokarte, sondern auch die Umsätze und Deckungsbeiträge aus unseren Nebenerlösen beispielsweise durch den Verkauf von Popcorn und Getränken verlieren. Die beiden Säulen Ticketerlöse und Nebenumsätze sind unsere Haupteinnahmequellen mit denen wir die hohen Fixkosten im Personal- und Gebäudebereich decken müssen. Geringfügige Besucherrückgänge können uns daher bereits empfindlich treffen und weit reichende Auswirkungen auf die Profitabilität haben.
Viele Filme werden bezüglich der Sperrfristen ja jetzt schon sehr individuell gestaltet und die Tendenz geht in dieselbe Richtung. Sehen Sie abgesehen von den von Ihnen dargestellten Risiken auch Chancen für Kinobetreiber, diese Entwicklung zu nutzen?
Eine richtige Chance besteht eigentlich nur in der Teilnahme an einem der neuen Modelle. Das bedeutet, man würde sich vom klassischen Betrieb lösen und in ein anderes Geschäftsmodell investieren. Das heißt aber nicht, dass wir als Kino davon profitieren würden, sondern, dass wir den Schaden in unserem Kerngeschäft durch die Teilnahme an neuen Erlösmodellen zumindest teilweise kompensieren würden. Grundsätzlich muss im Falle einer Sperrfristenverkürzung sehr genau überprüft werden, für welche Filme sich alternative Modelle anbieten. Vor dem Hintergrund der enttäuschenden Ergebnisse einiger Modellversuche bin ich mir nicht sicher, ob die von Ihnen angesprochene Tendenz so eindeutig ist. Die bisherigen Versuche, durch eine Verkürzung der Sperrfristen Kapital zu schlagen – zum Beispiel über Premium-VoD – waren noch nicht durchschlagend. Ich glaube, dass in bestimmten Bereichen sehr klar geworden ist, dass es durchaus sinnvoll ist, die Sperrfristen aufrecht zu erhalten und dasselbe Produkt drei- bis viermal zu verkaufen. In dem Moment, in dem alle Auswertungen auf den gleichen Zeitpunkt gelegt werden, sind nicht nur Kinos negativ betroffen sondern auch stationäre Videotheken, der Verkauf von physischen Datenträgern und die Fernsehausstrahlung.
Wenn überhaupt sehe ich Ansatzmöglichkeiten im Bereich der so genannten Supertickets bei denen eine digitale Kopie eines Films beim Kauf einer Kinokarte für diesen Film mit verkauft wird. Das ist insofern interessant, weil der Kinobetreiber den Besucher für diesen Film bereits zumindest einmal im Kino bezahlt hat. Aber auch hier entsteht der wahre Wert für den Kunden erst dann, wenn die Nutzung der digitalen Kopie vor Beginn des regulären VoD / EST-Fensters liegen würde. In diesem Zusammenhang gab es bereits Diskussionen, denen zu folge Kinobetreibern ein spezielles Auswertungsfenster zugesprochen werden könnte, womit die Sperrzeitenverkürzung sozusagen erkauft werden kann. Aber auch das sehe ich kritisch, weil das eigentlich nur eine Vorstufe der generellen Sperrzeitenverkürzung ist und wir immer nur an dem Umsatz beteiligt werden können, der mit der Film gemacht wird. Den Umsatz, den die Kinobetreiber an der Popcorn-Theke verlieren, kann hingegen - verständlicherweise - niemand bezahlen. Man müsste also eigentlich Händler werden. Für uns als mittelständisches Unternehmen ist es aber kaum möglich mit der Marktkraft von Unternehmen wie Amazon oder Netflix mitzuhalten.
Prof. Dr. Hennig-Thurau macht deutlich, dass die Filmwirtschaft sich den gerade vonstatten gehenden Entwicklungen nicht in den Weg stellen darf. Wie schätzen Sie persönlich denn die Zukunft des Marktes in Deutschland ein?
Zufälliger Weise kenne ich Herrn Hennig-Thurau. Sicherlich ist es richtig, dass man bestimmte Entwicklungen nicht grundsätzlich aufhalten kann. Für jemanden, der aber nicht davon profitiert bzw. davon bedroht ist, bedeutet das aber noch lange nicht, dass man sich an die Spitze der Entwicklung stellen muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einen zunehmenden Druck auf das Auswertungsfenster geben wird, auch wenn wir in Deutschland zumindest teilweise noch durch das FFG geschützt sind. Bei der letzten Novelle gab es ja keine Bestrebungen die vier bzw. sechs Monate zu unterschreiten und wir würden uns sicherlich auch dagegen wehren, falls dies angestrebt werden sollte. Zumal es bisher noch keinerlei Signale gab, dass man die Fensterverkürzung in irgendeiner Weise kompensieren wollte. Anzunehmen, dass wir etwas hergeben, ohne etwas dafür zu bekommen ist illusorisch. Aber selbst das, was wir als Kompensation bräuchten, würde niemals die Verschlechterung unserer Situation kompensieren. Wir würden uns deshalb so lange wie möglich gegen die grundsätzliche Verkürzung der Fenster sträuben. Mittel bis langfristig glaube ich, dass es eine Verkürzung, evtl. sogar einen kompletten Wegfall des Fensters geben wird, allerdings bei weitem nicht so schnell, wie manch einer unterstellt. Das Thema ist bereits seit einigen Jahren im Gespräch und bisher noch nicht eingetreten. Das Zugpferd Kino wird nach wie vor dringend benötigt. Ob eine Premiere online oder im Kino stattfindet, ist einfach ein großer Unterschied.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als erste Frage: ist es in Ordnung, wenn ich das Gespräch aufzeichne und die Aufzeichnung für meine Diplomarbeit verwende?
Das ist in Ordnung.
Ausgehend von Ihrer Branche, haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die freiwilligen und gesetzlichen Sperrfristen so, wie sie gerade sind, eher nützen oder eher schaden?
Die Auswertungssperren zwischen drei und sechs Monaten sind für die Videobranche ok. Es ist ein Nachteil für uns, wenn die Online-Videotheken die Filme vorher bekommen.
Ist das momentan der Fall?
Ab und zu. Von manchen Firmen wird es getestet.
Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Das Ganze befindet sich gerade wie gesagt noch in der Testphase und man kann noch wenig feststellen. Wenn man die Plattformen anschaut, macht keine davon gerade Gewinn. Das ist eine reine Geldvernichtungs-Maschine, sie tun sich zur Zeit genauso schwer, wie wir. Wir sind in einer Umstrukturierungsphase und da muss man erst einmal schauen, wo der Weg hingeht. Grundsätzlich tut sich natürlich jede Videothek schwer, die Umsätze sind in den letzten fünf Jahren eingebrochen. Aber man sieht, dass gerade junge Leute auch wieder in die Videothek kommen, weil die Programmvielfalt sehr groß ist und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die zusätzlichen Kosten, die Plattformen haben sind gerade einfach zu hoch.
Wo sehen Sie denn Chancen oder Risiken, wenn man die Sperrfristen komplett abschaffen und Day-and-Date Releases einführen würde?
Für die Videotheken wäre das natürlich ein Traum aber nicht so für die Kinos. Wenn die Auswertungsfenster wegfallen würden, wäre das schlecht, denn man muss auch wieder Geld einnehmen, damit neue Filme produziert werden können. Die Raubkopierer, die kein Gewissen haben stehlen die Filme. Das führt auf Dauer dazu, dass keiner mehr Geld hat, neue Filme zu produzieren. Was wollen sie dann noch runterziehen vom Netz? Da ist die Hemmschwelle in Deutschland und international immer noch sehr gering.
Sie sehen die Abschaffung der Sperrfristen also nicht als Chance?
Das wäre zwar schön für unsere Branche, klar, aber ob dadurch noch genügend Geld eingespielt wird, um weiter Filme herzustellen ist fraglich. Insofern ist es vielleicht wieder nicht so gut. Es soll ja jeder seine Chance haben. Ich will auch nicht, dass Online-Videotheken bevorzugt werden. Wenn sie Day-in-Day Releases zeitgleich mit uns bekommen, dann ist das in Ordnung, dann kann sich der Kunde heraussuchen, was er will. Aber die Kinos sollten schon ein bisschen Vorsprung haben.
Sie sehen also einen Vorteil, wenn der Film erst im Kino läuft?
Auf alle Fälle. Das ist ja auch Werbung für uns. Und wenn die Filme besonders gut sind, schauen sie viele auch noch einmal auf DVD an. Wenn ein Blockbuster ein bis zwei Millionen Kinozuschauer hat, ist das für uns nicht schlecht. Nur dass alle meinen, sie müssten Online-Dienste hofieren und bevorzugen finde ich nicht gut. Die Filmhersteller und Vertriebsfirmen haben die letzten 20 Jahre auch von uns gelebt. Das haben ein paar von ihnen vergessen. Wie zum Beispiel Fox. Für unsere Branche ist Fox die schlimmste Firma, die es gibt.
Fox bietet ja DVDs zum Verkauf an, bevor sie in die Videotheken kommen...
Dieses Modell ist momentan in der Versuchsphase. Aber auch nicht für alle Titel. Die weniger guten Filme bieten sie Day-and-Date an, die bekommen wir gleich. Die Blockbuster bekommen wir immer etwas später. Dadurch haben viele Videotheken die Stückzahlen drastisch reduziert. Auch ich würde eine größere Stückzahl von Fox kaufen, wenn das nicht wäre.
Auch dieses Modell befindet sich wie gesagt in der Testphase. Wie schätzen Sie denn die zukünftige Entwicklung für Ihre Branche ein?
Wir müssen mal schauen, wo der Zug hingeht. Das ist momentan schwer einzuschätzen. Es wird immer ein paar Leute geben, die bei uns DVDs leihen, wenn man eine gute Auswahl hat und ein bisschen Rahmenprogramm macht. Was die Fristen angeht bin ich dafür, dass die drei Monate für die Kinos erhalten bleiben. Das Schlimmste sind einfach diejenigen, die sich die Filme illegal herunterladen. Das ist schlecht für das Kino, für uns, für die ganze Branche.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr F., ist es in Ordnung, wenn ich Sie aufzeichne und die Aufzeichnung für meine Diplomarbeit verwende?
Na klar.
Wenn Sie von Ihrer Branche ausgehen, wie bewerten Sie die momentanen Auswertungsfenster in Deutschland?
Zunächst einmal wird durch die Distributionspolitik das Aussehen der Geschäftszweige definiert. Gäbe es keine Auswertungsfenster für VoD, Pay-TV oder Free-TV, gäbe es auch das jeweilige Geschäftsmodell dahinter nicht. Insofern werden der Industrie durch die Existenz der Auswertungsfenster Möglichkeiten geschaffen. Wenn man dieses Modell allerdings so belässt, wie es sich traditionell entwickelt hat und sich nicht den Gegebenheiten der heutigen Welt anpasst, stellt das ein Risiko dar.
Würde eine Abschaffung der traditionellen Auswertungsfenster bzw. die Etablierung von Day-and-date Releases nicht ein Risiko für Ihre Branche darstellen?
Wenn man auf den bisherigen Distributionswegen beharrt, wird unser Angebot schlimmstenfalls am Konsumenten vorbei gehen. Was Sie ansprechen bezieht sich ja auf den klassischen Kinofilm, denn Day-and-date Releases haben wir durchaus und sie gehören zu unserem Geschäftsmodell. Geht man vom Kino aus, verschieben sich die Verwertungsfenster aber immer weiter in Richtung des Kinostarts. Eine komplette Abwendung von der traditionellen Fensterpolitik bedroht besonders die Geschäftsmodelle der Verleiher und Kinobetreiber. Wenn man sich doch nicht darauf einstellt, was ein Kunde eigentlich will, dann werden die Traditionen auch nicht helfen, Geschäftsmodelle aufrecht zu erhalten. Wird ein Kinofilm zukünftig also nicht auf die Art und Weise verwertet, wie der Kunde es möchte, dann geraten die Verwerter zunehmend unter Druck. Diese Diskussion zieht sich bereits sehr lange und immer wieder hört man von Filmemachern, dass eine Veränderung des Distributionsmodells den Erfolg der Auswertung schmälern würde. Die bisherigen Prognosen in dieser Hinsicht waren weitestgehend falsch – das Fernsehen bedeutete nicht das Ende des Kinos. Ich beobachte die Diskussion um die Verwertungsfenster seit beinahe 20 Jahren und jedes Mal, wenn die Fenster weiter zusammenrücken, beschwert sich derjenige, dessen Position scheinbar benachteiligt wird. Ein Problem, das aber alle Beteiligten vom Produzenten bis zum Free-TV Sender betrifft, ist die Piraterie. Es hat sich nun mal gezeigt, dass Kunden, die ein Produkt nicht da konsumieren können, wo sie es möchten, sich einen anderen Weg suchen.
Prof. Hennig-Thurau fordert ja gerade deshalb, eine Abkehr von dem traditionellen Modell in Deutschland.
Nicht nur durch meine eigene Professur an der MHMK, sondern auch auf Grund meines Berufs bei Xxxxxxx Xxxxxxx beschäftige ich mich permanent mit den Auswertungsfenstern. Was oft in den Diskussionen vergessen wird ist, dass es am Ende darum geht, was Kunden bzw. Besucher wollen. Und mit den heutigen technischen Mitteln wird es immer schwieriger, sie davon abzuhalten, sich zu holen, was sie wollen. Nehmen wir mal den Extremfall, dass ein Film zukünftig ins Kino kommt und am selben Tag als On-Demand-Produkt erhältlich ist. Vielleicht ist er sogar noch als DVD erhältlich sofern es dieses Modell dann noch geben sollte und zusätzlich läuft er auf einem Bezahl-Sender als Erstausstrahlung. Kinobesitzer und sicherlich auch eine Vielzahl von Verleihern, werden in diesem Szenario den Untergang des Abendlandes sehen. Aus Kundensicht betrachtet, wäre das jedoch für viele ein Anreiz, Geld auszugeben. Am Ende des Tages müsste man dann die Rechnung machen und abwägen, ob sie aufgeht oder nicht. Sehen wir uns die Entwicklung der Fenster in den letzten zehn Jahren an, stellen wir fest, dass ein Film heute in vielen Kanälen teilweise auch parallel konsumierbar ist, ohne dass das Geschäftsmodell zusammengebrochen ist. Das einzige, was feststellbar zurückgegangen ist, ist die Nutzung von Bildträgern, weil diese einfach nicht mehr der Lebensrealität der Konsumenten entsprechen. Noch vor zehn Jahren gingen viele Experten davon aus, dass sich niemand einen Film auf einem kleinen Bildschirm ansehen würde und man wahrscheinlich eigene Inhalte für diese Nutzung schaffen müsste. Die Realität sieht heute anders aus und trotzdem ist der Kinobesuch als solches keinesfalls ausgestorben. Auch wenn der DVD-Markt in Deutschland bisher verhältnismäßig stabil ist, lässt sich der technologie-bedingte Wandel deutlich feststellen. Es gibt Parallelen zur Entwicklung von der Musik-Kassette zur CD. Die Nutzung an sich ist jedoch gestiegen, weil die Verfügbarkeit hergestellt worden ist.
Sie haben zudem die Sperrfristen erwähnt. Diese sind meiner Ansicht nach ein Überbleibsel aus dem 20. Jahrhundert und hängen in Deutschland vor allem noch mit den Förderungen zusammen. Ihrer Definition nach lassen sie teilweise die Verwertungskette für den Film im Pay-Bereich unmöglich werden. Das führt dazu, dass der Film schlicht und ergreifend nicht die Erlöse aus der Pay-Verwertungskette bekommt, die er ohne die Restriktionen bekommen würde. Das ist heutzutage ein klarer Wettbewerbsnachteil für unsere Branche. Der Grund für die Sperrzeiten war ursprünglich, dass man geglaubt hat, durch die länger stattfindende Verwertung höhere Erlöse erzielen zu können. Diese Herangehensweise passt aber nicht mehr zur heutigen Zeit.
Sie würden also für eine Flexibilisierung der Sperrfristen plädieren?
Ich brauche keine Flexibilisierung, ich würde die Sperrfristen schlicht und ergreifend abschaffen. Eine erlösorientierte Verwertung ist für beide Seiten sinnvoll.
Wie würden Sie denn die zukünftige Entwicklung in dieser Hinsicht einschätzen?
Unsere Branche ist Wachstums-Branche. Wir wachsen jedoch nicht auf Kosten von anderen. Der werbe-finanzierte Markt wächst leicht, der öffentlich-rechtliche Markt, der sich in Deutschland durch Gebühren finanziert, erhält seine Größe während die Nachfrage für Bezahl-Fernsehen sehr stark zunimmt – sowohl im linearen als auch im On-Demand-Bereich. Das geschieht nur deswegen, weil Konsumenten bereit sind, für Inhalte Geld auszugeben. Sie wollen sie aber auf eine bestimmte Art oder früher konsumieren und dafür besteht eine wachsende Zahlungsbereitschaft. Wenn Sie so wollen, ist jeder Kinobesucher in Deutschland großzügig, weil er weiß, dass der Film irgendwann im Fernsehen zu sehen ist. Dieses Phänomen wird meiner Meinung nach eher noch zunehmen. Das bedeutet, dass insgesamt mehr Geld erwirtschaftet wird und demnach mehr Geld auch für die Produktion zur Verfügung steht. Das Verlangen der Konsumenten nach Inhalten ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Ich sehe keine Tendenz zu einer Veränderung dieser Tatsache. Ob Fernseher, Smartphones, Tablets, Computer, Autos, Züge, Flugzeuge – überall werden Sie mit Bildschirmen konfrontiert, über die Sie Inhalte konsumieren wollen. Statistisch gesehen gibt es in Deutschland sehr viele Drittfernseher: neben dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer werden auch Badezimmer und Küchen immer beliebter. Etwas Besseres kann einer Industrie eigentlich nicht passieren. Und wenn die Konsumenten vor 100 Jahren dieselben technischen Möglichkeiten gehabt hätten wie wir heute, hätten sie bestimmt dasselbe getan, wie wir.
Das ist ein sehr positiver Zukunftsausblick. Dennoch eine letzte Frage zu einem unerfreulichen Thema, das Sie bereits kurz angesprochen hatten. Glauben Sie, es wäre möglich, der Piraterie mit einer Veränderung der Auswertungsfenster entgegenzuwirken?
Ja. Auch wenn es aus der heutigen Zeit vielleicht utopisch klingt: angenommen, ein Kinofilm wäre eben nicht nur im Kino sondern gegen bezahltes Entgelt auf allen denkbaren Plattformen verfügbar, würde die Piraterie sinken. Viele der „Piraten“ stehlen die Filme auch nicht mit kriminellem Hintergedanken, sondern weil kein legales Angebot besteht. Der Konsument fordert ein dynamisches Angebot und interessiert sich nicht für die Auswertungsfenster.
Ein zweites Problem ist, dass die Gesetzgeber lange Zeit nicht artikuliert haben, was Film-Piraterie eigentlich ist und wie man sie bestraft bzw. unterbinden soll. Auch heute gibt es noch sehr unterschiedliche Auffassungen, was genau erlaubt und verboten ist. Das ist im Zeitalter der Digitalisierung insofern ironisch, weil klar ist, dass der physische Diebstahl eines Datenträgers, wie z.B. einer DVD in einem Laden, illegal ist. Es wird immer eine gewisse Anzahl von Vorfällen dieser Art geben. Die Illegalität des Vorgangs wird weder von der Gesellschaft noch von irgendeinem Gesetzgeber dieser Welt in Frage gestellt. Stellen Sie sich vor, es würde keine physischen Produkte mehr geben, sondern man würde wie bei Raumschiff Enterprise nur noch zuhause auf eine Taste drücken und das jeweilige Produkt auf digitalem Weg herstellen. Plötzlich haben es Gesetzgeber schwer, zu definieren, was Diebstahl ist und was nicht. Dabei ist jedem, der einen Film herunterlädt, vollkommen klar, was er damit anstellt. Jeder Anbieter mit gesundem Menschenverstand weiß, dass das nicht legal sein kann.
Wir haben bei der Piraterie zwei Probleme: einerseits bietet man dem Kunden nicht das an, was er will und wofür er bezahlen will, andererseits besteht bei der Gesetzgebung Unsicherheit, wie der Diebstahl zu definieren und unterbinden ist. Wir haben keine Global-Regierung, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Gesetzgeber, die sich gegenseitig in die Quere kommen. Das interessiert den Kunden am Ende des Tages nicht. Es entsteht mehr Piraterie, als jemals von Kundenseite aus hätte sein müssen. Wir befinden uns auf dem Weg der Harmonisierung. Verwertungsfenster passen sich an die Realität an. Sie folgen dem Grundsatz „Der Kunde ist König“. Diese Devise ist nicht neu. Sie aber tatsächlich umzusetzen ist gerade in unserer Branche nicht so einfach. Dennoch müsste sich die Piraterie früher oder später dort wiederfinden, wo heute gesetzlich und gesellschaftlich der Ladendiebstahl eingeordnet wird. In jedem Fall ist die Piraterie nichts, was ein Geschäftsmodell zur Auflösung zwingen könnte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr G., Herr H., ist es in Ordnung, wenn ich Sie aufzeichne und die Aufzeichnung zur Erstellung meiner Diplomarbeit verwende?
G.: Ja klar, kein Problem
Bei Ihrem Unternehmen handelt es sich in meiner Befragung um einen Sonderfall, denn Sie sind nicht nur im Free-TV sondern auch im Pay-TV und VoD-Bereich tätig, richtig?
G.: Genau, bei der Auswertungskette sind wir mit unseren bekannten Free-TV-Sendern, aber auch mit unseren Pay-Angeboten wie zum Beispiel ProSieben FUN und dem VoD-Angebot maxdome vertreten - im Prinzip überall, bis auf die Bereiche Kino und DVD.
Von außen betrachtet stehen diese Auswertungsschritte ja zumindest teilweise in Konkurrenz – sehen Sie die momentane Ausgestaltung der Auswertungsfenster eher als positiv oder negativ?
G.: Ich sehe das als gelebte Praxis, die sich in einem komplexen und internationalen Markt mit zahlreichen Partnern und Wettbewerbern etabliert hat. Als großer privater TV-Konzern in Europa liegt unser Hauptaugenmerk natürlich auf Free-TV, unserem Kerngeschäft. Derzeit können wir Kinofilme aus den USA etwa zwei Jahre nach deutschem Kino Start zeigen; das war auch schon mal ein längerer Zeitraum, insofern hat sich die Situation für uns eher verbessert.
Angenommen die Auswertungsfenster würden sich in Zukunft noch weiter verkürzen, sehen Sie eher Chancen oder Risiken?
G.: Würde sich das Fenster für Free-TV verkürzen, bedeutet das ja, dass sich die davor liegenden Fenster ebenfalls verkürzen oder gar nicht mehr existieren. Auf den ersten Blick betrachtet, kann das TV-Sendern große Vorteile bereiten. Wenn Blockbuster kurze Zeit nach Kinostart im TV laufen würden, würden sich manche Zuschauer vielleicht den Weg ins Kino sparen und auf TV warten. Die große Frage ist daher: Wie nah darf die erste Auswertungsform an Kino heranrücken. Dabei ist es eigentlich egal, ob das dann DVD, VoD oder Pay-TV ist. Entscheidend ist: Kino muss geschützt bleiben.
Warum glauben Sie verdient Kino diesen besonderen Schutz?
G.: Kino ist immer noch ein wesentlicher Einnahmefaktor, der zur Refinanzierung einen maßgeblichen Anteil beiträgt. Außerdem verfügt das Kino als Genre nach wie vor über faszinierende Mechanismen, die Filme zu Kult und Schauspieler zu Stars machen. Davon profitieren dann alle weiteren Auswertungsformen, die mit den emotionalen Produkten ihre Kunden begeistern können.
Wäre es aus der Sicht Ihrer Plattform Maxdome nicht eine Chance für Recoupment, wenn Sie Filme sehr früh dort anbieten könnten?
G.: Rein theoretisch gesehen ja. Doch die Filme müssen im Kino auch erst einmal groß werden. Die Filme, die am besten auf den Plattformen laufen, sind Blockbuster und die werden nun mal im Kino gemacht. Maxdome profitiert also vom Kinoerfolg eines Films. Eine komplette Abschaffung der Fenster sehe ich also eher als Risiko.
Mal abgesehen von den Blockbustern, wie sehen Sie die Situation bei Deutschen Filmen, die ja durch das FFG noch mit Sperrfristen belegt sind?
G.: Eigentlich genauso. Ich glaube auch weiterhin an Kino.
Das Maxdome Modell funktioniert momentan sehr gut. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung in dieser Hinsicht?
H.: Derzeit ist Pay-VoD in Deutschland noch ein vergleichsweise kleiner Markt. Wir rechnen aber mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich über 30 Prozent.
Lagen die Umsätze in Deutschland 2013 noch bei 190 Mio, rechnen wir bis 2015 mit einem Umsatz von insgesamt ca. 500 Mio Euro. Langfristig (2018) rechnen wir damit, dass sich der Videomarkt insgesamt vom physischen Markt (DVD, Blu-ray) zugunsten digitalem Markt verschiebt (Anteilig 2/3 zu etwa 1/3).
Kurz: Großes Wachstumspotential durch steigende Breitband-Versorgung, starkes Wachstum im Smart-TV und Second-Screen-Segment, digitale Nutzung verdrängt physischen Markt.
Während die meisten Zuschauer nach wie vor frei empfangbares TV konsumieren, zeigen insbesondere die Jüngeren ein zunehmendes Interesse an „on-demand“-Angeboten. Fernsehen, wann immer und wo immer der Konsument es will, das ist die Erwartung junger Menschen. Mit maxdome, heute schon Marktführer und Deutschlands größte Online-Videothek, sowie den werbefinanzierten Mediatheken unserer Sender-Seiten und dem Videoportal MyVideo bedienen wir diese neuen Nutzungsgewohnheiten, gewinnen zusätzliche Zuschauergruppen und entwickeln innovative Konzepte für die Werbewirtschaft. Auf diese Weise untermauert die Gruppe ihre starke Präsenz in der digitalen Welt.
[...]
[1] http://www.mediabiz.de/film/news/thesen-zur-zukunft-der-filmverwertung/321011/seite-2, S. 2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[2] Vgl. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/regionales-kinosterben-noch-lange-nicht-die-letzte-vorstellung-12312840.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[3] Vgl. http://www.mediabiz.de/film/news/ag-kino-gilde-macht-front-gegen-verzerrtes-bild-von-dayunddate-experimenten/381806, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[4] Ebd.
[5] Vgl. Simon, Herrmann; von der Gathen, Andreas (2010): Das große Handbuch der Strategieinstumente. S. 82.
[6] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[7] Ebd.
[8] Ungericht, Bernhard (2012): Strategiebewusstes Management, S. 112.
[9] Meuser, M., & Nagel, U. (2009): Das Experteninterview, S. 470.
[10] Meuser, M., & Nagel, U. (2009): Das Experteninterview, S. 470.
[11] Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (2009)3: Experteninterviews. S. 56f.
[12] Vgl. Meuser, M., & Nagel, U. (2009): Das Experteninterview, S. 465ff.
[13] Ebd.
[14] Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (2009)3: Experteninterviews, S. 56.
[15] Ebd.
[16] Simon, Herrmann; von der Gathen, Andreas (2010): Das große Handbuch der Strategieinstumente, S. 235.
[17] Ebd.
[18] Ungericht, Bernhard (2012): Strategiebewusstes Management, S. 126f.
[19] Ebd.
[20] Ebd.
[21] 3.1. Definition des Untersuchungsfeldes, S. 15f.
[22] 3.2. Filmförderung und Filmproduktion – 3.11. Aktueller Stand der Filmpiraterie, S. 15ff.
[23] 4. Entwicklungstendenzen und Einflussfaktoren der Branchenumwelt, S. 29ff.
[24] 5. Entwicklung von Szenarien, S. 40ff.
[25] 6. Chancen und Risiken einer Veränderung des deutschen Distributionsmodells, S. 45ff.
[26] 7. Abwägung und Handlungsempfehlungen, S. 60ff.
[27] Vgl. Herrmann, A.; Huber F. (2009): Produktionsmanagement. Grundlagen – Methoden – Beispiele. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. S. 81.
[28] Vgl. Pepels, W. (2012): Handbuch des Marketing, S. 1512.
[29] Vgl. Stender-Monhemius, Kerstin (2002): Marketing. S. 67.
[30] http://www.mediabiz.de/film/news/thesen-zur-zukunft-der-filmverwertung/321011/seite-2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[31] Vgl. ebd.
[32] Vgl. Ungericht, Bernhard (2012): Strategiebewusstes Management, S. 126f.
[33] Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. Recoup! S. 29.
[34] Jacobs, Olaf (2011): Finanzierung von Film- und Fernsehproduktionen. S. 117.
[35] Vgl. Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. S. 82f.
[36] http://www.businessdictionary.com/definition/recoupment.html, letzter Zugriff: 25.08.2013.
[37] Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion S. 81.
[38] http://www.deutschlandradiokultur.de/kino-ohne-filmfoerderung-gaebe-es-keine-deutschen-filme.1008.de.html?dram:article_id=275794, Letzter Zugriff: 25.08.14.
[39] http://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/filmfoerderung/, Letzter Zugriff: 25.08.14.
[40] http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 66 FFG, letzter Zugriff 25.08.2014.
[41] http://www.spio.de/index.asp?SeitID=395&TID=3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[42] Berauer, Wilfried (2013): Filmstatistisches Jahrbuch 2013, S. 38.
[43] Ebd., S. 48.
[44] http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, §47 FFG, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[45] http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Pressemitteilungen/BPA/2012/11/2012-11-07-bkm-ffg-novelle.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[46] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[47] http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Pressemitteilungen/BPA/2012/11/2012-11-07-bkm-ffg-novelle.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[48] http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 20 FFG, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[49] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[50] http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 20 FFG, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[51] Jacobs, Olaf (2011): Finanzierung von Film- und Fernsehproduktionen. S. 118.
[52] http://www.ffa.de/start/content.phtml?page=foerderbereiche_sperrfristen_antrag, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[53] https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[54] http://www.ffa.de/downloads/ffg_2014/ffg_2014.pdf, § 20 FFG, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[55] Vgl. http://www.medienpolitik.net/2013/07/filmpolitikdie-ffg-novelle-ist-auch-ein-signal-gegenuber-karlsruhe/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[56] Vgl. http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zum-status-quo-des-kinomarkts/332102/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[57] Popp Wolfgang/Parke, Lennart/Kaumanns, Ralf (2008): Rechtemanagement in der digitalen Medienwelt. S. 18.
[58] Vgl. Interview mit A. , Zeile 196 (siehe Anhang).
[59] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4085db1a-92f5-11dd-98b5-0000779fd18c.html#axzz380NvLEhN, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[60] Behrmann, Malte (2008): Filmförderung im Zentral- und Bundesstaat. S. 34.
[61] Vgl. Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion S. 82.
[62] Interview mit G. / H., Zeile 55ff (siehe Anhang).
[63] http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zu-den-herausforderungen-des-kinogeschaefts/345621/seite-5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[64] Ebd.
[65] http://www.spio.de/index.asp?SeitID=395&TID=3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[66] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 43, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[67] Ebd. S. 28, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[68] http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[69] http://www.digitalfernsehen.de/Fox-haelt-an-umstrittenem-Video-Auswertungsfenster-fest.67656.0.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[70] http://de.statista.com/statistik/daten/studie/180706/umfrage/anzahl-der-videotheken-in-deutschland/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[71] http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/filmfoerderung-oeffentlich-rechtlich-ohne-das-fernsehen-ist-der-film-verloren-1594876-p2.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[72] Vgl. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/filmfoerderung-oeffentlich-rechtlich-ohne-das-fernsehen-ist-der-film-verloren-1594876-p2.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[73] http://www.charlierose.com/watch/60072386, Timecode 19:25. Letzter Zugriff: 25.08.2014.
[74] Vgl. Dördrechter, Nikolai (2006): Piraterie in der Filmindustrie. S. 31f.
[75] https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[76] http://www.mediabiz.de/film/news/kim-ludolf-koch-zum-cineplex-jubilaeum-partnerschaftliche-kooperation/326419/seite-3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[77] http://www.waldorf-frommer.de/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[78] Vgl. http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/abmahnanwaelte-nicht-zu-stoppen-100.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[79] http://www.mediabiz.de/film/news/moszkowicz-eugh-entscheidung-ist-ein-sehr-wichtiger-meilenstein-fuer-die-kreativindustrie/345378, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[80] http://www.mediabiz.de/video/vote/internetpiraterie/500000327, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[81] http://www.time4popcorn.eu/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[82] http://www.mediabiz.de/video/news/vote-wie-hat-sich-das-piraterieproblem-entwickelt/346321, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[83] http://www.mediabiz.de/film/news/illegale-downloads-vor-kinostart-schaden-dem-boxoffice/383184, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[84] Ebd.
[85] Vgl. Dördrechter, Nikolai (2006): Piraterie in der Filmindustrie. S. 1f.
[86] http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, S. 3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[87] Vollmuth, Hilmar J. (2003)6: Controling Instrumente von A - Z. S.435.
[88] http://www.mediabiz.de/film/news/die-marke-kino-wird-marginalisiert/345942, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[89] Interview mit E., Zeile 92ff (siehe Anhang).
[90] http://www.mediabiz.de/video/news/andreas-heyden-maxdome-netflix-wird-es-nicht-einfach-haben/346056, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[91] Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. Recoup! S. 29.
[92] Vgl. http://www.mediabiz.de/film/news/kinoerlebnis-versus-home-entertainment/165423, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[93] Ebd.
[94] Avatar - Aufbruch nach Pandora / Avatar (OT), Regie: James Cameron, USA 2009.
[95] http://www.mediabiz.de/film/news/die-marke-kino-wird-marginalisiert/345942, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[96] http://www.mediabiz.de/video/news/pwc-digital-ueberholt-dvd-und-blu-ray/381323, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[97] http://www.mediabiz.de/video/news/status-quo-von-ultra-hd-und-4k-blu-ray/343615, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[98] House of Cards (OT), Regie: Diverse, USA 2013.
[99] http://www.mediabiz.de/video/news/netflix-startet-4k-streaming/345817, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[100] http://www.mediabiz.de/video/news/status-quo-von-ultra-hd-und-4k-blu-ray/343615/seite-2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[101] http://www.mediabiz.de/film/firmen/people/dr-thomas-negele/20654/1102, letzter Zugriff: 25.08.14.
[102] http://www.mediabiz.de/video/news/dolby-atmos-kommt-ins-heimkino/381439, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[103] Welcome to New York (OT), Regie: Abel Ferrara, Frankreich / USA, 2014.
[104] Vgl. Interview mit A., Zeile 100ff (siehe Anhang).
[105] http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-2012-margin-call-video-on-demand-zach-quinto-283033, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[106] Der große Crash - Margin Call / Margin Call (OT), Regie: J. C. Chandor, USA 2011.
[107] http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[108] http://www.mediabiz.de/film/news/debatte-um-simultanstarts-bleibt-ohne-ergebnis/347270, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[109] http://www.mediabiz.de/film/news/ag-kino-gilde-macht-front-gegen-verzerrtes-bild-von-dayunddate-experimenten/381806, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[110] http://www.mediabiz.de/film/news/kim-ludolf-koch-zum-cineplex-jubilaeum-partnerschaftliche-kooperation/326419/seite-3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[111] Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. S. 84.
[112] http://www.medienpolitik.net/2013/07/filmpolitikdie-ffg-novelle-ist-auch-ein-signal-gegenuber-karlsruhe/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[113] http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zum-status-quo-des-kinomarkts/332102/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[114] http://www.charlierose.com/watch/60072386, Timecode 17:11, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[115] http://www.mediabiz.de/video/news/goldmedia-tablets-im-massenmarkt-angekommen/347028, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[116] Ebd.
[117] http://europa.eu/pol/av/index_de.htm, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[118] http://dejure.org/gesetze/AEUV/167.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[119] Vgl. http://europa.eu/pol/av/index_de.htm, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[120] http://www.mediabiz.de/film/news/moszkowicz-eugh-entscheidung-ist-ein-sehr-wichtiger-meilenstein-fuer-die-kreativindustrie/345378, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[121] http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[122] Vgl. http://www.mediabiz.de/film/news/ag-kino-gilde-macht-front-gegen-verzerrtes-bild-von-dayunddate-experimenten/381806, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[123] http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/abmahnanwaelte-nicht-zu-stoppen-100.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[124] http://torrentfreak.com/suing-file-sharers-doesnt-work-lawyers-warn-140713/, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[125] http://www.charlierose.com/watch/60072386, Timecode 21:05, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[126] http://de.wiktionary.org/wiki/Ubiquit%C3%A4t, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[127] http://www.mediabiz.de/film/news/thesen-zur-zukunft-der-filmverwertung/321011/seite-2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[128] http://www.charlierose.com/watch/60072386, Timecode 17:18, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[129] http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[130] Interview mit A., Zeile 36ff (siehe Anhang).
[131] http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zum-status-quo-des-kinomarkts/332102/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[132] Vgl. Interview mit B., Zeile 55ff (siehe Anhang).
[133] Interview mit A ., Zeile 198ff (siehe Anhang).
[134] Interview mit F., Zeile 110ff (siehe Anhang).
[135] Ungericht, Bernhard (2012): Strategiebewusstes Management.
[136] http://www.mediabiz.de/film/news/thomas-negele-zum-status-quo-des-kinomarkts/332102/seite-4, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[137] Vgl 5.1. Szenario 1: Das Ubiquitätsmodell, S. 40f.
[138] Vgl. http://www.ffa.de/downloads/publikationen/kinobesucher_2013.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[139] Arrow, Kenneth J. (1971): Essays in the Theory of Risk-Bearing, S. 71f.
[140] Vgl. 4.8. Entwicklung der Filmpiraterie, S. 39ff.
[141] http://www.mediabiz.de/film/news/drehbuchautor-fordert-filme-gratis-ins-netz/339269, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[142] http://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-verschenkt-meine-filme-1.1794040, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[143] http://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-verschenkt-meine-filme-1.1794040-2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[144] Ebd.
[145] Ebd.
[146] Vgl. Interview mit D., Zeile 78ff (siehe Anhang).
[147] http://www.mediabiz.de/film/news/vote-quote-skepsis-beim-superticket/336489, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[148] World War Z (OT), Regie: Marc Foster, USA / Malta 2012.
[149] https://movies.yahoo.com/blogs/movie-talk/meet-50-world-war-z-movie-ticket-162450958.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[150] http://www.mediabiz.de/video/news/superticket-vereint-kinobesuch-und-download/337060, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[151] http://www.mediabiz.de/film/news/vote-quote-skepsis-beim-superticket/336489, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[152] Ebd.
[153] Iron Man (OT), Regie: John Favreau, USA 2008.
[154] Lincoln (OT), Regie: Steven Spielberg, USA 2012.
[155] https://movies.yahoo.com/blogs/movie-talk/meet-50-world-war-z-movie-ticket-162450958.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[156] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2012.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[157] Interview mit C., Zeile 54ff (siehe Anhang).
[158] Interview mit A., Zeile 152ff (siehe Anhang).
[159] Vgl. 6.6. Chancen und Risiken von Day-and-date Releases, S. 52ff.
[160] https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[161] http://www.charlierose.com/watch/60072386, Timecode 17:44, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[162] http://www.cine-bulletin.ch/pdf/archives/CB%20416-417%20juin-juillet%202010.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[163] http://preparatoryaction.files.wordpress.com/2014/05/report_new-approaches-for-greater-diversity-of-cinema-in-europe_thomas-paris_may20142.pdf, S. 58, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[164] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 5, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[165] http://www.mediabiz.de/film/news/central-in-ludwigsburg-feiert-100-jaehriges-bestehen/334212, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[166] http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/regionales-kinosterben-noch-lange-nicht-die-letzte-vorstellung-12312840.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[167] http://www.mediabiz.de/film/news/die-marke-kino-wird-marginalisiert/345942, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[168] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/GB_FFA_2013.pdf, S. 25, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[169] http://www.mediabiz.de/film/news/die-marke-kino-wird-marginalisiert/345942, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[170] Vgl. 5.3., S. 42f.
[171] Interview mit D., Zeile 33ff (siehe Anhang).
[172] Interview mit D., Zeile 115ff (siehe Anhang).
[173] https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[174] Interview mit A., Zeile 125ff (siehe Anhang).
[175] http://www.mediabiz.de/film/news/kinoerlebnis-versus-home-entertainment/165423, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[176] Behrmann, Malte (2008): Filmförderung im Zentral- und Bundesstaat. S. 35
[177] Deutschland. Ein Sommermärchen (OT), Regie: Sönke Wortmann, Deutschland 2006.
[178] Love Steaks (OT), Regie: Jakob Lass, Deutschland 2013.
[179] Jacobs, Olaf (2011): Finanzierung von Film- und Fernsehproduktionen. S. 117.
[180] Wendling, Eckhard (2012): Filmproduktion. Recoup!, S. 82.
[181] Vgl. ebd.
[182] http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527487043.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[183] Vgl. 3.3. Filmförderung und Filmproduktion in Deutschland, S. 17f.
[184] Interview mit A., Zeile 100ff (siehe Anhang).
[185] Interview B., Zeile 27ff (siehe Anhang).
[186] Interview mit B., Zeile 23ff (siehe Anhang).
[187] Interview F., Zeile 72ff (siehe Anhang).
[188] Interview C., Zeile 13ff (siehe Anhang).
[189] http://www.mediabiz.de/film/news/vote-quote-skepsis-beim-superticket/336489, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[190] Interview F., Zeile 194ff (siehe Anhang).
[191] Vgl. http://www.mediabiz.de/film/news/kim-ludolf-koch-zum-cineplex-jubilaeum-partnerschaftliche-kooperation/326419/seite-3, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[192] Vgl. 4.8. Entwicklung der Filmpiraterie, S. 39.
[193] http://www.bitkom.org/files/documents/Stellungnahme_FFG-Novelle_2014_ANGA_BITKOM_eco.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[194] https://lqpp.de/be/initiative/show/2464.html, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[195] http://www.ffa.de/downloads/publikationen/kinobesucher_dt_2012.pdf, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[196] Love Steaks (OT), Regie: Jakob Lass, Deutschland 2013.
[197] http://www.mediabiz.de/film/news/die-produzenten-der-lola-nominierten-im-interview/346852, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[198] Vgl. 6.3., S. 49.
[199] http://www.mediabiz.de/film/news/thesen-zur-zukunft-der-filmverwertung/321011/seite-2, letzter Zugriff: 25.08.2014.
[200] Vgl. 6. Chancen und Risiken einer Veränderung des deutschen Distributionsmodells, S. 45ff.
[201] Vgl. 6.2. Die Vorschläge von Fred Breinersdorfer, S. 47f.
[202] Vgl. 7. Abwägung und Handlungsempfehlung, S. 60ff.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Distributionsmodelle im Wandel?
Dieser Text bietet eine umfassende Vorschau auf eine Untersuchung von Distributionsmodellen im Wandel, mit Fokus auf die deutsche Filmwirtschaft. Er enthält das Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Untersuchung verwendet?
Die Untersuchung basiert auf Experteninterviews, der Szenario-Technik, dem Szenario-Trichter und der Chancen-Risiken-Analyse.
Wie ist der aktuelle Stand des Distributionsmodells in Deutschland?
Der aktuelle Stand umfasst die Definition des Untersuchungsfeldes, die Verwertungskette, die Filmförderung, die Bedeutung des FFG (Filmförderungsgesetz), die Funktionsweise der FFG-Sperrfristen, Anträge zur Sperrfristenverkürzung, selbst bestimmte Auswertungsfenster, Kino-Auswertung, Bildträger- und VoD-Auswertung, entgeltliche und unentgeltliche Fernsehsender sowie den aktuellen Stand zur Filmpiraterie.
Welche Entwicklungstendenzen gibt es in der Branchen-Umwelt?
Wichtige Entwicklungstendenzen sind die Digitalisierung und das Internet, das Verhältnis von Home-Entertainment versus Kinoerlebnis, Experimente zu alternativen Release-Strategien, die Politik der Majors, die Entwicklung neuer Endgeräte, politisch-rechtliche Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene sowie die Entwicklung der Filmpiraterie.
Welche Szenarien werden für die Zukunft der Distributionsmodelle entwickelt?
Es werden drei Szenarien entwickelt: Das Ubiquitätsmodell, die Beibehaltung der aktuellen Auswertungsfenster und Sperrfristen sowie ein Trendszenario, das Individualisierung, Flexibilisierung und Verkürzung der Auswertungsfenster vorsieht.
Welche Chancen und Risiken sind mit einer Veränderung des deutschen Distributionsmodells verbunden?
Zu den Chancen gehören u.a. eine schnellere Zweitauswertung, ein Recoupment-Gewinn und die Bekämpfung der Filmpiraterie. Risiken sind z.B. ein Recoupment-Verlust, Risiken für Kinobesitzer und die Machtausübung durch Branchenführer.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Empfehlungen umfassen die Flexibilisierung und Verkürzung der FFG-Sperrfristen, eine individuellere Handhabung der Auswertungsfenster sowie die Verbesserung des Online-Angebots.
Was ist das Ubiquitätsmodell?
Es ist ein Szenario, in dem Filme ohne Einschränkungen in mehreren Medien gleichzeitig veröffentlicht werden und kaum ein Film exklusiv im Kino zu sehen ist.
Was sind FFG Sperrfristen?
Zeitliche Restriktionen für die Auswertungsfenster von Kinofilmen, die mit Hilfe von Deutscher Filmförderung entstanden sind, die sicherstellen sollen, dass es einen exklusiven Auswertungszeitraum für das Kino gibt.
Was ist ein Day-and-Date Release?
Die Auswertung des Films beginnt in mehreren Auswertungsstufen gleichzeitig – klassischer Weise im Kino und auf VoD-Plattformen und damit auf allen mobilen Endgeräten.
- Quote paper
- Tobias Huber (Author), 2014, Die Zukunft der Auswertungsfenster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303147