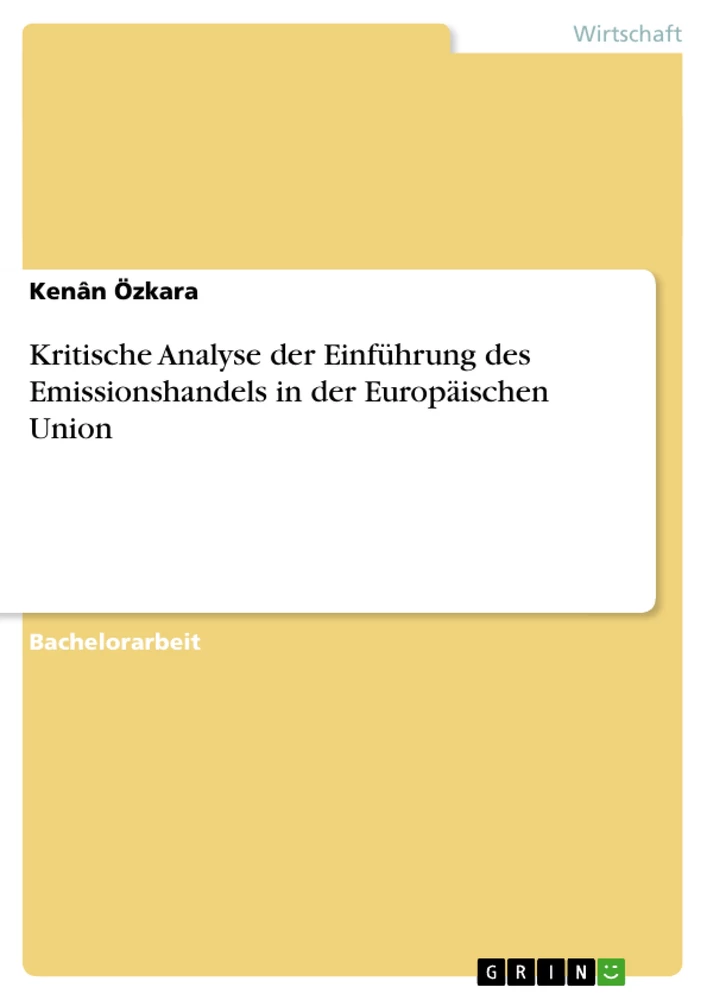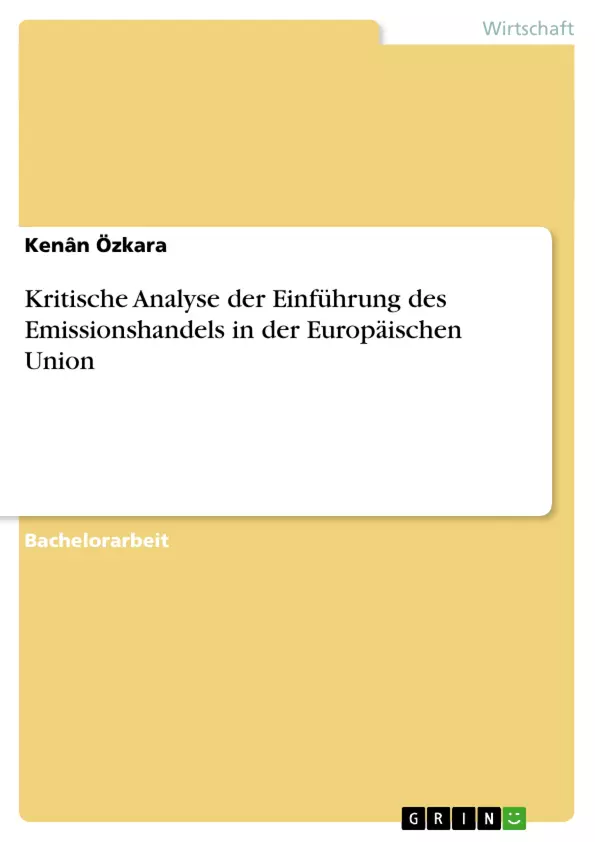Das stetige Wachstum der Weltwirtschaft, die voranschreitende Globalisierung und der Anstieg der Weltbevölkerungszahl ließen in den letzten Jahrzehnten den Ausstoß an Treibhausgasen stark steigen. Diese Gase entstehen bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, bei landwirtschaftlichen Aktivitäten sowie bei industriellen Prozessen. Eine überwiegende Mehrheit renommierter Wissenschaftler ist der Ansicht, dass die zunehmenden Treibhausgasemissionen zu erheblichen klimatischen Veränderungen auf der Erde führen. Für die nahe Zukunft wird mit einer globalen Erwärmung der Erdoberfläche gerechnet, die weitreichende ökonomische und ökologische Folgen nach sich ziehen wird. Insbesondere der Ausstoß von Kohlendioxid (CO 2 ) bereitet große Sorgen, da darin die Hauptursache für den anthropogenen Treibhauseffekt gesehen wird. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahre 1997 nach zahlreichen umwelt- und klimapolitischen Konferenzen und Verhandlungsrunden im Kyoto-Protokoll erstmals eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur Reduzierung der Treibhausgase getroffen. Die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedsstaaten haben dabei einen Anteil von 8 % übernommen. Um den Verpflichtungen möglichst effizient nachzukommen, soll ein Teil der Minderungszusagen durch ein EU-internes CO 2 -Emissionshandelssystem realisiert werden. Die EU hat dazu bereits eine Richtlinie verabschiedet, die die Ausgestaltung des Systems endgültig regelt. Allerdings haben im Vorfeld diverse Richtlinienvorschläge zu kontroversen Diskussionen geführt. Besonders der Entwurf vom 23.10.2001 stand im Kreuzfeuer der Kritik. Die vorliegende Arbeit knüpft an die Diskussionen um die Einführung des Emissionshandelssystems in der EU an und versucht, das Vorhaben zu erörtern und einer kritischen Analyse zu unterziehen.
Einführend werden in Kapitel 2 die grundlegenden Entwicklungen der internationalen Klimapolitik bis zum Abschluss des Kyoto-Protokolls und die daraus resultierenden CO 2 -Minderungsverpflichtungen für die EU und ihre Mitgliedsstaaten dargestellt. In diesem Zusammenhang werden auch die wesentlichen Instrumente des Kyoto-Protokolls vorgestellt, die das EU-Modell aus Kompatibilitätsgründen zu integrieren versucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Internationale Klimapolitik
- 2.1. Institutionalisierung des Klimaschutzes
- 2.2. Bedeutendsten Konferenzen der Vertragsstaaten
- 2.3. Kyoto-Protokoll
- 2.4. Instrumente des Kyoto-Protokolls
- 2.5. Reduktionsverpflichtungen der Europäischen Union
- 3. Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union
- 3.1. Grundprinzip des Emissionshandels
- 3.2. Vorteile des Emissionshandels
- 3.3. Politischer Umsetzungsprozess
- 3.4. Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom 23.10.2001
- 3.4.1. Rahmenbedingungen
- 3.4.2. Kritische Betrachtung der Ausgestaltung
- 3.4.2.1. Kreis der Marktteilnehmer
- 3.4.2.2. Verpflichtung zur Teilnahme
- 3.4.2.3. Primärverteilung der Emissionsrechte
- 3.4.2.4. Berücksichtigung von Neueinsteigern
- 3.4.2.5. Berücksichtigung früherer Vermeidungsleistungen
- 3.4.2.6. Überwachung und Sanktionierung
- 3.5. Dänischer Kompromissvorschlag vom 28.08.2002
- 3.6. Endgültige Fassung der Richtlinie vom 25.10.2003
- 4. Praktische Erfahrungen: Der Handel mit SO2-Emissionen in den USA
- 4.1. Ausgestaltung
- 4.2. Preisentwicklung und Zielerreichung
- 4.3. Bedeutung für das EU-Modell
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert kritisch die Einführung des Emissionshandels in der Europäischen Union. Sie untersucht die internationalen Rahmenbedingungen des Klimaschutzes, die Entwicklung des Emissionshandelssystems der EU und die praktischen Erfahrungen mit dem Handel von SO2-Emissionen in den USA.
- Internationale Klimapolitik und das Kyoto-Protokoll
- Grundprinzipien und Vorteile des Emissionshandels
- Politischer Umsetzungsprozess des Emissionshandelssystems der EU
- Kritische Analyse der Ausgestaltung des Emissionshandelssystems
- Bedeutung der Erfahrungen mit dem SO2-Emissionshandel in den USA für das EU-Modell
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die internationalen Rahmenbedingungen des Klimaschutzes, insbesondere die Institutionalisierung und die wichtigsten Konferenzen der Vertragsstaaten. Das Kyoto-Protokoll und seine Instrumente werden ebenfalls erläutert, sowie die Reduktionsverpflichtungen der Europäischen Union. Kapitel 3 widmet sich dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Das Grundprinzip des Emissionshandels und seine Vorteile werden vorgestellt, sowie der politische Umsetzungsprozess und die Richtlinie der EU-Kommission vom 23.10.2001. Kapitel 4 beleuchtet die praktischen Erfahrungen mit dem Handel von SO2-Emissionen in den USA, die für das EU-Modell relevant sind. Die Ausgestaltung des Systems, die Preisentwicklung und die Zielerreichung werden dabei betrachtet.
Schlüsselwörter
Emissionshandel, Klimapolitik, Kyoto-Protokoll, Europäische Union, SO2-Emissionen, USA, Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion, Marktmechanismen, politische Ökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des EU-Emissionshandels?
Das Ziel ist die kosteneffiziente Reduzierung von Treibhausgasemissionen, insbesondere CO2, um die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen.
Wie funktioniert das Grundprinzip des Emissionshandels?
Unternehmen erhalten eine begrenzte Anzahl an Emissionsrechten. Wer weniger ausstößt, kann Rechte verkaufen; wer mehr benötigt, muss diese am Markt zukaufen.
Welche Rolle spielt das Kyoto-Protokoll?
Es ist die erste rechtsverbindliche internationale Vereinbarung zur Treibhausgasreduktion, in der sich die EU zu einer Minderung von 8 % verpflichtete.
Was kann die EU vom US-amerikanischen SO2-Handel lernen?
Die USA zeigten mit dem SO2-Programm, dass marktbasierte Instrumente Umweltziele oft günstiger erreichen als reine ordnungspolitische Vorgaben.
Warum war die Primärverteilung der Zertifikate umstritten?
Es gab Diskussionen darüber, ob Zertifikate kostenlos (Grandfathering) vergeben oder versteigert werden sollten und wie Neueinsteiger berücksichtigt werden.
- Quote paper
- International Economics M.A. Kenân Özkara (Author), 2004, Kritische Analyse der Einführung des Emissionshandels in der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30316