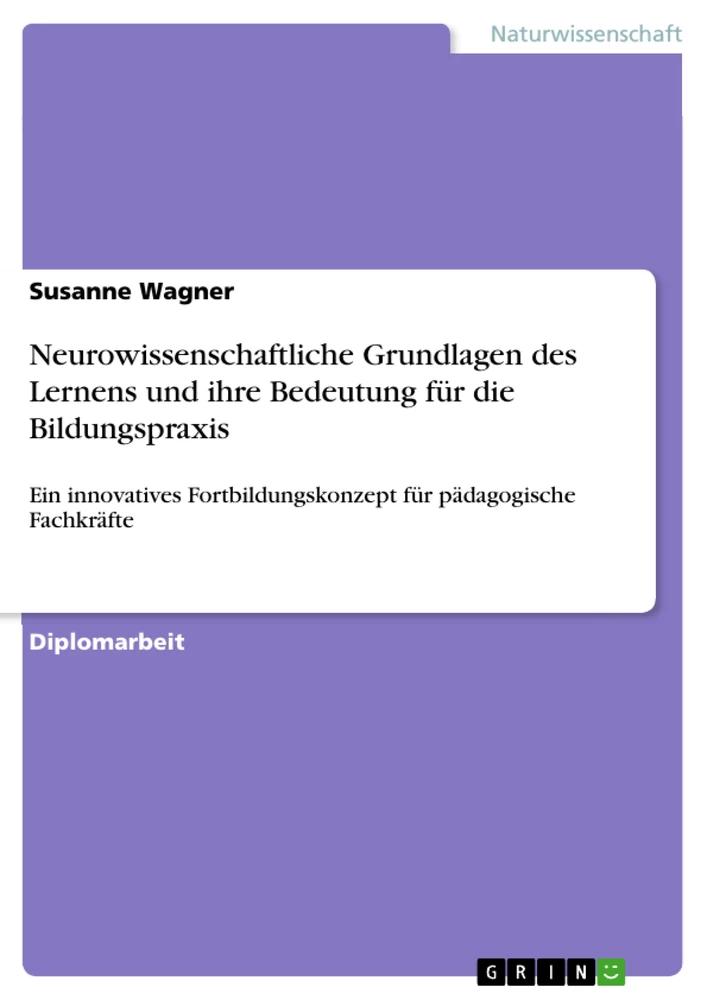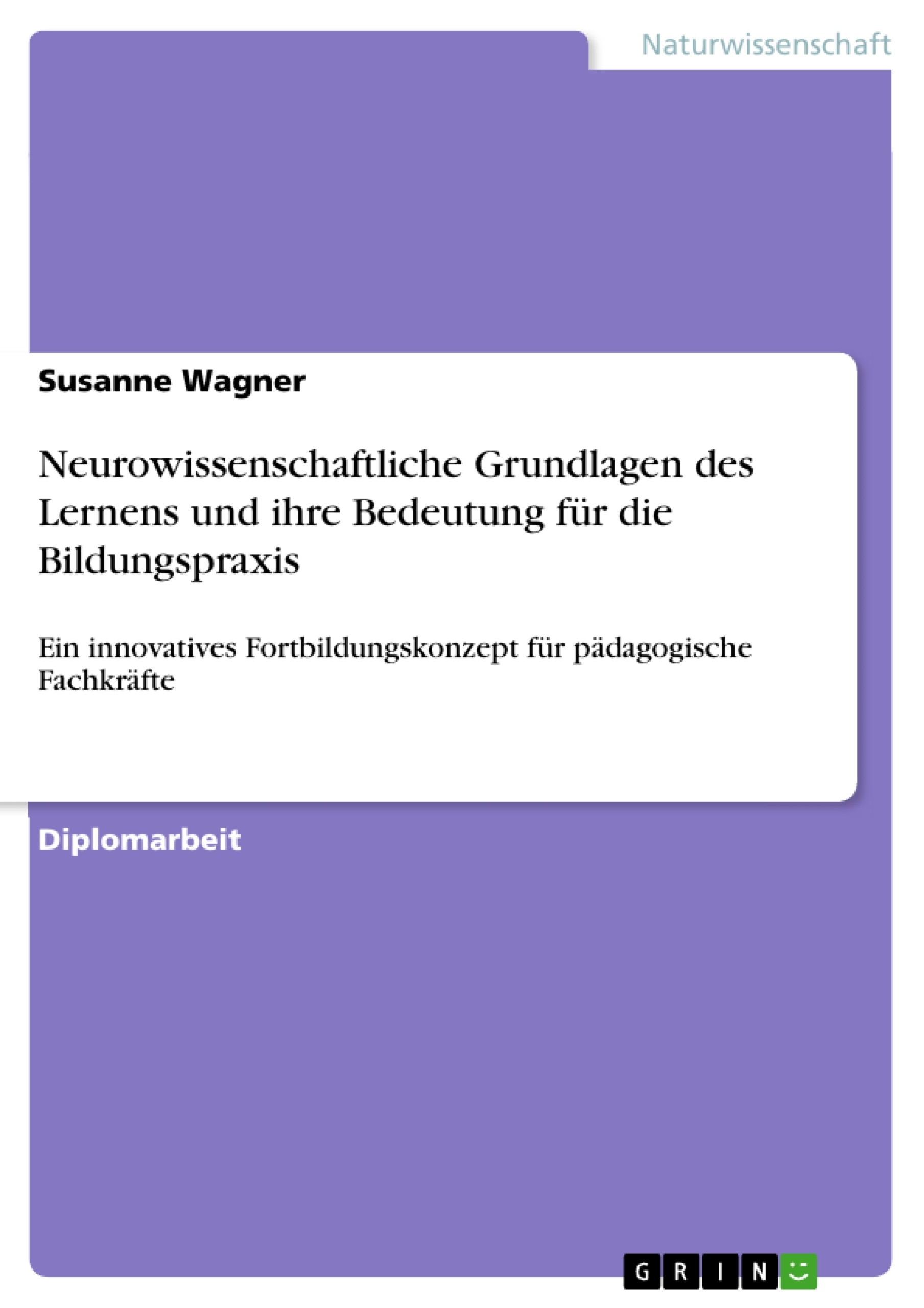Lernen ist etwas, das man täglich macht, ein ganzes Leben lang - sogar im Schlaf. Diese Arbeit setzt sich mit den neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens auseinander und untersucht deren Bedeutung für die heutige Bildungspraxis.
Die Arbeit geht aber noch einen Schritt weiter:
Was ist gehirngerechtes Lernen, wie kann man es in unseren Schulen umsetzen und welche Konsequenzen ergeben sich für unsere Bildungspraxis daraus?
Die Autorin sucht Antworten auf diese Fragen und stellt ihren Lösungsansatz erfahrenen pädagogische Fachkräften in Seminaren vor.
Das so in der Praxis erprobte Seminar-Konzept wird ebenfalls in dieser Arbeit vorgestellt und evaluiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Lernen und Gedächtnis, Wissen und Können
- Lernformen
- Nicht-assoziatives Lernen
- Assoziatives Lernen
- Kognitives Lernen
- Sozial-kognitives Lernen
- Exkurs: Modelllernen am Beispiel „Lernen von Gewalt“
- Das Gehirn
- Neuronen
- Aufbau und Funktion des Gehirns
- Kommunikation im Gehirn - Synapsen und Neurotransmitter
- Gedächtnis und Lernen
- Lernen
- Lokalisation und Funktionsweise des Gedächtnisses
- Landkarten im Kortex
- Gedächtnismodelle
- Lernen im Schlaf
- Vergessen
- Neuroplastizität
- Aufmerksamkeit
- Motivation
- Emotionen
- Emotionen und Lernen
- Angst und Stress
- Neuronen
- Die Bedeutung für die Bildungspraxis
- Gehirngerechtes Lernen
- Transfer der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse
- Lernschwächen
- Lerntypen und Metakognition
- Konsequenzen für die Allgemeine Didaktik
- Rahmenbedingungen für guten Unterricht
- Unterrichtsformen
- ,,Ein guter Lehrer...“
- Gibt es eine Neurodidaktik?
- Gehirngerechtes Lernen
- Fortbildungskonzept für pädagogische Fachkräfte
- Konzeptentwicklung
- Zielsetzung
- Zielgruppe
- Schwierigkeiten
- Zeit- und Ressourcenplanung
- Das Konzept
- Ablaufplan
- Seminargestaltung
- Handout
- Durchführung
- Teilnehmende Schulen
- Seminare
- Schwierigkeiten
- Evaluation
- Evaluationsbogen
- Statistische Auswertung
- Interpretation der Ergebnisse
- Konzeptentwicklung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens und deren Bedeutung für die Bildungspraxis. Ziel ist es, die Erkenntnisse der Hirnforschung in den Bereich der Pädagogik zu übertragen und ein innovatives Fortbildungskonzept für pädagogische Fachkräfte zu entwickeln.
- Aufbau und Funktion des Gehirns
- Gedächtnis und Lernen
- Motivation und Emotionen
- Gehirngerechtes Lernen
- Konsequenzen für die Didaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz von Lernen für den Menschen heraus. Das Kapitel „Begriffsbestimmung“ definiert die zentralen Begriffe wie Lernen, Gedächtnis, Wissen und Können und stellt verschiedene Lernformen vor. Das Kapitel „Das Gehirn“ erläutert den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns, insbesondere die Rolle von Neuronen, Synapsen und Neurotransmittern. Es werden außerdem die Prozesse des Gedächtnisses und Lernens, die Rolle der Aufmerksamkeit, Motivation und Emotionen sowie die Bedeutung von Neuroplastizität beleuchtet. Das Kapitel „Die Bedeutung für die Bildungspraxis“ beleuchtet die Relevanz der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse für den Unterricht und zeigt Möglichkeiten auf, wie man Lernen „gehirngerecht“ gestalten kann. Abschließend wird ein Fortbildungskonzept für pädagogische Fachkräfte vorgestellt, welches die Erkenntnisse der Hirnforschung in die Praxis transferieren soll.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Lernforschung, Neurowissenschaften, Bildungspraxis, Gedächtnis, Emotionen, Motivation, Gehirn, Neuroplastizität, Didaktik, Fortbildung, pädagogische Fachkräfte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "gehirngerechtes" Lernen?
Lernmethoden, die auf den natürlichen Funktionsweisen des Gehirns basieren, wie etwa der Berücksichtigung von Emotionen und Neuroplastizität.
Welche Rolle spielen Emotionen beim Lernen?
Emotionen beeinflussen die Aufmerksamkeit und die Speicherung von Informationen; Angst und Stress können den Lernerfolg massiv behindern.
Gibt es eine spezielle "Neurodidaktik"?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit Erkenntnisse der Hirnforschung direkt in didaktische Konzepte für den Unterricht übersetzt werden können.
Warum ist Neuroplastizität wichtig für die Bildung?
Sie zeigt, dass das Gehirn lebenslang lernfähig ist und sich durch neue Erfahrungen strukturell verändern und anpassen kann.
Wie sieht ein Fortbildungskonzept für Lehrer aus?
Die Arbeit stellt ein evaluiertes Seminarkonzept vor, das pädagogischen Fachkräften hilft, neurowissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.
- Citation du texte
- Susanne Wagner (Auteur), 2008, Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens und ihre Bedeutung für die Bildungspraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303192