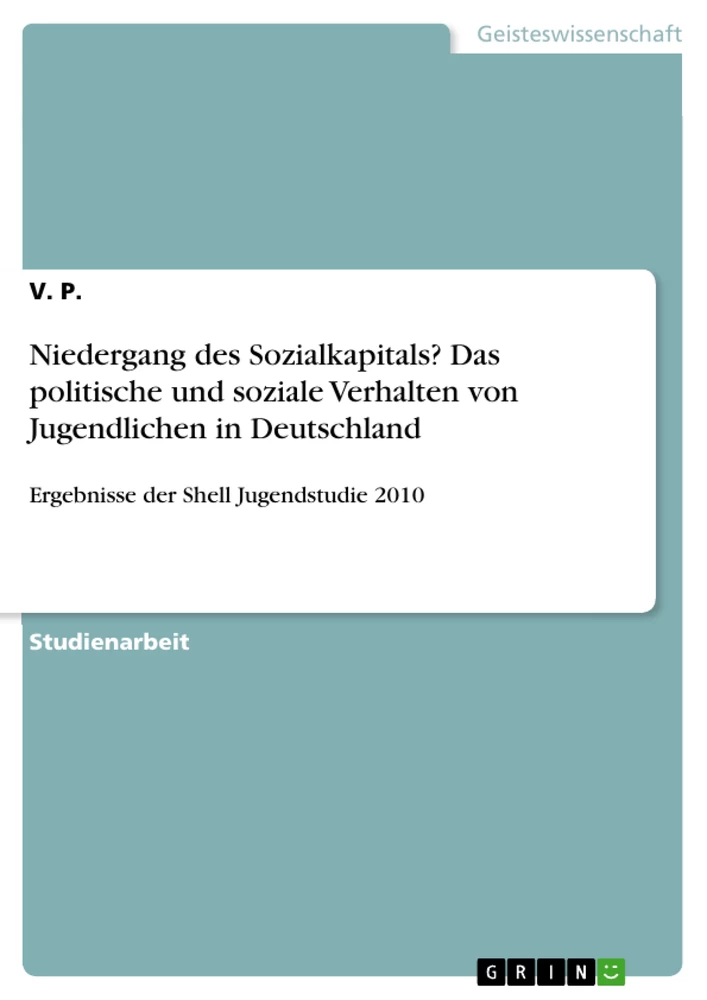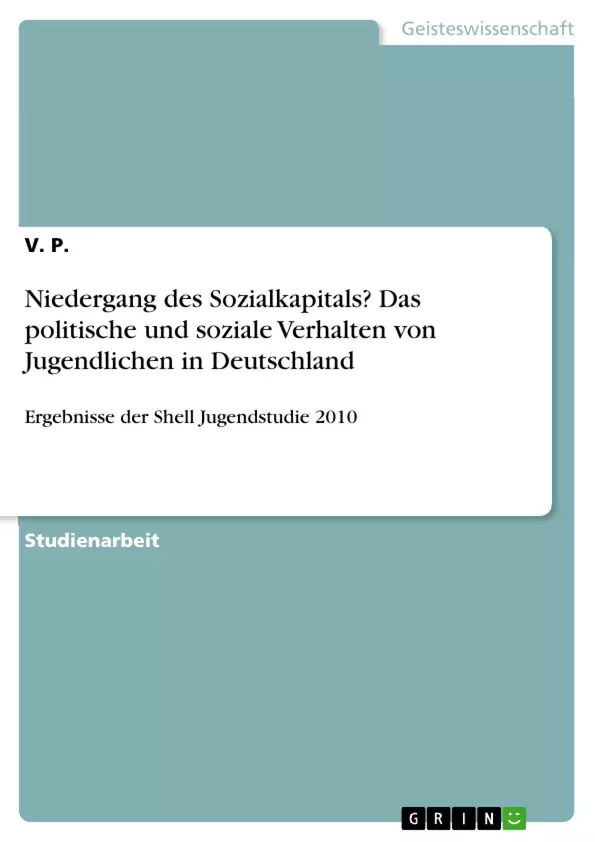Der vorliegende Versuch einer grundlegenden Einführung in den Begriffskomplex des Sozialkapitals von Jugendlichen ist zweigliedrig gestaltet: Im Theorieteil wird Robert D. Putnams Definitionsansatz analysiert. Danach folgt unter Rückgriff auf den ersten Teil eine Ausarbeitung des Schwerpunkts der Arbeit, der aus einem möglichen Zugang zur empirischen Operationalisierung von Sozialkapital besteht. Durch die Auswertung der dabei entstandenen Ergebnisse wird versucht, die Themafrage zu beantworten. Als Datengrundlage dienen Erkenntnisse der Shell Jugendstudie 2010. Ziel der Untersuchung ist es, zu beantworten, ob von einer Steigerung der Engagementbereitschaft die Rede sein kann oder von einem weiterem Rückgang, oder gar vom Niedergang des Sozialkapitals.
Inhaltsverzeichnis
- Politikverdrossene Jugend vs. jugendverdrossene Politik..
- Erläuterung der Themafrage, Vorgehensweise und Ziele
- Literaturbericht.
- Sozialkapital und Bürgergesellschaft: Das Konzept Robert D. Putnams.….…......
- Generelle Schwierigkeiten bei der Annäherung zu einer wissenschaftlichen Begriffsdefinition
- Vorpolitische Parameter von Sozialkapital.
- Der Doppelte Doppelcharakter von Sozialkapital als theoretische Grundlage für eine empirische Operationalisierung ……………..\n
- Methodischer Zugang zu Sozialkapital von Jugendlichen in der BRD
- Sozialkapital und politisches Interesse.
- Sozialkapital und,Aktives Sich-Informieren.
- Strukturelle Aspekte.
- Politische Partizipation.
- Bürgergesellschaftliches Engagement.
- Kulturelle Aspekte von Sozialkapital..
- Zufriedenheit mit der Demokratie.
- Vertrauen in Institutionen und gesellschaftliche Gruppierungen……..\n
- Auswertung der Ergebnisse.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Politikverdrossenheit bei Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht, ob die Politikverdrossenheit der Jugend tatsächlich auf ein Desinteresse an Politik zurückzuführen ist, oder ob die Politik selbst an Jugendlichen nicht interessiert ist. Die Arbeit analysiert das Konzept des Sozialkapitals nach Robert D. Putnam und untersucht, wie es sich auf das politische Interesse und Engagement von Jugendlichen auswirkt.
- Sozialkapital und seine Bedeutung für die politische Partizipation von Jugendlichen
- Die Rolle von Medien und sozialen Netzwerken in der politischen Sozialisation von Jugendlichen
- Die Auswirkungen von Politikverdrossenheit auf die politische Kultur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Mögliche Handlungsansätze zur Förderung von politischem Interesse und Engagement bei Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet das Phänomen der Politikverdrossenheit bei Jugendlichen und stellt die Forschungsfrage auf. Es werden die wichtigsten Theorien und Studien zum Thema vorgestellt und die Zielsetzung der Arbeit definiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Sozialkapitals nach Robert D. Putnam. Es werden die zentralen Elemente des Konzepts erläutert und die Bedeutung von Sozialkapital für eine funktionierende Demokratie herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel untersucht den methodischen Zugang zu Sozialkapital von Jugendlichen in der BRD. Es werden verschiedene Aspekte von Sozialkapital, wie politisches Interesse, aktives Sich-Informieren, politische Partizipation, bürgergesellschaftliches Engagement und kulturelle Aspekte, analysiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Auswertung der Ergebnisse. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammengefasst und die Relevanz der Ergebnisse für die politische Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Jugend, Politikverdrossenheit, Sozialkapital, Partizipation, Engagement, Demokratie, Bürgergesellschaft, politische Kultur, Shell Jugendstudie, Robert D. Putnam, empirische Operationalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Sozialkapital bei Jugendlichen?
Sozialkapital umfasst Netzwerke, Normen und Vertrauen, die es Jugendlichen ermöglichen, politisch und gesellschaftlich aktiv zu werden.
Welchen Ansatz verfolgt Robert D. Putnam?
Putnam sieht im Rückgang von bürgerschaftlichem Engagement und sozialem Vertrauen eine Gefahr für die Demokratie, was in der Arbeit auf die heutige Jugend übertragen wird.
Sind Jugendliche heute wirklich politikverdrossen?
Die Arbeit untersucht, ob es sich um ein Desinteresse der Jugend handelt oder ob die Politik die Belange der Jugendlichen vernachlässigt.
Welche Datenquelle wird für die Untersuchung genutzt?
Die empirische Operationalisierung basiert auf den Erkenntnissen der Shell Jugendstudie 2010.
Was sind die kulturellen Aspekte von Sozialkapital?
Dazu gehören die Zufriedenheit mit der Demokratie sowie das Vertrauen in Institutionen und gesellschaftliche Gruppierungen.
- Quote paper
- V. P. (Author), 2014, Niedergang des Sozialkapitals? Das politische und soziale Verhalten von Jugendlichen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303376