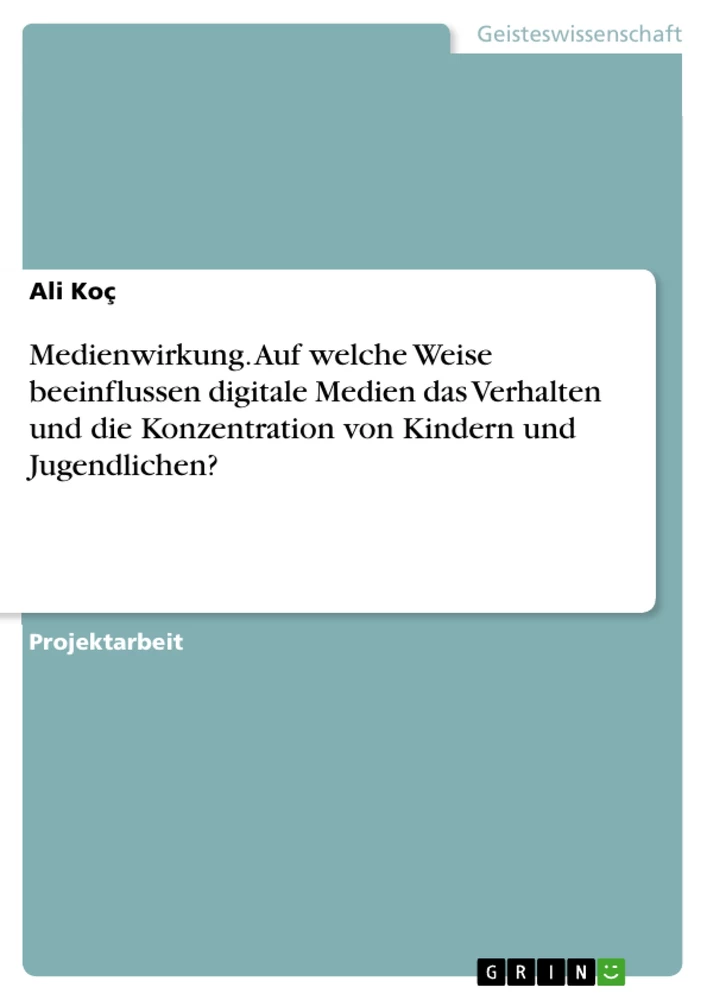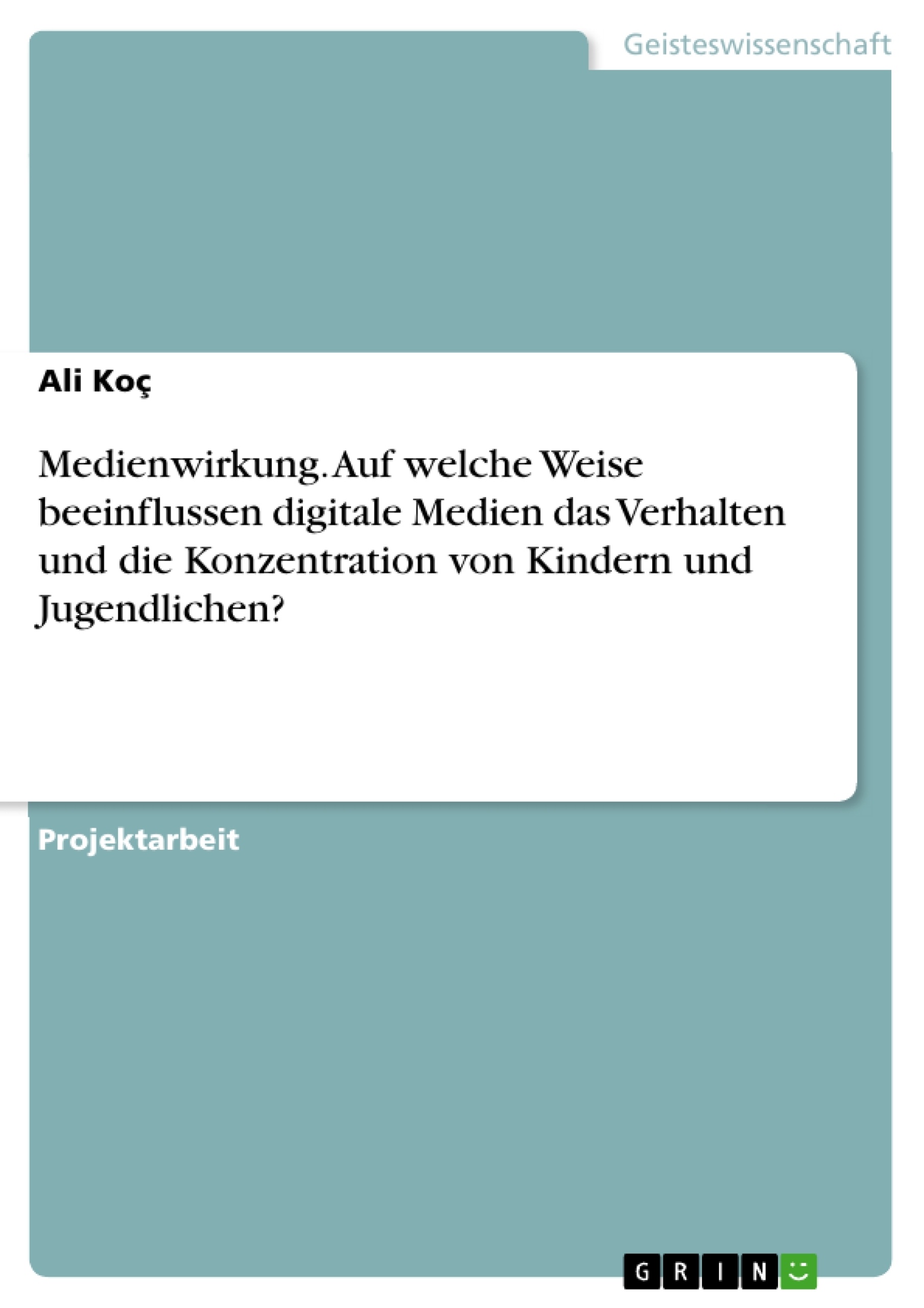Mit der Entwicklung neuer Technologien gab es immer wieder einen neuen Sündenbock. So wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das Kino verantwortlich gemacht, es habe einen schlechten Einfluss für die Jugendlichen. Darauf folgten der Fernseher, Videospiele und nun die Computerspiele. Es muss berücksichtigt werden, dass die Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen und vom Alltag nicht mehr weg zu denken sind. Gerade unter diesen Umständen gibt es immer mehr Möglichkeiten über die Medien Gewalt darzustellen und auszuüben. Hierunter fallen zum einen verbale Gewalt in Form des „Cybermobbings“, aber auch körperliche Gewalt, die mit Hilfe der Medien verbreitet wird, wie beispielsweise das „Happy Slapping“. Beim Happy Slapping verprügeln Jugendliche andere Personen, filmen dies mithilfe einer Kamera und verbreiten es anschließend über Medien. Cybermobbing hingegen ist die Beleidigung, Bedrohung oder Belästigung von Personen über digitale Medien, wie beispielsweise über E-Mail oder Social Networks
Die Arbeit befasst sich nicht nur mit dem Zusammenhang zwischen Gewalt und Medien, sondern es wird auch die Frage gestellt: „Macht uns der Computer dumm?“ Somit wird ein zweiter wichtiger Punkt im Bezug auf die Medien angesprochen. Wie beeinflussen Medien das Lernverhalten von Jugendlichen? Beeinträchtigen Lernprogramme in Form von Computerspielen die Noten von Schülern?
Aber haben Medien denn wirklich nur einen negativen Einfluss auf die Jugendlichen? Es gibt viele Studien die dies belegen, jedoch gibt es auch Studien die genau das Gegenteil belegen. Medien stiften den Jugendlichen einen Nutzen. Sie helfen bei den Hausaufgaben und in der Entwicklung. So gibt es viele Lernsoftwares die das Lernen zu einem Erlebnis machen. Über die Frage welchen Nutzen die Medien für die Jugendlichen haben und ob es wirklich nur negative Auswirkungen gibt, soll die vorliegende Arbeit Aufschluss geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Begriffserklärung
- Gewalt
- Medien
- Digitale Demenz
- Fassen Sie die Hauptaussagen der beiden Diskutanten zusammen und gehen Sie dabei auch auf den „wissenschaftlichen Gehalt\" (Theorien, Studien) der behaupteten Medienwirkung ein
- Manfred Spitzer
- Peter Vorderer
- Vertiefen Sie die Thematik „Medien und Gewalt“. Skizzieren Sie die wichtigsten Theorien, die mögliche Wirkungen von medialen Gewaltdarstellungen zu erklären versuchen. Welche dieser Theorien hat für Sie den höchsten Kurs- /Erklärungswert?
- Vorstellung wichtiger Theorien
- Ergebnis- Theorie mit wichtigstem Erklärungswert
- Wie würden Sie an einem Elternabend das Thema „digitale Demenz“ aufbereiten und welche Schlussfolgerungen / Empfehlungen würden Sie ratsuchenden Eltern geben
- Aufbereitung der digitalen Demenz
- Empfehlungen an die Eltern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen digitaler Medien auf Heranwachsende, insbesondere im Hinblick auf die Themen Gewalt und digitale Demenz. Sie analysiert die Debatte um die Medienwirkung und beleuchtet wissenschaftliche Studien sowie Theorien, die die potenziellen Auswirkungen von Mediengewalt erklären. Des Weiteren wird die Frage nach den Auswirkungen von digitalen Medien auf das Lernverhalten von Jugendlichen untersucht.
- Die Beziehung zwischen digitalen Medien und Gewalt
- Die wissenschaftlichen Theorien zu Mediengewalt
- Das Konzept der digitalen Demenz
- Die Auswirkungen digitaler Medien auf das Lernverhalten von Jugendlichen
- Die Relevanz von Medienkompetenz für Heranwachsende
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die gesellschaftliche Diskussion um die negativen Auswirkungen von Medien auf Kinder und Jugendliche. Es werden verschiedene Beispiele für medienvermittelte Gewalt, wie Cybermobbing und Happy Slapping, vorgestellt. Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffserklärung von Gewalt, Medien und digitaler Demenz. Es werden verschiedene Facetten der Gewalt, wie physische und psychische Gewalt, sowie die Unterscheidung zwischen realer und fiktiver Gewalt erläutert. Das dritte Kapitel fasst die Hauptaussagen von zwei Medienpsychologen zusammen und beleuchtet den wissenschaftlichen Gehalt ihrer Argumentation. Das vierte Kapitel vertieft die Thematik „Medien und Gewalt“ und stellt wichtige Theorien vor, die versuchen, die möglichen Wirkungen von medialen Gewaltdarstellungen zu erklären. Es wird die Theorie mit dem höchsten Erklärungswert näher betrachtet. Das fünfte Kapitel behandelt das Thema „digitale Demenz“ und gibt Empfehlungen an Eltern, wie sie mit diesem Thema umgehen können. Das letzte Kapitel bietet eine kritische Schlussbetrachtung und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Medienwirkung.
Schlüsselwörter
Digitale Medien, Mediengewalt, Cybermobbing, Happy Slapping, digitale Demenz, Lernverhalten, Medienkompetenz, Medienpsychologie, Theorien zur Medienwirkung, wissenschaftliche Studien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „digitaler Demenz“?
Der Begriff, geprägt von Manfred Spitzer, beschreibt die These, dass die übermäßige Nutzung digitaler Medien zu einem Abbau kognitiver Fähigkeiten führt.
Wie hängen digitale Medien und Gewalt zusammen?
Die Arbeit analysiert Theorien zur Medienwirkung, die erklären, wie gewalthaltige Inhalte Aggressionen fördern oder Phänomene wie Cybermobbing begünstigen können.
Was ist „Happy Slapping“?
Es bezeichnet das Filmen von körperlichen Angriffen auf ahnungslose Opfer mit dem Ziel, das Video über soziale Netzwerke zu verbreiten.
Machen Computer Kinder dumm?
Diese Frage wird kontrovers diskutiert; während einige Studien negative Auswirkungen auf die Konzentration sehen, betonen andere den Nutzen von Lernsoftware.
Welche Empfehlungen gibt es für Eltern im Umgang mit Medien?
Eltern sollten die Medienkompetenz fördern, Nutzungszeiten begrenzen und Inhalte kritisch begleiten, um Risiken wie Sucht oder Konzentrationsverlust zu minimieren.
- Quote paper
- Ali Koç (Author), 2013, Medienwirkung. Auf welche Weise beeinflussen digitale Medien das Verhalten und die Konzentration von Kindern und Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303386