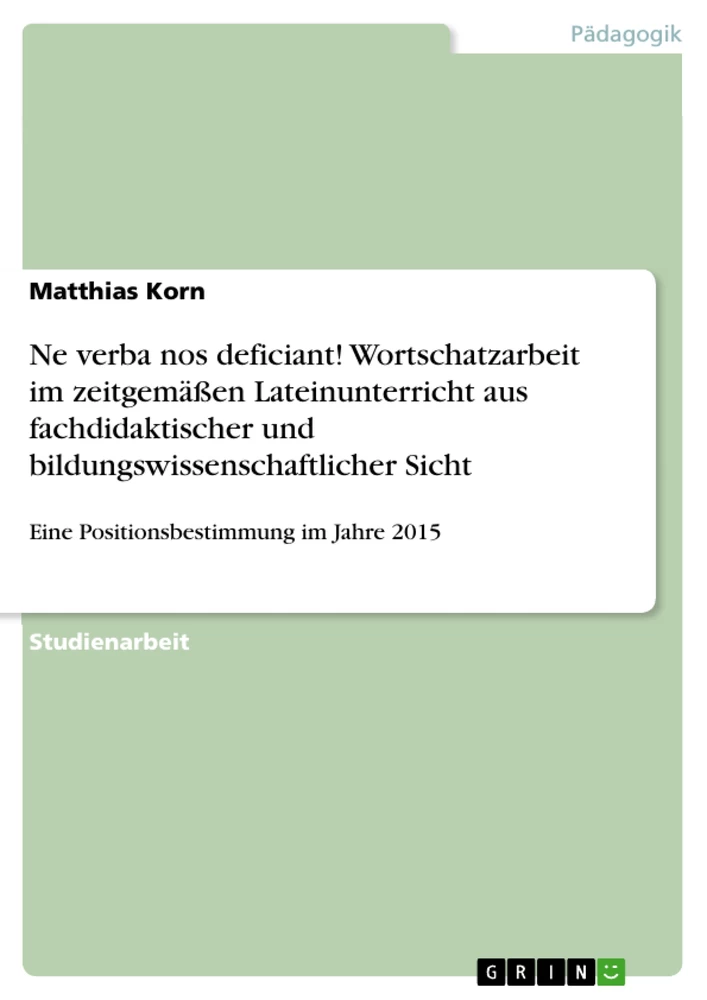Die Arbeit "Ne verba nos deficiant!" nimmt eine Positionsbestimmung zur Wortschatzarbeit im zeitgemäßen Lateinunterricht im Jahr 2015 aus fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Sicht vor.
Wortschatzarbeit umfasst unterrichtliche Arbeit am Wortschatz (Ersteinführung, Erklärung, Wiederholung …) und
außerunterrichtliche, d.h. überwiegend häusliche Arbeit am Wortschatz (Vokabellernen, Vokabelwiederholung …).
Die Wortschatzarbeit im zeitgemäßen Fremdsprachen- und Lateinunterricht ist Gegenstand v.a. der Arbeiten von Bösch, Dominick, Haß, Korn, Kuhlmann, Neveling, Schirok , Störmer und Utz. Von grundlegender Bedeutung und in einigen Punkten nach wie vor (muster)gültig ist der Aufsatz von Steinthal von 1971.
Die Arbeit "Ne verba nos deficiant!" will in sensibilisierender Weise einen Überblick über die komplexe Problemlage geben und dabei einige denkbare Lösungsansätze aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis:
0) Vorbemerkungen
1) Wortschatzarbeit hat mehrere Stufen
2) Wortschatzarbeit ist Unterrichtsarbeit
3) Wortschatzarbeit ist außerunterrichtliche Arbeit
4) Der Lernwortschatz: a) Zusammensetzung und Umfang des Lernwortschatzes, b) Repräsentativität und Textabdeckung,
c) Umwälzung, d) Lernleistung pro Tag, e) Das tatsächliche lateinische Vokabelgedächtnis, f) Konsequenzen der Veränderungen von Zusammensetzung und Umfang des Lernwortschatzes
5) Die Methodik des Einführens / Aufnehmens des neuen Wortschatzes, v.a. im Spracherwerb: a) Neudurchnahme unter Anwendung von Semantisierungstechniken, b) Sicherung durch das Konzept der Arbeit mit Wörternetzen nach Neveling, das in modifizierter Weise auf den Lateinunterricht übertragen wird.
Exkurs: Berechnungen zur Frage des Umfangs des Lernwortschatzes in der Spracherwerbsphase
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Wortschatzarbeit ist ein mehrstufiger Lehr- und Lernprozess
- Wortschatzarbeit ist Unterrichtsarbeit
- Einführen (= Semantisieren)
- Speichern Helfen
- Anwenden
- Wortschatzarbeit ist außerunterrichtliche Arbeit
- Von wesentlicher Bedeutung sind Zusammensetzung und Umfang des Lernwortschatzes (Herausforderung I)
- Von wesentlicher Bedeutung ist die Methodik des Einführens / Aufnehmens des neuen Wortschatzes, v.a. im Spracherwerb (Herausforderung II)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Vortrag befasst sich mit der komplexen Problemlage der Wortschatzarbeit im zeitgemäßen Lateinunterricht und zeigt denkbare Lösungsansätze auf. Er beleuchtet die verschiedenen Stufen des Wortschatzerwerbs und die Bedeutung von Unterrichts- und außerunterrichtlicher Arbeit. Darüber hinaus werden die Herausforderungen bei der Zusammensetzung und dem Umfang des Lernwortschatzes sowie die Methodik des Einführens und Aufnehmens neuen Wortschatzes im Spracherwerb diskutiert.
- Mehrstufigkeit des Wortschatzerwerbs (Einführen, Speichern, Anwenden)
- Bedeutung von Unterrichtsarbeit (Semantisierung, Übung, Lerntechniken)
- Rolle der außerunterrichtlichen Arbeit (Lernarbeit, Beratung, Koppelung)
- Zusammensetzung und Umfang des Lernwortschatzes
- Methodik des Einführens und Aufnehmens neuen Wortschatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkungen stellen die Relevanz der Wortschatzarbeit im Lateinunterricht heraus und beleuchten die verschiedenen Aspekte der Wortschatzarbeit, die im Vortrag behandelt werden. Der zweite Abschnitt beschreibt die verschiedenen Stufen des Wortschatzerwerbs und die dazugehörigen Gelingensbedingungen. Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Wortschatzarbeit im Unterricht, wobei die einzelnen Stufen des Wortschatzerwerbs und die relevanten Unterrichtsmethoden erläutert werden. Der vierte Abschnitt behandelt die außerunterrichtliche Wortschatzarbeit. Der fünfte Abschnitt konzentriert sich auf die Herausforderungen bei der Zusammensetzung und dem Umfang des Lernwortschatzes und die daraus resultierenden Konsequenzen. Der sechste Abschnitt widmet sich der Methodik des Einführens und Aufnehmens neuen Wortschatzes im Spracherwerb.
Schlüsselwörter
Wortschatzarbeit, Lateinunterricht, Spracherwerb, Lernwortschatz, Semantisierungstechniken, Wörternetze, intra- und interlinguale Vernetzung, Unterrichtsarbeit, außerunterrichtliche Arbeit, Herausforderung I, Herausforderung II, adeo-NORM, Query-Corpus, Lernstrategie, Lehrmethode, Textabdeckung, Umwälzung, Lernpsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Semantisierung" im Lateinunterricht?
Semantisierung ist der Prozess der Ersteinführung und Erklärung der Bedeutung neuer Vokabeln im Unterricht.
Was sind "Wörternetze"?
Wörternetze sind ein Konzept zur Sicherung des Wortschatzes durch intra- und interlinguale Vernetzung, um das Behalten von Vokabeln zu erleichtern.
Wie umfangreich sollte der Lernwortschatz sein?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen bezüglich des Umfangs und der Repräsentativität des Wortschatzes, insbesondere in der Spracherwerbsphase.
Welche Rolle spielt das häusliche Vokabellernen?
Die außerunterrichtliche Arbeit (Vokabelwiederholung) ist essenziell, muss aber durch effektive Lernstrategien aus dem Unterricht gestützt werden.
Was ist das Ziel eines zeitgemäßen Lateinunterrichts?
Ziel ist eine effiziente Wortschatzarbeit, die durch moderne fachdidaktische Methoden die Textabdeckung und das langfristige Vokabelgedächtnis verbessert.
- Quote paper
- Matthias Korn (Author), 2015, Ne verba nos deficiant! Wortschatzarbeit im zeitgemäßen Lateinunterricht aus fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303412