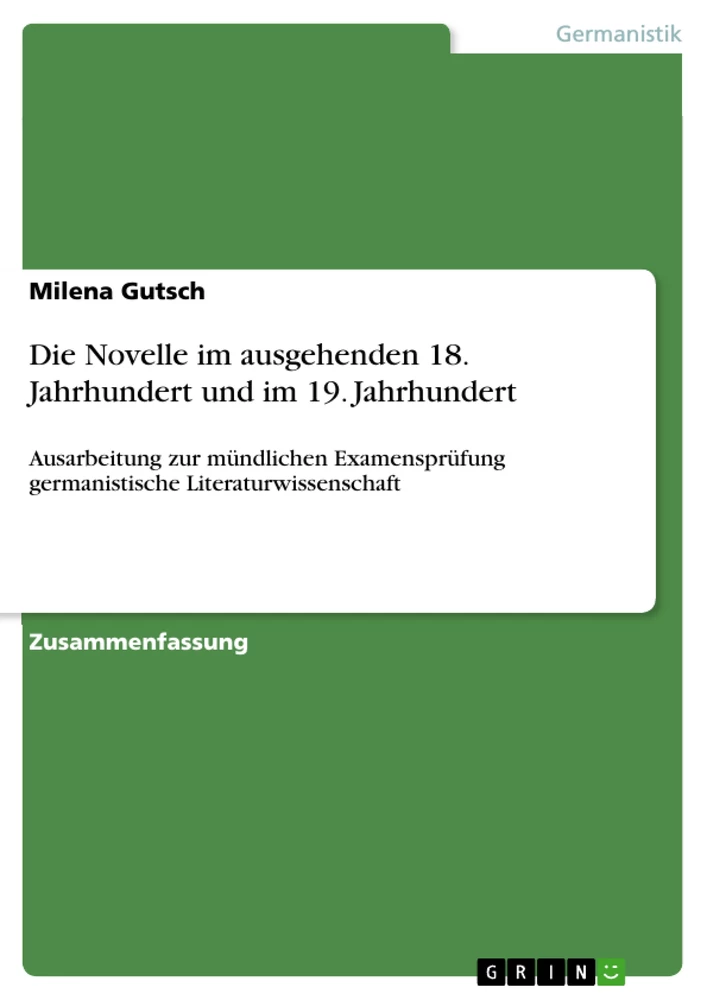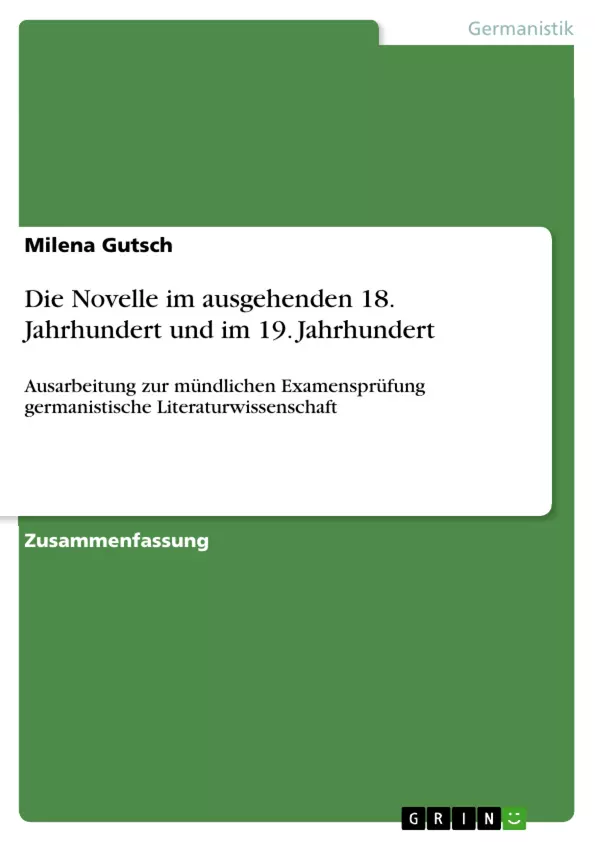Die vorliegende Ausarbeitung zur mündlichen Examensprüfung zum Thema "Die Novelle im ausgehenden 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert" umfasst folgende Schwerpunkte in Stichpunkten:
Was ist eine Novelle? - Betrachtung der Gattung Novelle mit kurzem geschichtlichen Abriss
Kurze Analysen der folgenden Novellen:
Johann Wolfgang von Goethe: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (1795),
Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili (1807),
Heinrich von Kleist: Die Marquise von O… (1808),
Adalbert Stifter: Brigitta (1847),
Theodor Storm: Immensee (1849),
Paul Heyse: L’Arrabbiata (1853),
Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe (1856),
Gottfried Keller: Die drei gerechten Kammmacher (1856),
Theodor Storm: Auf dem Staatshof (1859),
Theodor Storm: Pole Poppenspäler (1874),
Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel (1888),
Thomas Mann: Der kleine Herr Friedemann (1897).
Inhaltsverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Begriff, Bedeutung, Herkunft
- Novellentheorie
- Novellentechnik (allg. Strukturmerkmale)
- Novellenmärchen – Märchennovellen
- Novelle Roman – Kurzgeschichte
- Die Novelle der Klassik
- Novelle der Romantik
- Die Novelle der Restaurationszeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Novelle im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert in Deutschland. Sie analysiert die gattungsspezifischen Merkmale der Novelle, verfolgt deren theoretische Erfassung und beleuchtet die wichtigsten Entwicklungsphasen der Gattung, von der Klassik über die Romantik bis zur Restaurationszeit. Dabei wird der Fokus auf die zentralen Themen und Strukturmerkmale gelegt, die die Novelle in diesen verschiedenen Epochen prägten.
- Entwicklung der Novelle im 18. und 19. Jahrhundert
- Gattungsspezifische Merkmale der Novelle
- Novellentheorien und -diskurse
- Die Novelle in verschiedenen Epochen (Klassik, Romantik, Restaurationszeit)
- Zentrale Themen und Konflikte in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Primärliteratur: Diese Liste nennt wichtige Beispiele für Novellen des 18. und 19. Jahrhunderts, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage der Analyse dienen.
Sekundärliteratur: Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die relevanten theoretischen Ansätze zur Novelle. Er beginnt mit einer Betrachtung der Ursprünge und Entwicklung des Begriffs „Novelle“, analysiert verschiedene Novellentheorien von Wieland und Goethe bis hin zu den Romantikern und späteren Autoren wie Heyse und Storm. Es werden dabei zentrale Aspekte wie Kürze, Simplizität des Plans, die unerhörte Begebenheit, der Wendepunkt und die Beziehung zwischen Novelle, Roman und Kurzgeschichte diskutiert. Die verschiedenen theoretischen Perspektiven werden verglichen und gegeneinander abgewogen.
Begriff, Bedeutung, Herkunft: Die Herkunft des Begriffs „Novelle“ wird zurückverfolgt, beginnend mit den anonymen Biographien provenzalischer Troubadoure. Die Entwicklung in Italien zur Frührenaissance wird beschrieben, wobei Boccaccios „Decamerone“ als zentrales Urbild hervorgehoben wird. Der späte Einbürgerungs-prozess in Deutschland, die konkurrierenden Bezeichnungen und der erste Gebrauch des Begriffs durch Wieland werden ebenfalls erläutert.
Novellentheorie: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Versuchen, das novellistische Erzählen theoretisch zu erfassen. Die Ansätze von Wieland und Goethe werden detailliert analysiert, wobei deren Fokus auf Kürze, die „unerhörte Begebenheit“ und den Unterschied zum Roman im Vordergrund steht. Die romantische Novellentheorie, mit ihrer Betonung des subjektiven und objektiven, individuellen und sozialen Aspekts, wird ebenfalls behandelt. Die Bedeutung des Wendepunktes als Strukturprinzip der Novelle, wie von Tieck vertieft, und die Rolle des Einzelschicksals im Allgemeinen werden ausführlich diskutiert. Schließlich wird die Entwicklung hin zur Darstellung des Menschen in der Krise im 19. Jahrhundert dargestellt.
Novellentechnik (allg. Strukturmerkmale): Dieser Abschnitt befasst sich mit den allgemeinen Strukturmerkmalen der Novelle. Es wird betont, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, da die Gattung sich ständig weiterentwickelt. Die Bedeutung der Rahmenerzählung und deren verschiedene Formen werden erklärt. Das Verhältnis von Ereignis und Begebenheit, die Bedeutung des „Unerhörten“, die Gestaltungsansprüche von Konzentration und Objektivierung, sowie die Rolle des „Falken“ (Leitmotiv/Dingsymbol) werden ausführlich beschrieben. Der Wendepunkt als zentrales Handlungselement wird weiter vertieft, und die Novelle wird in ihrer Beziehung zu Märchen und Roman eingeordnet.
Novellenmärchen – Märchennovellen: Dieser Teil analysiert Mischformen der Novelle mit dem Märchen, die insbesondere in der Romantik auftraten. Die Spannung zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit wird als zentrales Merkmal dieser Mischformen hervorgehoben, wobei die Grenzen novellistischen Erzählens im Umgang mit dem Wunderbaren diskutiert werden.
Novelle Roman – Kurzgeschichte: In diesem Abschnitt wird die Novelle im Hinblick auf ihre Länge und ihren Platz zwischen Roman und Kurzgeschichte betrachtet. Der Unterschied im Fokus auf Handlungssubjekt, Handlungsziel und den Handlungsprozess selbst wird herausgestellt. Der Mensch wird in der Novelle als einem fremden, zufälligen Handlungsprozess unterworfen dargestellt, anders als im Roman und in der Kurzgeschichte, wo das selbstbestimmende Handeln im Vordergrund steht.
Die Novelle der Klassik: Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Novelle in der Klassik, mit Goethe als zentraler Figur. Der humane Optimismus und die Möglichkeit des moralisch richtigen Handelns werden hervorgehoben, gleichzeitig aber auch die Grenzen menschlicher Einflussnahme und das Fortbestehen phantastischer und schicksalhafter Elemente. Die Tendenz zur Auflösung von Konflikten in Harmonie wird besprochen. Im Kontrast dazu wird Kleist als Begründer der modernen deutschen Novelle vorgestellt, mit seinen Themen der Gefährdung und Zerstörung, des moralischen Skeptismus und der Abgründe der menschlichen und gesellschaftlichen Welt.
Novelle der Romantik: Der Abschnitt behandelt die Novelle der Romantik und den scheinbaren Gegensatz zwischen der novellistischen Bindung an die Endlichkeit und dem romantischen Streben nach Unendlichkeit. Die Dialektik von Begrenzung und Entgrenzung, die Mischung von Bewusstem und Unbewusstem, Phantasie und Phantastik wird als Merkmal romantischer Novellen herausgestellt. Die Entstehung phantastischer und märchenhafter Novellen wird beschrieben, sowie die Tendenz, in die psychischen Tiefen des Menschen einzutauchen.
Die Novelle der Restaurationszeit: Dieser Abschnitt behandelt die Novelle der Restaurationszeit. Der Rückzug vom Wunderbaren und die Hinwendung zum Beengten des Einzeldaseins werden als kennzeichnend beschrieben. Das Glück wird als im Subjekt liegend dargestellt, sowie in der Annahme der objektiven Lebensbedingungen. Adalbert Stifter wird als Beispiel genannt, der die kollektive Geschichtsenttäuschung mit der ästhetischen Beschwörung idyllischer Fiktionen verarbeitet. Stifters Novelle "Brigitta" wird als Beispiel einer Novelle mit dem Thema Daseinsvergewisserung und der Suche nach Glück in einer eng gewordenen Welt analysiert, mit Fokus auf dem Wendepunkt der Handlung.
Schlüsselwörter
Novelle, Gattungsmerkmale, Novellentheorie, Klassik, Romantik, Restaurationszeit, unerhörte Begebenheit, Wendepunkt, Ereignis, Handlung, Roman, Kurzgeschichte, Märchen, Mensch in der Krise, individuell, sozial, Symbol, Leitmotiv, Goethe, Kleist, Stifter, Storm, Heyse, Keller, Hauptmann, Mann.
Häufig gestellte Fragen zur Novelle im 18. und 19. Jahrhundert
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Novelle in Deutschland vom ausgehenden 18. bis ins 19. Jahrhundert. Sie analysiert gattungsspezifische Merkmale, verfolgt deren theoretische Erfassung und beleuchtet wichtige Entwicklungsphasen (Klassik, Romantik, Restaurationszeit). Der Fokus liegt auf zentralen Themen und Strukturmerkmalen der Novelle in diesen Epochen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Novelle im 18. und 19. Jahrhundert, ihre gattungsspezifischen Merkmale, Novellentheorien und -diskurse, die Novelle in verschiedenen Epochen (Klassik, Romantik, Restaurationszeit), sowie zentrale Themen und Konflikte in der Novelle. Es werden auch Mischformen wie Novellenmärchen und Märchennovellen betrachtet, und die Novelle im Verhältnis zu Roman und Kurzgeschichte eingeordnet.
Welche Epochen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Novelle der Klassik, Romantik und Restaurationszeit, wobei die jeweiligen Besonderheiten der Gattung in diesen Epochen herausgearbeitet werden.
Welche Autoren werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt und analysiert die Werke bedeutender Autoren wie Goethe, Kleist, Stifter, Storm, Heyse, Keller, Hauptmann und Mann. Die theoretischen Ansätze von Wieland und Goethe werden detailliert analysiert.
Welche zentralen Begriffe werden behandelt?
Zentrale Begriffe sind Novelle, Gattungsmerkmale, Novellentheorie, unerhörte Begebenheit, Wendepunkt, Ereignis, Handlung, Roman, Kurzgeschichte, Märchen, Mensch in der Krise, individuell, sozial, Symbol, Leitmotiv.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen zu Primär- und Sekundärliteratur, sowie einzelnen Aspekten der Novellentheorie und -entwicklung, und abschließend Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Strukturmerkmale der Novelle laut dieser Arbeit?
Die Arbeit betont, dass es keine allgemeingültige Definition gibt. Wichtige Aspekte sind jedoch Kürze, Simplizität des Plans, die unerhörte Begebenheit, der Wendepunkt, das Verhältnis von Ereignis und Begebenheit, Konzentration und Objektivierung, die Rolle von Rahmenerzählungen und Leitmotiven. Der Unterschied zur Kurzgeschichte und zum Roman wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird der Begriff "Novelle" definiert und hergeleitet?
Die Arbeit verfolgt die Herkunft des Begriffs "Novelle" von den anonymen Biographien provenzalischer Troubadoure bis hin zu Boccaccios "Decamerone" und seinem späten Einbürgerungsprozess in Deutschland. Die verschiedenen Begriffsverständnisse und -entwicklungen werden nachvollzogen.
Welche Rolle spielt der Wendepunkt in der Novelle?
Der Wendepunkt wird als zentrales Handlungselement der Novelle beschrieben und seine Bedeutung für die Struktur und den Verlauf der Handlung ausführlich diskutiert.
Wie wird die Novelle im Verhältnis zu Märchen und Roman betrachtet?
Die Arbeit analysiert Mischformen aus Novelle und Märchen (besonders in der Romantik) und ordnet die Novelle hinsichtlich Länge und Fokus auf Handlungssubjekt, Handlungsziel und Handlungsprozess zwischen Roman und Kurzgeschichte ein.
- Quote paper
- Milena Gutsch (Author), 2012, Die Novelle im ausgehenden 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303595