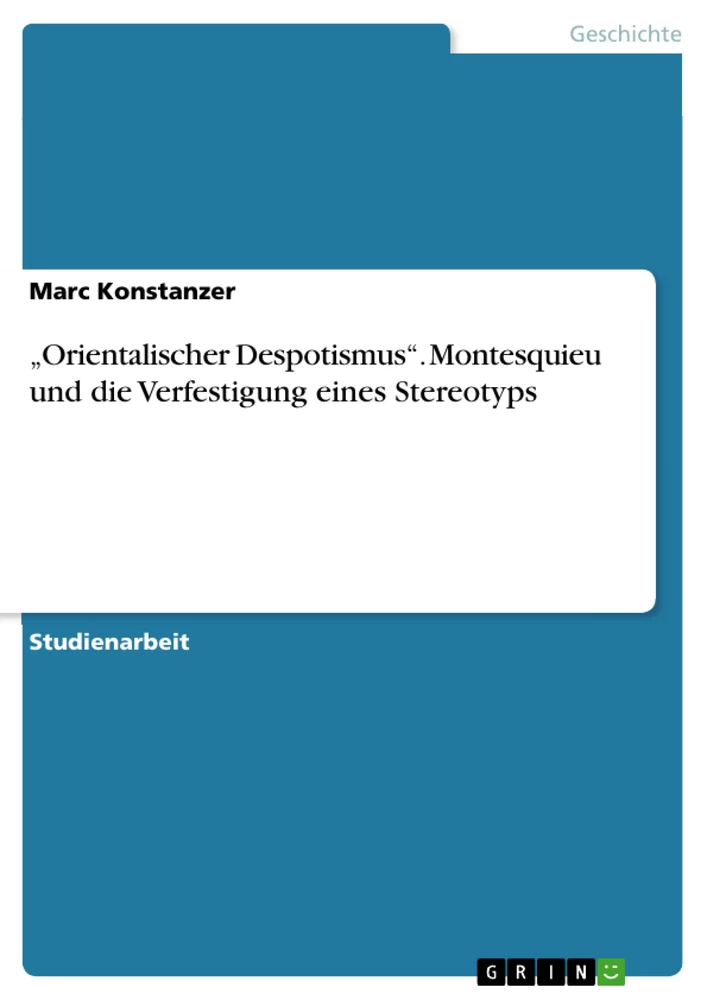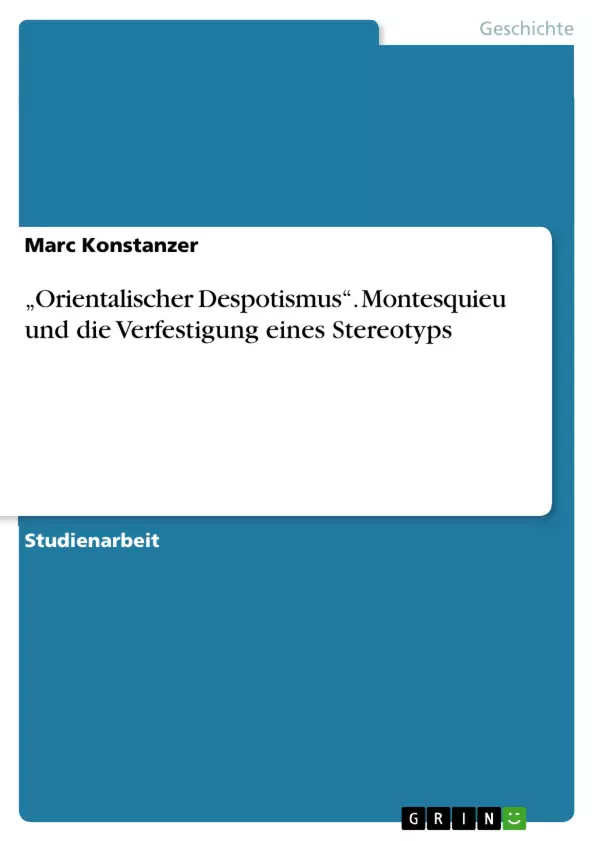Diese Proseminar-Arbeit diskutiert den Einfluss Montesquieus und seiner im Werk "Vom Geist der Gesetze" vorgelegten Staats- und Regierungslehre auf den europäischen Orientdiskurs unter besonderer Berücksichtigung deutscher Gelehrter.
Die Arbeit schließt an die Thesen Edward Saids an, die im Zuge seines 1978 veröffentlichten Werks "Orientalismus" in der Wissenschaft breit diskutiert wurden. Note: 1,0.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Michel Foucault als Inspirationsquelle für Edward Said
- 2. Montesquieus Regierungstypologie
- 3. Montesquieus Beitrag zur Entstehung des Orientalismus
- 3.1 Kontextanalyse
- 3.2 Analyse der Aussagen
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Regierungstypologie Montesquieus und ihres darin enthaltenen Typus der orientalischen Despotie auf den europäischen Orientdiskurs im 19. und 20. Jahrhundert, wie er von Edward Said dargestellt wird. Sie zielt darauf ab, die Rekonstruktion des Diskurses anhand der Diskurstheorie Michel Foucaults zu untersuchen.
- Die Rekonstruktion des europäischen Orientdiskurses im 19. und 20. Jahrhundert
- Der Einfluss der Diskurstheorie Michel Foucaults auf die Studien von Edward Said
- Die Regierungstypologie Montesquieus und ihr Einfluss auf die Entstehung des Orientalismus
- Die Rolle der orientalischen Despotie als Stereotyp im europäischen Diskurs
- Die Analyse der Aussagen Montesquieus zum Wesen der orientalischen Despotie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Postkolonialismus und die Kritik an der westlichen Orientalistik. Sie führt in die zentralen Thesen der Arbeit ein und benennt den Fokus auf Montesquieus Regierungstypologie.
- 1. Michel Foucault als Inspirationsquelle für Edward Said: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss der Diskurstheorie Michel Foucaults auf die Studien von Edward Said. Es beleuchtet Foucaults Konzept des Diskurses und seine methodischen Ansätze.
- 2. Montesquieus Regierungstypologie: Dieses Kapitel präsentiert die Regierungstypologie Montesquieus und erklärt seine Unterscheidung zwischen Republik, Monarchie und Despotie. Es fokussiert auf die Beschreibung der Despotie und ihre Verortung in Asien.
- 3. Montesquieus Beitrag zur Entstehung des Orientalismus: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Montesquieus Regierungstypologie auf den europäischen Orientdiskurs. Es analysiert den historischen Kontext der Entstehung des Werkes und die zentralen Aussagen Montesquieus zum Wesen der orientalischen Despotie.
Schlüsselwörter
Orientalismus, Despotie, Montesquieu, Foucault, Diskursanalyse, Kolonialismus, Postkolonialismus, Orient, Okzident, Kultur, Wissen, Macht, Stereotyp.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Montesquieu unter „orientalischer Despotie“?
Montesquieu beschreibt dies als einen Regierungstypus, der vor allem in Asien verortet wird und durch die willkürliche Herrschaft eines Einzelnen ohne feste Gesetze geprägt ist.
Welchen Einfluss hatte Montesquieu auf den Orientalismus?
Sein Werk „Vom Geist der Gesetze“ trug maßgeblich zur Verfestigung westlicher Stereotypen über den Orient als Ort der Rückständigkeit und Tyrannei bei.
Wie hängen die Thesen von Edward Said mit dieser Arbeit zusammen?
Die Arbeit schließt an Saids Kritik im Werk „Orientalismus“ an, wonach westliche Gelehrte den Orient durch diskursive Machtstrukturen erst als „das Andere“ konstruiert haben.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Analyse?
Foucaults Diskurstheorie dient als methodische Grundlage, um zu untersuchen, wie Wissen über den Orient zur Ausübung von Macht instrumentalisiert wurde.
Wie unterscheidet Montesquieu zwischen Monarchie und Despotie?
In der Monarchie herrscht der Fürst nach festen Gesetzen, während in der Despotie allein der Wille des Herrschers ohne rechtliche Schranken gilt.
- Quote paper
- Marc Konstanzer (Author), 2015, „Orientalischer Despotismus“. Montesquieu und die Verfestigung eines Stereotyps, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303672