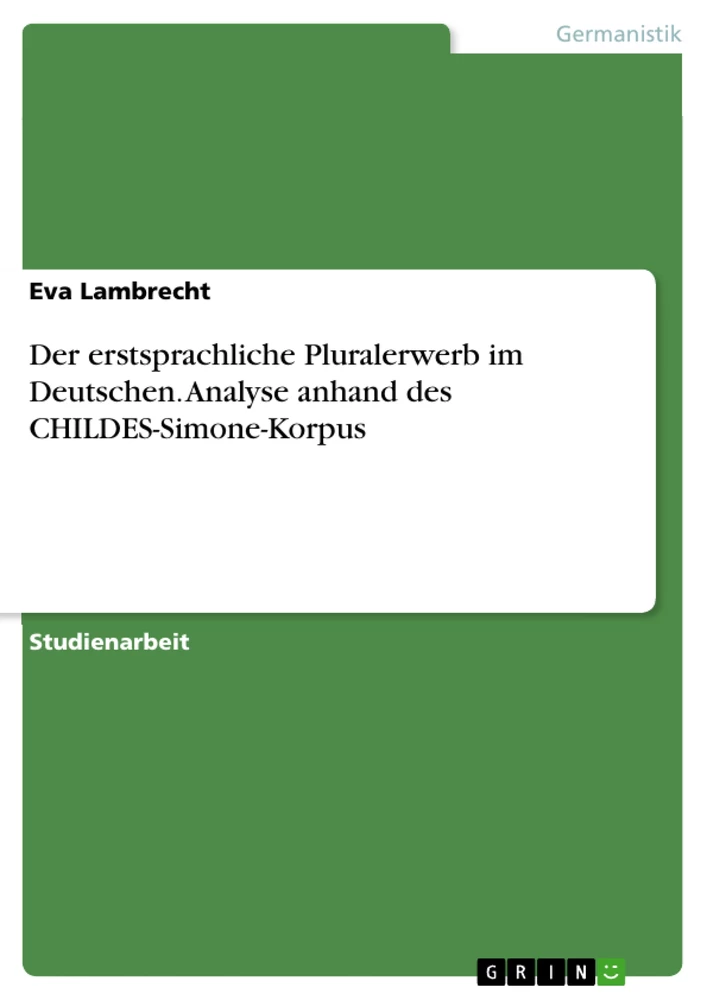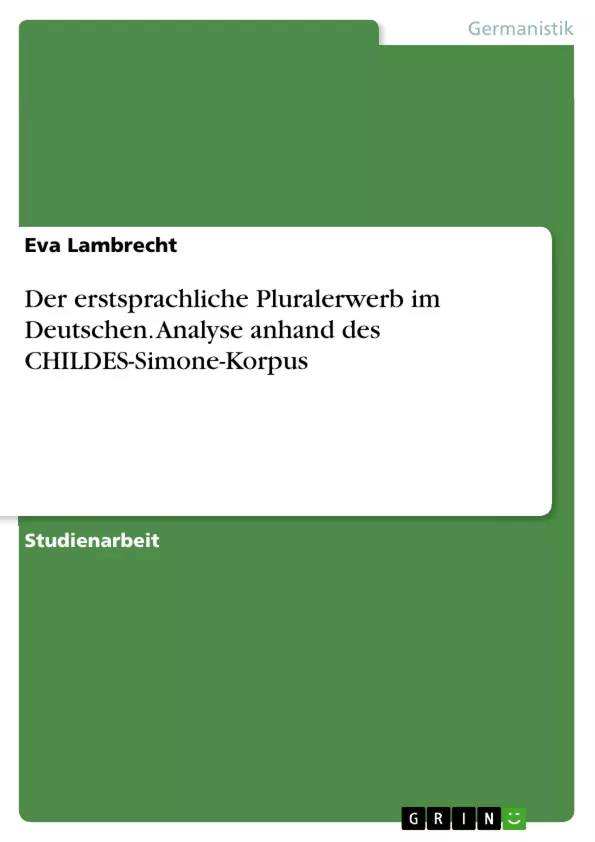Der Erwerb des Plurals stellt einen essentiellen Teil des kindlichen Spracherwerbs dar, der bereits vielfach untersucht worden ist. Eine einheitliche Antwort darauf, wie Kinder die grammatischen Strukturen ihrer Muttersprache erlernen, hat die Wissenschaft bislang jedoch nicht geben können.
So gibt es eine Vielzahl verschiedener Ansätze, welche auf unterschiedliche, teilweise auch kontrastierende Weise den Grammatikerwerb zu erklären suchen. Diese theoretischen Modelle basieren oftmals auf der Analyse und Interpretation von empirischen Daten wie etwa kindliche Sprechdaten.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Pluralfehlern, die aus den spontanen Sprechdaten eines Mädchens namens Simone stammen. Zunächst jedoch erfolgt eine grundlegende Darstellung des Pluralsystems im Deutschen. Diese Erläuterung beinhaltet neben den acht Pluralendungen auch einige Regelhaftigkeiten der deutschen Pluralmarkierung.
Weiterhin folgt die Vorstellung zweier Spracherwerbstheorien. Diese liefern unterschiedliche Erklärungen dafür, wie grammatische Strukturen erlernt und verarbeitet werden. Diesem theoretischen Unterbau schließt sich dann die Analyse und Besprechung der inkorrekten Pluralmarkierungen, welche Simone verwendet, an.
Nach der Vorstellung der Methodik bezüglich der Datenauswahl und Vorgehensweise folgt der eigentliche Hauptteil. Die Analyse orientiert sich neben Erklärungen, die oben genannte Erwerbsmodelle liefern, auch an den Regelhaftigkeiten des deutschen Pluralsystems. Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse nochmals zusammengefasst präsentiert und besprochen.
Den Abschluss der Hausarbeit bildet dann das Fazit, in dem die Ergebnisse noch einmal diskutiert werden. Auch soll hier ein Ausblick in die Zukunft der Spracherwerbsforschung gewagt werden.
Im Anhang befindet sich eine detaillierte Auflistung aller von Simone verwendeten Pluralformen in den ausgewählten Transkripten. Diese beinhaltet auch die im Rahmen der Fehleranalyse besprochenen inkorrekt markierten Formen. Diese sind den einzelnen Altersstufen chronologisch zugeordnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsüberblick
- Pluralsystem im Deutschen
- Plural im Spracherwerb
- Analyse von Pluralformen anhand des Simone-Korpus
- Methode
- Analyse
- Auslassung
- Ersetzung
- Hinzufügung
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Pluralfehler im kindlichen Spracherwerb am Beispiel des Simone-Korpus. Ziel ist es, die Komplexität des deutschen Pluralsystems aufzuzeigen und anhand empirischer Daten verschiedene Spracherwerbstheorien zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die Fehlertypen Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Pluralmarkierungen.
- Komplexität des deutschen Pluralsystems
- Analyse von Pluralfehlern im kindlichen Spracherwerb
- Anwendung und Vergleich verschiedener Spracherwerbstheorien
- Kategorisierung von Fehlertypen (Auslassung, Ersetzung, Hinzufügung)
- Zusammenhang zwischen Fehlertypen und dem deutschen Pluralsystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des kindlichen Pluralerwerbs im Deutschen ein und beschreibt den Forschungsstand. Sie benennt die Forschungslücke bezüglich einheitlicher Erklärungsmodelle für den Grammatikerwerb und stellt die vorliegende Arbeit als Analyse von Pluralfehlern im Simone-Korpus vor. Die Arbeit gliedert sich in die Darstellung des deutschen Pluralsystems, die Vorstellung relevanter Spracherwerbstheorien, die Analyse der Pluralfehler und ein abschließendes Fazit.
Forschungsüberblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das komplexe deutsche Pluralsystem, um die Leistung des Kindes beim Spracherwerb zu verdeutlichen und die Grundlage für die spätere Fehleranalyse zu legen. Es werden die verschiedenen Pluralbildungsregeln (z.B. -e, -n, -er, Umlaut) und deren Regelhaftigkeit (deterministisch vs. probabilistisch) erläutert. Anschließend werden zwei relevante Spracherwerbstheorien vorgestellt, um später die beobachteten Fehler im Kontext dieser Theorien zu interpretieren.
Analyse von Pluralformen anhand des Simone-Korpus: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Analyse der Pluralfehler im Simone-Korpus. Die Analyse selbst konzentriert sich auf drei Fehlertypen: Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Pluralmarkierungen. Für jeden Fehlertyp werden Beispiele aus dem Korpus präsentiert und im Kontext der zuvor vorgestellten Spracherwerbstheorien und des deutschen Pluralsystems interpretiert. Die Ergebnisse dieser Analyse werden ausführlich dargestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Pluralerwerb, Deutsch, Simone-Korpus, Spracherwerbstheorien, Pluralmarkierung, Fehleranalyse, Auslassung, Ersetzung, Hinzufügung, Regelhaftigkeit, Determinismus, Probabilismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Pluralfehlern im Simone-Korpus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Fehler im Pluralgebrauch im kindlichen Spracherwerb anhand des Simone-Korpus. Sie untersucht die Komplexität des deutschen Pluralsystems und beleuchtet verschiedene Spracherwerbstheorien anhand empirischer Daten. Der Fokus liegt auf den Fehlertypen Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Pluralmarkierungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Forschungsüberblick (mit Fokus auf das deutsche Pluralsystem und relevante Spracherwerbstheorien), die Analyse der Pluralformen im Simone-Korpus (einschließlich Methodik, Analyse der Fehlertypen und Ergebnisse) und ein Fazit.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Analyse basiert auf dem Simone-Korpus und konzentriert sich auf die Identifizierung und Kategorisierung von Pluralfehlern in drei Kategorien: Auslassung, Ersetzung und Hinzufügung von Pluralmarkierungen. Die Ergebnisse werden im Kontext des deutschen Pluralsystems und relevanter Spracherwerbstheorien interpretiert.
Welche Fehlertypen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei Haupttypen von Pluralfehlern: Auslassung (fehlende Pluralmarkierung), Ersetzung (falsche Pluralmarkierung) und Hinzufügung (unzulässige Pluralmarkierung). Jedes dieser Fehlermuster wird anhand von Beispielen aus dem Korpus illustriert und analysiert.
Welche Spracherwerbstheorien werden berücksichtigt?
Die Arbeit erwähnt zwar nicht explizit *welche* Spracherwerbstheorien untersucht werden, impliziert aber, dass relevante Theorien herangezogen werden, um die beobachteten Fehler zu interpretieren und im Kontext des Spracherwerbs zu verstehen. Diese Theorien dienen als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Analyse der drei Fehlertypen (Auslassung, Ersetzung, Hinzufügung) im Detail. Diese Ergebnisse werden im Kontext des deutschen Pluralsystems und der berücksichtigten Spracherwerbstheorien diskutiert und interpretiert, um ein besseres Verständnis des kindlichen Pluralerwerbs zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pluralerwerb, Deutsch, Simone-Korpus, Spracherwerbstheorien, Pluralmarkierung, Fehleranalyse, Auslassung, Ersetzung, Hinzufügung, Regelhaftigkeit, Determinismus, Probabilismus.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Komplexität des deutschen Pluralsystems aufzuzeigen und anhand empirischer Daten aus dem Simone-Korpus verschiedene Spracherwerbstheorien zu beleuchten. Die Arbeit möchte ein tieferes Verständnis des kindlichen Pluralerwerbs und der damit verbundenen Herausforderungen liefern.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Forschungslücke bezüglich einheitlicher Erklärungsmodelle für den Grammatikerwerb zu adressieren, indem sie eine detaillierte Analyse von Pluralfehlern im kindlichen Spracherwerb bietet.
- Quote paper
- Eva Lambrecht (Author), 2012, Der erstsprachliche Pluralerwerb im Deutschen. Analyse anhand des CHILDES-Simone-Korpus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303840