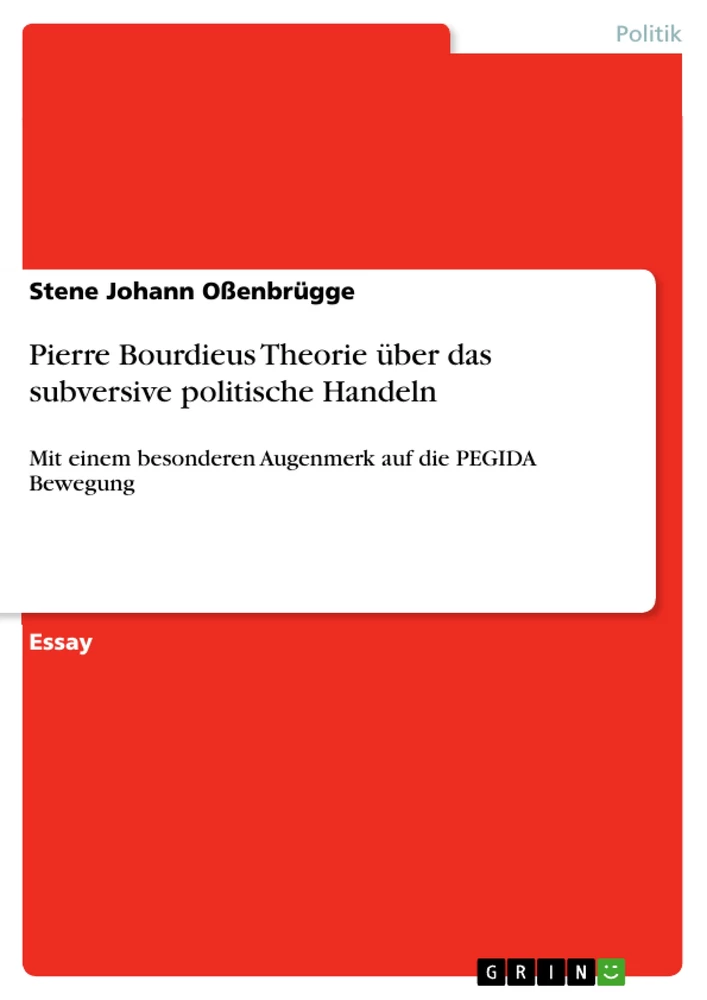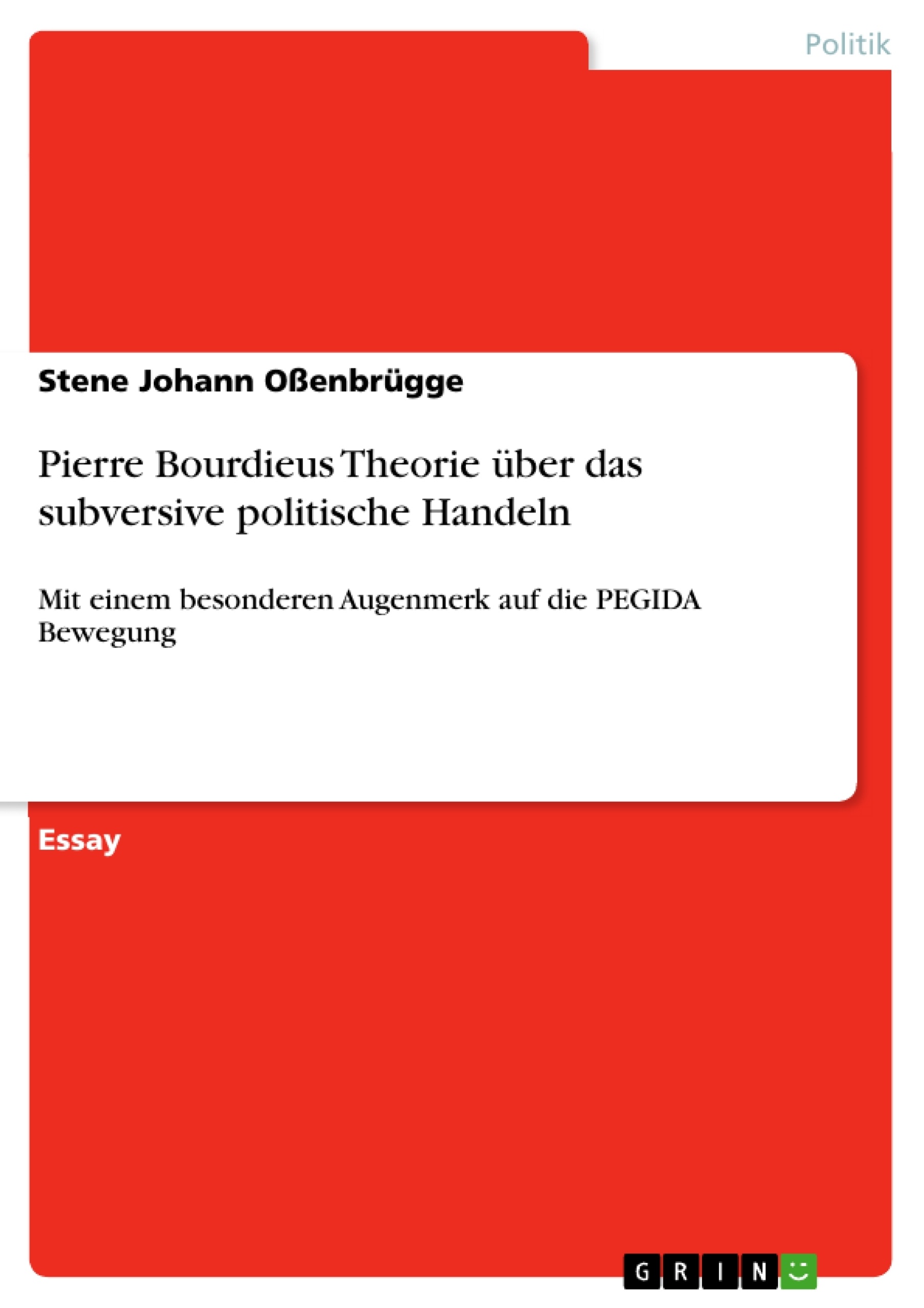Dieses Essay soll textnah die Argumentation von Pierre Bourdieu über die Möglichkeit des subversiven politischen Handelns wiedergeben. Dafür versuche ich aufzudecken, inwieweit und wodurch Akteure politisch handlungsfähig sind, wie sich politische Gruppen als Zusammenschlüsse interessennaher Akteure organisieren, welche Probleme dabei für subversive Gruppen entstehen und wie diese letztlich ihre Subversivität durchsetzen oder einbüßen.
Aufgrund des aktuellen Anlasses der regelmäßigen Demonstrationen der PEGIDA und ihrer Gegenbewegung möchte ich die Thesen Bourdieus unter anderem auf dieses Beispiel anwenden um aufzuzeigen, ob und inwiefern die Bewegung der PEGIDA subversiv zu nennen ist und welches Gefüge der oberflächlich divers erscheinenden Gegenbewegung zugrunde liegt. Die von Bourdieu angeführten Begriffe sind bei erstmaliger Verwendung kursiv geschrieben, Zitate und populäre Parolen apostrophiert.
Inhaltsverzeichnis
- Der soziale Akteur und die Beeinflussung der Erkenntnis
- Doxa, Illusio und Common Sense
- Hemmnisse subversiven Handelns: Die Rolle des Bildungskapitals
- Gruppenbildung und Repräsentation
- Politische Repräsentation und die Beeinflussung der Erkenntnis
- Kognitive Subversion und der Bruch mit der Doxa
- Autorisierte und autorisierende Sprache
- Der Widerspruch zwischen häretischen Intentionen und sozialer Position
- Herrschende und Beherrschte: Ein Widerspruch ohne Widerspruch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Pierre Bourdieus Theorie des subversiven politischen Handelns. Es wird untersucht, wie Akteure politisch handlungsfähig werden, wie sich politische Gruppen organisieren und welche Herausforderungen subversive Gruppen meistern müssen. Das Beispiel der PEGIDA-Bewegung und ihrer Gegenbewegung dient zur Illustration.
- Der Einfluss von sozialen Strukturen und mentalen Schemata auf politisches Handeln
- Die Rolle von Bildungskapital und Klassenzugehörigkeit bei der Konstituierung politischer Gruppen
- Die Bedeutung von Sprache und Diskurs für subversive Bewegungen
- Der Widerspruch zwischen der expliziten und impliziten Programmatik subversiver Gruppen
- Die Herausforderungen für subversive Gruppen bei der Durchsetzung ihrer Ziele
Zusammenfassung der Kapitel
Der soziale Akteur und die Beeinflussung der Erkenntnis: Dieser Abschnitt untersucht den Ausgangspunkt von Bourdieus Theorie: den sozialen Akteur als Individuum, das in der sozialen Welt agiert und diese durch seine Handlungen und sein Wissen beeinflusst. Bourdieu betont die wechselseitige Beziehung zwischen politischem Handeln und Erkenntnisprozess. Die soziale Welt beeinflusst die Erkenntnis des Akteurs, und umgekehrt gestaltet das Handeln die Repräsentationen der Welt. Hier wird die Grundlage für das Verständnis von Machtstrukturen und deren Einfluss auf das Denken und Handeln gelegt, ein Kernelement für die spätere Analyse subversiver Handlungen.
Doxa, Illusio und Common Sense: Dieser Teil erläutert zentrale Bourdieu'sche Konzepte: Die Doxa als die unbefragte Akzeptanz der bestehenden Ordnung, die Illusio als das Vertrauen in die Regeln eines sozialen Feldes und der Common Sense als daraus resultierender Konsens. Bourdieu analysiert, wie diese Konzepte die Meinungsbildung und das politische Handeln beeinflussen und welche Rolle sie für die Akzeptanz oder Ablehnung von Veränderungen spielen. Der Bezug auf Nietzsche unterstreicht die Kritik an der Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen und die damit verbundenen Hemmnisse für subversives Denken und Handeln.
Hemmnisse subversiven Handelns: Die Rolle des Bildungskapitals: Hier wird aufgezeigt, wie die Verinnerlichung objektiver Strukturen (Doxa) die Subversivität behindert. Das Beispiel einer Schulprüfung veranschaulicht, dass auch Akteure aus unterprivilegierten Schichten den Legitimitätsbegriff der herrschenden Kultur verinnerlicht haben. Dies unterstreicht die Schwierigkeit, eine wirklich subversive Haltung einzunehmen, da die Akzeptanz bestehender Strukturen tief verwurzelt ist. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere Diskussion der Herausforderungen subversiver Gruppen.
Gruppenbildung und Repräsentation: Dieser Abschnitt beschreibt die Bildung politischer Gruppen aus Einzelakteuren, die sich zu einer gemeinsamen Antwort auf soziale Fragen verständigen. Bourdieu betont die Bedeutung von Bildungskapital für die Formulierung und Vertretung dieser Positionen. Die Notwendigkeit von Wortführern mit hohem Bildungskapital zeigt, wie Ungleichheiten im Bildungssystem die politische Partizipation beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Darstellung, wie die Legitimität der Gruppenmeinung eng mit dem Bildungskapital der Repräsentanten verbunden ist.
Politische Repräsentation und die Beeinflussung der Erkenntnis: Hier wird die Rolle professioneller Politiker und deren Einfluss auf die Erkenntnis der von ihnen vertretenen Gruppen analysiert. Bourdieu argumentiert, dass Parteien sowohl das Angebot an politischen Leistungen definieren als auch bestimmen, welche Forderungen legitim sind. Dies verdeutlicht, wie die politische Repräsentation die Möglichkeiten subversiver Gruppen einschränkt und ihre Erkenntnis beeinflusst. Die historische Entwicklung der sozialistischen Arbeiterparteien dient als Beispiel für diese Dynamik.
Kognitive Subversion und der Bruch mit der Doxa: Dieser Abschnitt fokussiert auf den notwendigen Bruch mit der Doxa für eine wirkliche politische Subversion. Bourdieu betont die Bedeutung einer Veränderung der Weltsicht ("kognitive Subversion") und die Rolle der Sprache bei diesem Prozess. Der Erfolg einer Häresie hängt nicht von charismatischen Führern ab, sondern von der Dialektik der autorisierten und autorisierenden Sprache. Dieser Abschnitt verbindet die vorherigen Punkte und unterstreicht den Einfluss der Sprache auf das gesellschaftliche Denken und Handeln.
Autorisierte und autorisierende Sprache: Dieser Abschnitt vertieft die Rolle der Sprache im subversiven politischen Handeln. Die autorisierte Sprache beruht auf der kollektiven Identifizierung von Gruppenmitgliedern, während die autorisierende Sprache von der Gruppe selbst gestaltet wird und neue Regeln eines common sense etabliert. Der Begriff der "negativ autorisierten Sprache" wird eingeführt, um die Wirkung von Außenstehenden auf die Selbstwahrnehmung subversiver Gruppen zu beschreiben. Beispiele aus der politischen Praxis illustrieren diese Konzepte.
Der Widerspruch zwischen häretischen Intentionen und sozialer Position: Hier wird der Widerspruch zwischen den Intentionen einer subversiven Gruppe und der sozialen Position ihrer Wortführer analysiert. Bourdieu argumentiert, dass die Wortführer, oft aus privilegierten Verhältnissen stammend, einem Konflikt zwischen ihrem expliziten Programm und ihrem impliziten Habitus unterliegen. Dieser innere Widerspruch stellt eine bedeutende Hürde für den Erfolg subversiver politischer Projekte dar.
Herrschende und Beherrschte: Ein Widerspruch ohne Widerspruch: Im letzten analysierten Kapitel wird der Gegensatz zwischen den Strategien der Herrschenden und der Beherrschten herausgearbeitet. Die Herrschenden brauchen keine explizite Explikationsarbeit, im Gegensatz zu den Vertretern subversiver Gruppen. Ihre Position wird durch ihre soziale Zugehörigkeit und ihr Kapital abgesichert, ohne dass sie ihren Standpunkt rechtfertigen müssen. Der Abschnitt verdeutlicht die asymmetrischen Machtverhältnisse im politischen Feld.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, subversives politisches Handeln, Doxa, Illusio, Common Sense, Bildungskapital, Klassenkampf, politische Repräsentation, Sprache, Diskurs, Häresie, kognitive Subversion, PEGIDA.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse subversiven politischen Handelns nach Pierre Bourdieu
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Die Analyse untersucht Pierre Bourdieus Theorie des subversiven politischen Handelns. Sie beleuchtet, wie Akteure politisch handlungsfähig werden, wie sich politische Gruppen organisieren und welche Herausforderungen subversive Gruppen meistern müssen. Die PEGIDA-Bewegung und ihre Gegenbewegung dienen als illustrierendes Beispiel.
Welche zentralen Bourdieu'schen Konzepte werden behandelt?
Die Analyse behandelt zentrale Konzepte wie Doxa (unbefragte Akzeptanz der bestehenden Ordnung), Illusio (Vertrauen in die Regeln eines sozialen Feldes) und Common Sense (daraus resultierender Konsens). Es wird untersucht, wie diese Konzepte die Meinungsbildung und das politische Handeln beeinflussen und welche Rolle sie für die Akzeptanz oder Ablehnung von Veränderungen spielen.
Welche Rolle spielt das Bildungskapital?
Die Analyse betont die Bedeutung des Bildungskapitals für die Konstituierung politischer Gruppen und die Formulierung und Vertretung politischer Positionen. Es wird gezeigt, wie Ungleichheiten im Bildungssystem die politische Partizipation beeinflussen und wie die Legitimität der Gruppenmeinung eng mit dem Bildungskapital der Repräsentanten verbunden ist.
Wie wird politische Repräsentation betrachtet?
Die Analyse untersucht die Rolle professioneller Politiker und deren Einfluss auf die Erkenntnis der von ihnen vertretenen Gruppen. Es wird argumentiert, dass Parteien sowohl das Angebot an politischen Leistungen definieren als auch bestimmen, welche Forderungen legitim sind. Dies verdeutlicht, wie die politische Repräsentation die Möglichkeiten subversiver Gruppen einschränkt und ihre Erkenntnis beeinflusst.
Was versteht man unter kognitiver Subversion?
Kognitive Subversion beschreibt den notwendigen Bruch mit der Doxa für eine wirkliche politische Subversion. Es wird die Bedeutung einer Veränderung der Weltsicht und die Rolle der Sprache in diesem Prozess hervorgehoben. Der Erfolg einer Häresie hängt nicht von charismatischen Führern ab, sondern von der Dialektik der autorisierten und autorisierenden Sprache.
Welche Rolle spielt die Sprache im subversiven Handeln?
Die Analyse differenziert zwischen autorisierter Sprache (kollektive Identifizierung von Gruppenmitgliedern) und autorisierender Sprache (von der Gruppe selbst gestaltet, etabliert neue Regeln eines Common Sense). Der Begriff der "negativ autorisierten Sprache" beschreibt die Wirkung von Außenstehenden auf die Selbstwahrnehmung subversiver Gruppen.
Wie wird der Widerspruch zwischen Intentionen und sozialer Position behandelt?
Die Analyse beleuchtet den Widerspruch zwischen den Intentionen einer subversiven Gruppe und der sozialen Position ihrer Wortführer. Oft aus privilegierten Verhältnissen stammend, unterliegen diese einem Konflikt zwischen explizitem Programm und implizitem Habitus. Dieser innere Widerspruch stellt eine bedeutende Hürde für den Erfolg subversiver Projekte dar.
Wie werden die Strategien der Herrschenden und Beherrschten verglichen?
Der letzte Abschnitt vergleicht die Strategien der Herrschenden und Beherrschten. Die Herrschenden benötigen im Gegensatz zu Vertretern subversiver Gruppen keine explizite Rechtfertigung ihres Standpunkts, da ihre Position durch soziale Zugehörigkeit und Kapital abgesichert ist. Dies verdeutlicht die asymmetrischen Machtverhältnisse im politischen Feld.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Der soziale Akteur und die Beeinflussung der Erkenntnis; Doxa, Illusio und Common Sense; Hemmnisse subversiven Handelns: Die Rolle des Bildungskapitals; Gruppenbildung und Repräsentation; Politische Repräsentation und die Beeinflussung der Erkenntnis; Kognitive Subversion und der Bruch mit der Doxa; Autorisierte und autorisierende Sprache; Der Widerspruch zwischen häretischen Intentionen und sozialer Position; Herrschende und Beherrschte: Ein Widerspruch ohne Widerspruch.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Pierre Bourdieu, subversives politisches Handeln, Doxa, Illusio, Common Sense, Bildungskapital, Klassenkampf, politische Repräsentation, Sprache, Diskurs, Häresie, kognitive Subversion, PEGIDA.
- Citar trabajo
- Stene Johann Oßenbrügge (Autor), 2015, Pierre Bourdieus Theorie über das subversive politische Handeln, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304131