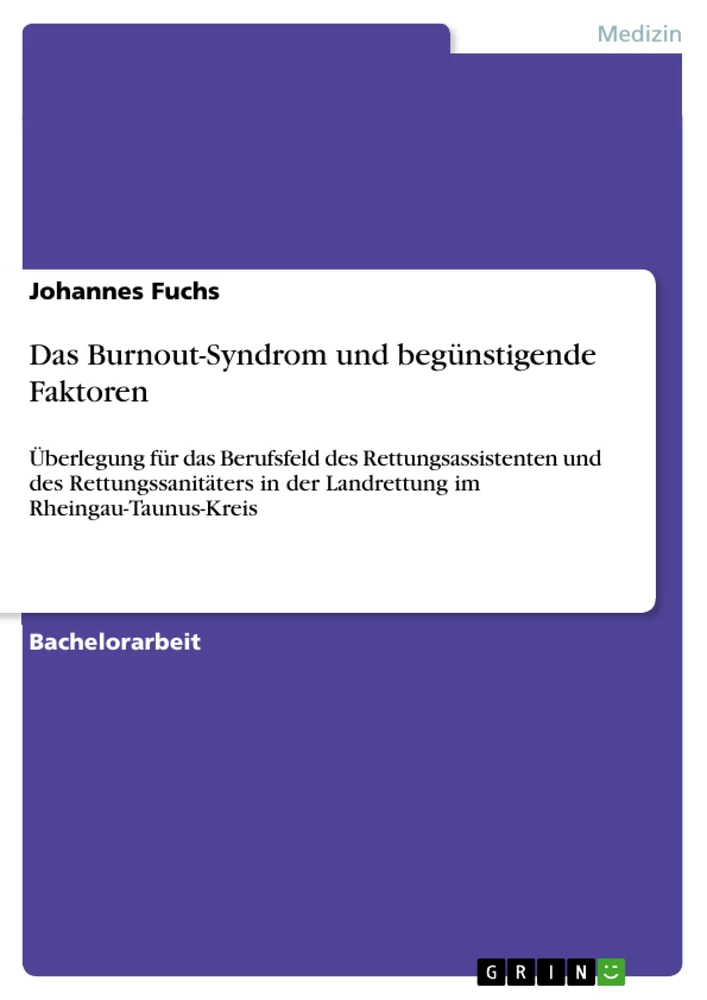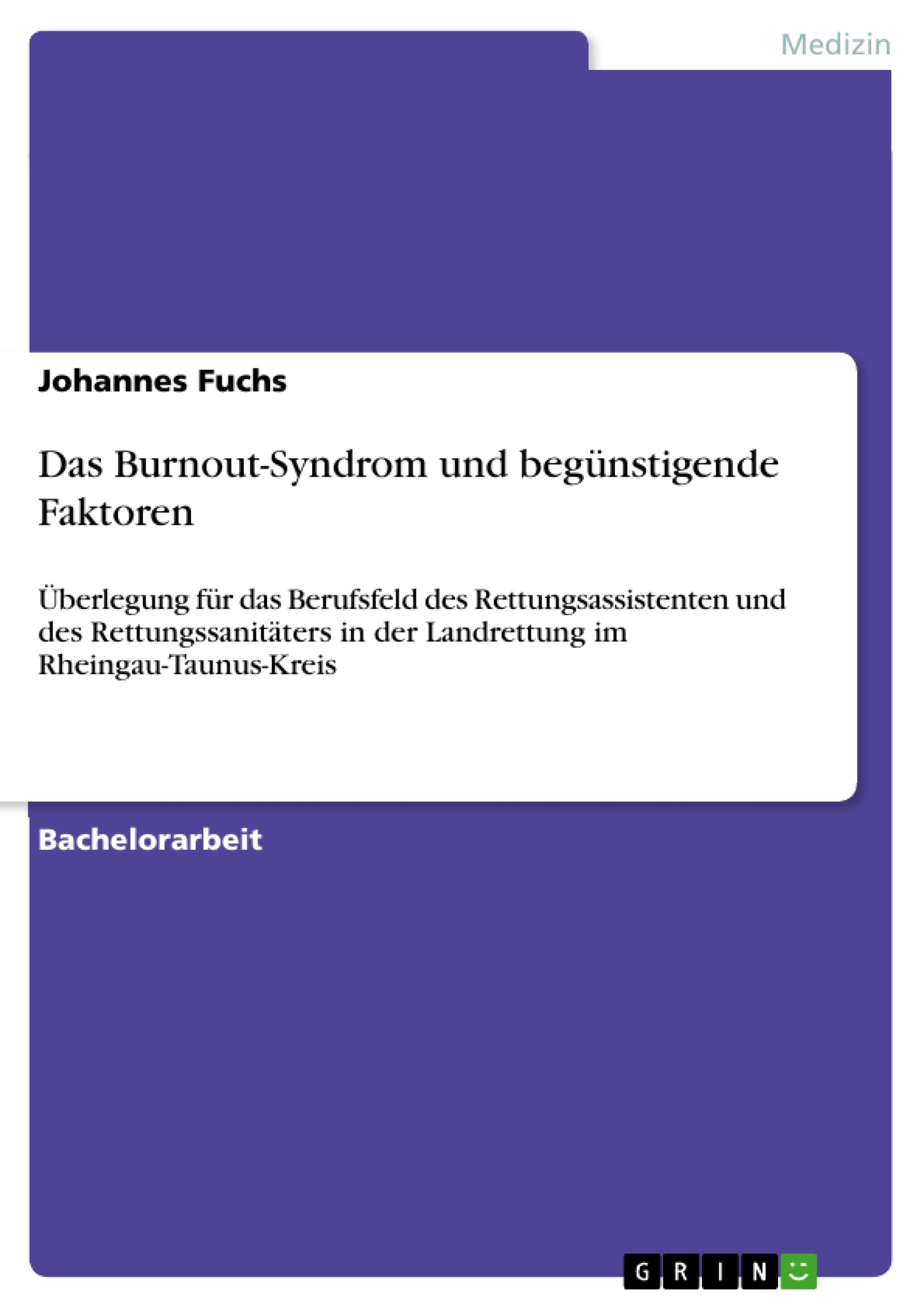Die Arbeitsbelastung im Rettungsdienst ist durch Schichtdienst einschließlich Dienst an Wochenenden und Feiertagen hoch. Hinzu kommt es für das Rettungsdienstpersonal während des Einsatzes zu emotionalen, psychischen und körperlichen Belastungen. Heringshausen beschreibt eine zunehmende Komplexität in diesem Berufsfeld: „Die präklinische Akutversorgung von Notfallpatienten stellt aufgrund immer komplexer werdender diagnostischer und therapeutischer Optionen sowie organisatorischer und arbeitsgesetzlicher Rahmenbedingungen hohe Anforderungen an das Rettungsdienstpersonal“ (Heringshausen, 2011, 5). Ein Burnout scheint bei solchen Arbeitsbedingungen nicht selten vorprogrammiert zu sein. Doch „Burnout wird häufig noch als Schwäche, Versagen oder individuelle Fehlleistung angesehen, obwohl in der Forschung zunehmend akzeptiert wird, dass die Arbeitsbedingungen bei der Entstehung von Burnout eine wichtige Rolle spielen“ (Rössner-Fischer, 2007, 3). Zu Beginn der 1970er Jahre galten vor allem die sog. Helferberufe als burnoutgefährdet. Inzwischen gibt es in der aktuellen Fachliteratur Beschreibungen über die Entstehung von Burnout in über 30 Berufen. Hier werden Sozialarbeiter, Pfarrer, Ärzte, Pflegepersonal, Sportler, Anwälte, Studenten und sogar Arbeitsuchende erwähnt. (Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes wird nur die kürzere, männliche Schreibweise verwendet. An dieser Stelle wird mit Gültigkeit für die gesamte Arbeit betont, dass dies als Synonym für die männliche und weibliche Form vereinfacht verwendet wurde und alle männlichen und weiblichen Personen gleichberechtigt angesprochen werden.) Mitarbeiter des Rettungsdienstes, die einer hohen emotionalen, psychischen und physischen Belastung ausgesetzt sind, findet man hier nicht. „Neuerdings registrieren Wissenschaftler eine neue Qualität der Burnoutgefahren: Das Syndrom sei in sämtlichen Berufen und Tätigkeiten anzutreffen. Im Arbeitsprozess stünde zunehmend die totale Verausgabung aller menschlichen Ressourcen auf der Tagesordnung und werde die gesamte Persönlichkeit gefordert. Die Arbeitszeit kennt häufig keine Grenzen mehr. Energiereserven bleiben dabei auf der Strecke, oft verbunden mit einer Kette endloser Frustration“ (Rössner-Fischer, 2007, 10).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Burnout
- 2.1 Versuch einer Begriffsbestimmung
- 2.2 Das Schlüsselphänomen Stress
- 2.2.1 Stresstheorie nach Lazarus (1974)
- 2.2.2 Stressoren
- 2.2.3 Vom Stress zum Burnout
- 2.2.4 Weitere psychische Auffälligkeiten und Krankheitsbilder im Vergleich mit dem Burnout
- 2.2.4.1 Psychosoziale Belastungen
- 2.2.4.1.1 Akute Belastungsreaktion
- 2.2.4.1.2 Posttraumatische Belastungsstörung
- 2.2.4.2 Depression
- 2.2.4.3 Vergleich des Burnouts mit anderen Erkrankungen
- 2.2.4.1 Psychosoziale Belastungen
- 3. Der Rettungsdienst
- 3.1 Der Rettungsdienst in Deutschland
- 3.2 Stadt-/ Landrettung
- 3.2.1 Beispiel Landrettung RTK
- 4. Burnout und begünstigende Faktoren im Rettungsdienst
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Fragestellung
- 4.3 Stress im Rettungsdienst
- 4.3.1 Stressoren im Rettungsdienst
- 4.4 Untersuchungsinstrument Literaturrecherche
- 4.5 Untersuchungsinstrument Fallbeispiel/Fallgeschichte
- 4.5.1 Fallgeschichte Fr. E.
- 4.5.2 Interpretation der Fallgeschichte
- 4.6 Untersuchungsinstrument Fragebogen
- 4.6.1 Messung von Burnout
- 4.6.2 Methoden der Untersuchung
- 4.6.3 Fragebogenverteilung und Rücklauf
- 4.6.4 Ergebnisse
- 4.6.5 Diskussion der Ergebnisse
- 4.6.5.1 Soziodemographische Daten:
- 4.6.5.2 Rahmenstrukturen des Arbeitsfeldes:
- 4.6.5.3 Landrettung
- 4.6.5.4 Idealismus
- 4.6.5.5 Anerkennung
- 4.6.5.6 Stress
- 5. Zusammenfassende Diskussion und Bezug zur Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Burnout-Syndrom und dessen begünstigende Faktoren im Rettungsdienst, speziell im ländlichen Raum. Die Studie zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Belastungen von Rettungsassistenten und -sanitätern im Rheingau-Taunus-Kreis zu entwickeln.
- Burnout-Syndrom im Rettungsdienst
- Stressoren im ländlichen Rettungsdienst
- Psychosoziale Belastungen und deren Auswirkungen
- Einfluss von Arbeitsbedingungen auf das Burnout-Risiko
- Analyse von Fallbeispielen und Fragebogenergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Burnout-Syndroms im Rettungsdienst ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie beschreibt den Fokus auf den ländlichen Rettungsdienst und die Bedeutung der Untersuchung für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Wohlbefindens der Beschäftigten.
2. Burnout: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Burnout-Syndroms und beleuchtet das Phänomen Stress als zentralen Faktor. Es werden verschiedene Stresstheorien vorgestellt, darunter die von Lazarus (1974), und verschiedene Stressoren im Kontext von psychosozialen Belastungen analysiert. Der Zusammenhang zwischen Stress, psychischen Erkrankungen wie Depressionen und dem Burnout-Syndrom wird detailliert dargestellt und verglichen. Die Kapitelteile befassen sich mit der Abgrenzung des Burnout-Syndroms zu anderen psychischen Erkrankungen und deren Ähnlichkeiten.
3. Der Rettungsdienst: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Rettungsdienst in Deutschland, mit einem besonderen Fokus auf die Unterschiede zwischen Stadt- und Landrettung. Das Beispiel des Rheingau-Taunus-Kreises (RTK) wird als Fallstudie für die Landrettung herangezogen, um die spezifischen Herausforderungen und Arbeitsbedingungen in dieser Umgebung zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des ländlichen Rettungsdienstes und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Beschäftigten.
4. Burnout und begünstigende Faktoren im Rettungsdienst: Dieses zentrale Kapitel untersucht die konkreten Stressoren und Faktoren, die zum Burnout im Rettungsdienst beitragen. Es werden verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt, darunter eine Literaturrecherche, die Auswertung einer Fallgeschichte und die Durchführung einer Fragebogenstudie. Die Ergebnisse werden analysiert und diskutiert, wobei soziodemografische Daten, Arbeitsbedingungen und Aspekte wie Idealismus und Anerkennung eine wichtige Rolle spielen. Es erfolgt eine eingehende Analyse der gesammelten Daten zur Identifizierung der prägenden Einflussfaktoren auf das Burnout-Risiko.
5. Zusammenfassende Diskussion und Bezug zur Fragestellung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und diskutiert deren Relevanz im Hinblick auf die eingangs formulierte Fragestellung. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse und deren Bedeutung für die Praxis im Rettungsdienst beleuchtet. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorgestellten Literatur und Theorien eingeordnet und es werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich aus der Analyse der Daten ergeben.
Schlüsselwörter
Burnout-Syndrom, Rettungsdienst, Landrettung, Stress, Stressoren, psychosoziale Belastungen, Arbeitsbedingungen, Fragebogenstudie, Fallbeispiel, Rheingau-Taunus-Kreis, Idealismus, Anerkennung, Depression, Posttraumatische Belastungsstörung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Burnout im Rettungsdienst
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Arbeit untersucht das Burnout-Syndrom und seine begünstigenden Faktoren im Rettungsdienst, insbesondere im ländlichen Raum. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Belastungen von Rettungsassistenten und -sanitätern im Rheingau-Taunus-Kreis.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt das Burnout-Syndrom im Rettungsdienst, Stressoren im ländlichen Rettungsdienst, psychosoziale Belastungen und deren Auswirkungen, den Einfluss von Arbeitsbedingungen auf das Burnout-Risiko sowie die Analyse von Fallbeispielen und Fragebogenergebnissen.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Burnout (inkl. Stress und Abgrenzung zu anderen Erkrankungen), Der Rettungsdienst (mit Fokus auf Landrettung), Burnout und begünstigende Faktoren im Rettungsdienst (mit Methodenbeschreibung und Ergebnisdarstellung) und eine zusammenfassende Diskussion mit Bezug zur Fragestellung.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Es wurden verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt: Literaturrecherche, Auswertung einer Fallgeschichte (Fallbeispiel Fr. E.) und eine Fragebogenstudie zur Messung von Burnout. Die Ergebnisse der Fragebogenstudie werden hinsichtlich soziodemografischer Daten, Arbeitsbedingungen, Idealismus, Anerkennung und Stress analysiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Fragebogenstudie und der Fallbeispielanalyse werden im Kapitel 4 detailliert dargestellt und diskutiert. Die Diskussion der Ergebnisse beleuchtet die prägenden Einflussfaktoren auf das Burnout-Risiko im ländlichen Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Relevanz für die Praxis im Rettungsdienst. Es werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich aus der Analyse der Daten ergeben und die Bedeutung der Ergebnisse für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Wohlbefindens der Beschäftigten hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Burnout-Syndrom, Rettungsdienst, Landrettung, Stress, Stressoren, psychosoziale Belastungen, Arbeitsbedingungen, Fragebogenstudie, Fallbeispiel, Rheingau-Taunus-Kreis, Idealismus, Anerkennung, Depression, Posttraumatische Belastungsstörung.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Burnout-Syndrom?
Kapitel 2 der Studie bietet eine umfassende Definition des Burnout-Syndroms und beleuchtet das Phänomen Stress als zentralen Faktor. Verschiedene Stresstheorien und der Vergleich mit anderen psychischen Erkrankungen werden dort detailliert dargestellt.
Wie unterscheidet sich die Studie in Bezug auf den Rettungsdienst?
Die Studie konzentriert sich besonders auf den ländlichen Rettungsdienst und vergleicht ihn mit dem städtischen Rettungsdienst. Der Rheingau-Taunus-Kreis dient als Fallbeispiel für die besonderen Herausforderungen der Landrettung.
Welche Bedeutung hat die Studie für die Praxis?
Die Studie soll ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Belastungen von Rettungsassistenten und -sanitätern im ländlichen Raum schaffen und damit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Wohlbefindens der Beschäftigten beitragen.
- Citation du texte
- Johannes Fuchs (Auteur), 2015, Das Burnout-Syndrom und begünstigende Faktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304140