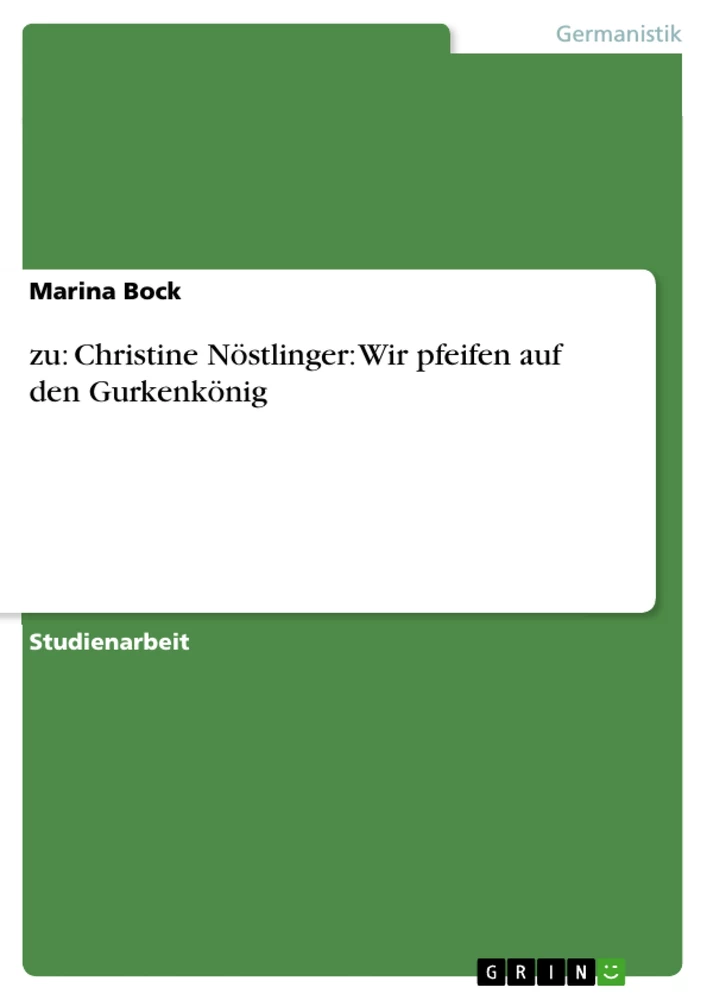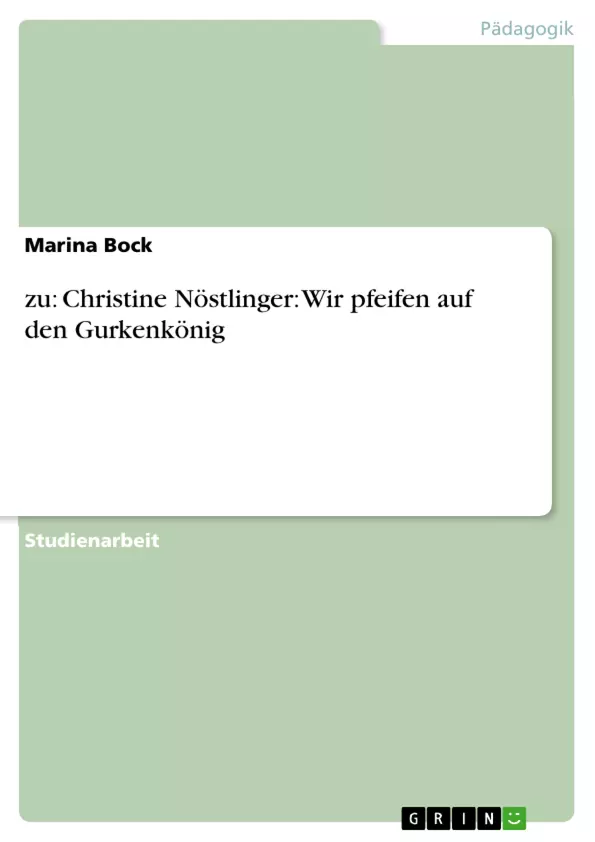Geben sich Kinder wirklich jeder Illusion hin? Wolfgang Hogelmann und seine Schwester Martina stellen dann wohl die Minderheit dar. Sie reagieren sofort kritisch, als sie plötzlich dieses gurkenartige Wesen auf ihrem Küchentisch erblicken. Ganz im Gegensatz zu ihrem Vater. Dieser stellt sich auf die Seite des absolutistischen Kumi – Ori – Königs und damit gegen seine Familie. Aber er hat ja
auch die Illusion, sie seien eine ganz normale, ordentliche Familie...
Christine Nöstlinger setzt ihre Geschichte vom asylsuchenden Gurkenkönig im Zeitalter der antiautoritären Erziehung an – und prangert vor allem die – bei Familie (?) Hogelmann als mitteleuropäische Ottonormalfamilie in den Siebzigern – vorherrschende Familienhierarchie an.
Aber nicht nur durch diese „Spießbürgerfamilie“ lässt sie Gesellschaftskritik anklingen, auch die Kumi – Oris im Keller versuchen gerade, demokratische Strukturen in ihrem Kartoffelstaat einzuführen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Christine Nöstlinger
- Christine Nöstlinger - Kurzbiografie
- Weitere Werke der Autorin
- Wir pfeifen auf den Gurkenkönig
- Inhaltsangabe
- Struktur und sprachliche Form des Kinderromans
- Der Gurkenkönig - ein phantastischer oder märchenhafter Roman?
- Gesellschaftskritik im Gurkenkönig?
- Wir pfeifen auf den Gurkenkönig in seiner Zeit
- Antiautoritäre Erziehung – Begriffserklärung, Forderungen und Ziele
- Strukturelle Veränderungen innerhalb der Institution Familie in den 60er und 70er Jahren
- Der Gurkinger als Indikator? - Aufbruch alter Familienstrukturen bzw. Familienhierarchien
- Die Kumi-Oris in ihrem Kartoffelstaat - die kindgerechte Darstellung von gesellschaftlichen Strukturen
- Die Schule als idealer Ort, Autorität auszunutzen
- Wir pfeifen auf den Gurkenkönig in seiner Zeit
- Der Gurkenkönig – ein Buch für den Unterricht?
- Schluss
- Quellennachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Christine Nöstlingers Kinderbuch „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ und untersucht dessen Relevanz im Kontext der antiautoritären Erziehung und Gesellschaftskritik der 1970er Jahre. Die Autorin zeigt anhand der Familie Hogelmann, einer prototypischen „Bilderbuchfamilie“ des damaligen Zeitalters, wie gesellschaftliche Normen und Hierarchien in Frage gestellt werden.
- Die Problematik von Autorität und Emanzipation
- Die Rolle der Familie im Wandel der Zeit
- Die Darstellung von Machtstrukturen in Kinderliteratur
- Die Bedeutung des Buches für den Unterricht
- Die Kritik an gesellschaftlichen Normen und Konventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Ausgangspunkt der Analyse dar. In Kapitel 3 wird die Autorin Christine Nöstlinger und ihr Werk vorgestellt. Dabei wird insbesondere auf ihre Kurzbiografie und ihre weiteren Werke eingegangen. Kapitel 4 widmet sich dem Kinderbuch „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ und beleuchtet dessen Inhalt, Struktur und sprachliche Form. Der folgende Abschnitt (Kapitel 5) beschäftigt sich mit der Gesellschaftskritik, die Nöstlinger in ihrem Buch integriert, und untersucht die Darstellung von Familienstrukturen und Machtverhältnissen im Kontext der antiautoritären Erziehung. Kapitel 6 analysiert die Eignung des Buches für den Unterricht und gibt konkrete Unterrichtsvorschläge. Den Abschluss der Arbeit bildet der Schluss, der die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Analyse des Buches „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ konzentriert sich auf die Themenfelder antiautoritäre Erziehung, Familienstrukturen, Machtverhältnisse, Gesellschaftskritik, Kinderliteratur und Unterrichtsrelevanz. Insbesondere die kindgerechte Darstellung von komplexen sozialen Strukturen und die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Konventionen stehen im Fokus der Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig"?
Das Buch von Christine Nöstlinger handelt von einem seltsamen Gurkenwesen, das plötzlich in einer Familie auftaucht und die hierarchischen Strukturen der Familie durcheinanderbringt.
Welche Rolle spielt die antiautoritäre Erziehung in dem Buch?
Die Geschichte entstand in den 1970er Jahren und prangert starre Familienhierarchien an, während sie gleichzeitig demokratische Werte und Emanzipation thematisiert.
Wer sind die Kumi-Oris?
Die Kumi-Oris sind Wesen aus dem Keller, die einen "Kartoffelstaat" bewohnen und versuchen, demokratische Strukturen einzuführen – eine kindgerechte Parabel auf gesellschaftliche Prozesse.
Warum ist das Buch für den Unterricht geeignet?
Es bietet eine ideale Grundlage, um Themen wie Autorität, Machtmissbrauch (auch in der Schule) und familiäre Konflikte mit Kindern kritisch zu diskutieren.
Was kritisiert Christine Nöstlinger besonders?
Sie kritisiert die "Spießbürgerfamilie" der 70er Jahre und zeigt auf, wie der Vater durch seine Allianz mit dem autoritären König gegen die eigene Familie handelt.
- Arbeit zitieren
- Marina Bock (Autor:in), 2002, zu: Christine Nöstlinger: Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3042