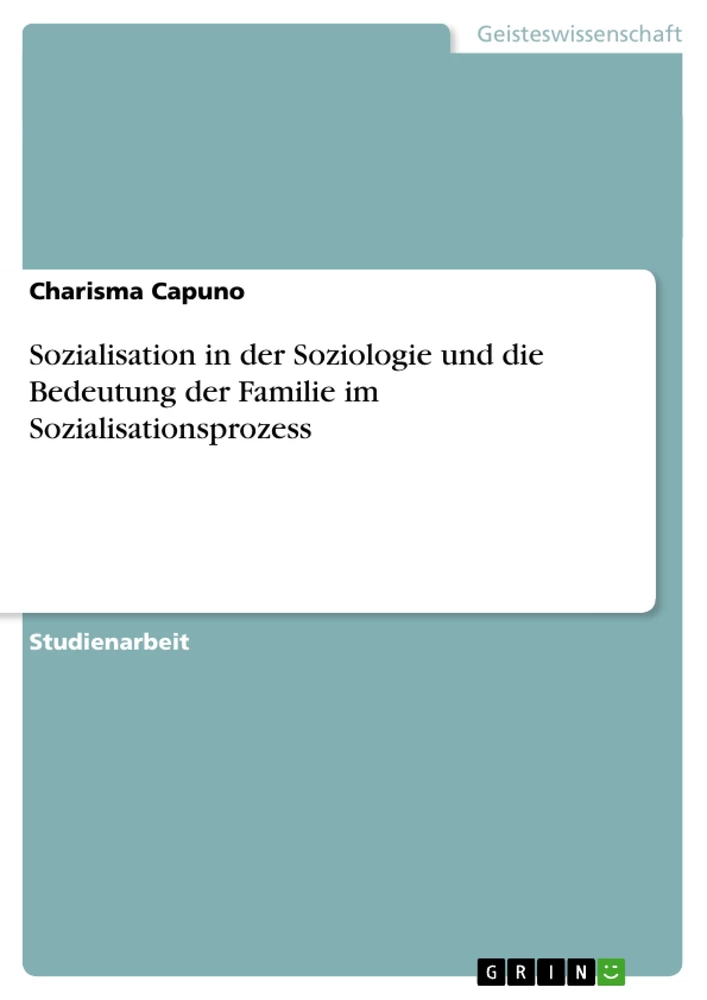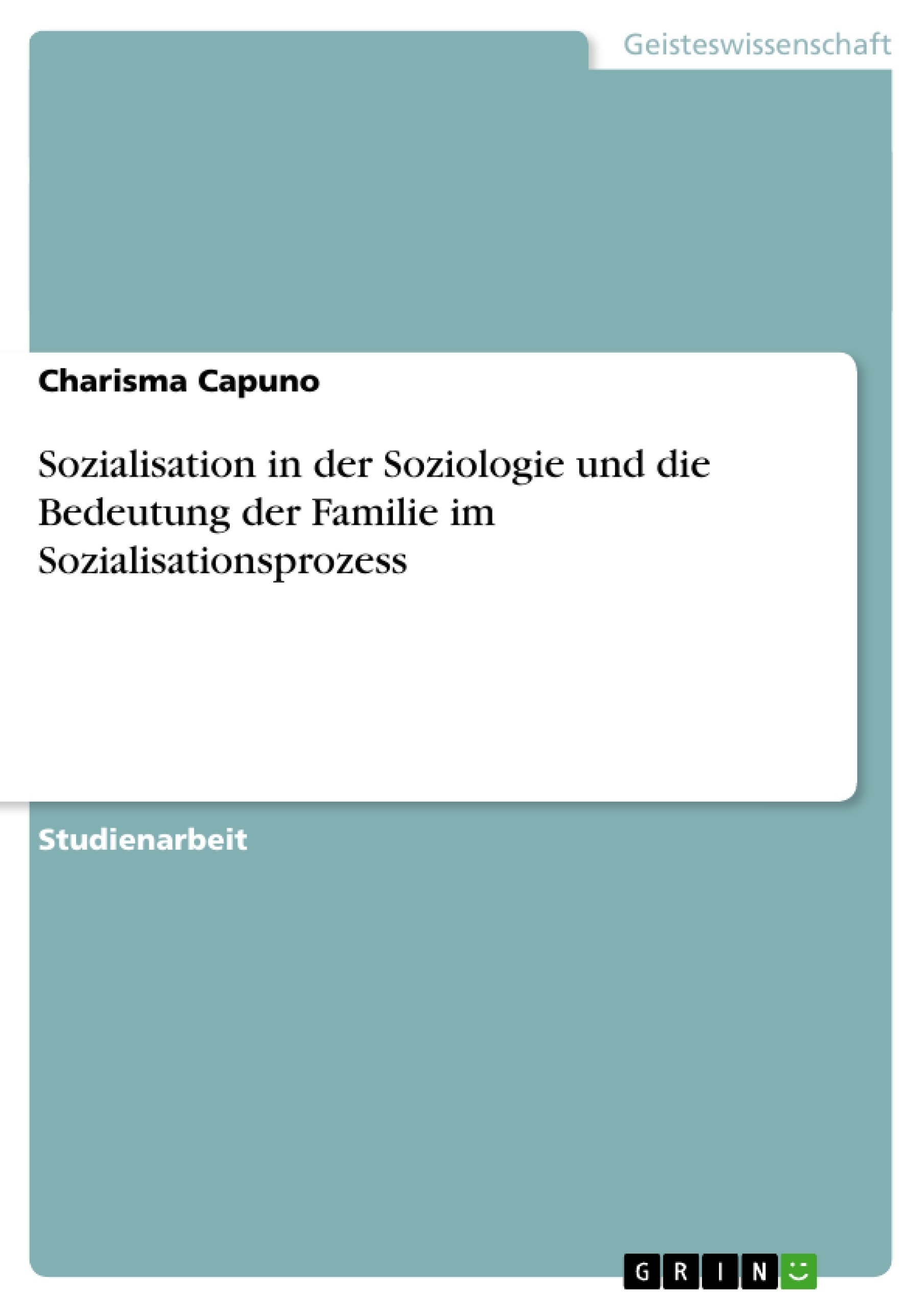Man sagt, die vorindustrielle Familie war überwiegend eine Drei-Generationen-Familie. In der Realität war diese jedoch selten, z. B. aufgrund der geringen Lebenserwartung oder der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit. Wie sieht die Realität in unserer Gegenwart aus? Ist es tatsächlich das Zeitalter der bürgerlichen Kleinfamilie? Oder gilt diese Familienform schon für überholt? Tatsache ist doch, daß Scheidungen, häufige Wiederverheiratungen, neue Arten von Liebesbeziehungen, die Zusammensetzung der Geschwistergruppen aus „meinen, deinen, unseren Kindern“ u.v.m. den Familienbegriff längst verändert haben. Jeder von uns hat sicherlich zumindest schon mal im Verwandten- und/oder Freundeskreis eine Partnertrennung unmittelbar miterlebt. Aber wie wirkt sich dieser Wandel der Familienstrukturen auf die Sozialisation der Kinder und Jugendlichen aus – zumal die Familie als die primäre Sozialisationsinstanz gilt? „Die wichtigsten Institutionen der Sozialisation in unserer Gesellschaft sind die Familie und die Schule“. Dieser Satz ist häufig zu finden, sobald es um die Erklärung von ‚Sozialisation‘ geht. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung ‚Einführung in die Soziologie‘ möchte ich in dieser Arbeit Antworten auf diese Fragen finden mit Berücksichtigung der familialen Strukturveränderungen. Diese werden oft gar nicht oder nur wenig in Betracht mit einbezogen, obwohl ihre Folgen für die Erziehung und Bildung der Heranwachsenden von großer Bedeutung sind. Es wird meist von einem Idealbild der Familie ausgegangen: Eine soziale Lebensform, die (eigentlich) gekennzeichnet ist durch eine rechtlich gesicherte Lebensgemeinschaft eines Ehepaares mit seinen eigenen (unmündigen) Kindern im eigenen privaten Haushalt. Dem füge ich noch ein weiteres Kapitel hinzu, indem ich das Problem homosexueller Eltern und ihre Art der Sozialisation thematisiere. Doch zunächst die Klärung des Sozialisationsbegriffs als Grundlage zur Darstellung der Problematik des familialen Strukturwandels und die meist unbewußten Folgen dieses Problems.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung
- 2.1. Was ist Sozialisation überhaupt?
- 2.2. Ein allgemeiner Überblick
- 3. Die primäre Sozialisationsinstanz: Die Familie
- 3.1. Die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozeß
- 3.1.1. Vergleich: Heimkinder - Familienkinder
- 3.1.2. Veränderungen im Eltern-Kind-Verhältnis
- 3.2. Der Wandel der Familienstruktur und die Folgen für die Sozialisation des Kindes
- 3.2.1. Veränderungen in den Erziehungszielen und im Erziehungsverhalten durch den Wandel der Familienstrukturen und ihre Folgen
- 3.2.2. Auswirkungen der (fehlenden) Geschwistergemeinschaft auf den Sozialisationsprozeß der Kinder
- 3.2.3. Gleichgeschlechtliche Eltern. Eine neue Form der Familie?
- 4. Schluß
- 5. Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Wandels der Familienstrukturen auf den Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus steht die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz und wie Veränderungen in der Familienstruktur, wie z.B. Scheidungen, Patchwork-Familien und gleichgeschlechtliche Eltern, die Sozialisation beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet sowohl positive als auch negative Auswirkungen dieser Entwicklungen.
- Die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Der Wandel der Familienstrukturen (z.B. Scheidungen, Patchwork-Familien)
- Auswirkungen des Familienwandels auf die Erziehung und Bildung von Kindern
- Der Einfluss verschiedener Sozialisationsfaktoren auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Die Rolle gleichgeschlechtlicher Eltern im Sozialisationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Wandels der Familienstrukturen auf die Sozialisation von Kindern in den Mittelpunkt. Sie verweist auf die traditionelle Vorstellung der bürgerlichen Kleinfamilie und kontrastiert diese mit der Realität von Scheidungen, Patchwork-Familien und anderen modernen Familienformen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Sozialisation zu untersuchen.
2. Einführung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Sozialisation als lebenslangen Prozess des Hineinwachsens in die Gesellschaft und das Erlernen von Verhaltensmustern. Es unterscheidet zwischen primärer Sozialisation in der Familie und sekundärer Sozialisation durch andere Institutionen wie Schule und Medien. Der Abschnitt betont die Unverzichtbarkeit der primären Sozialisation und diskutiert den Einfluss verschiedener Sozialisationsfaktoren, einschließlich abweichenden Verhaltens und Resozialisation. Es wird auch auf die theoretischen Ansätze der schichtenspezifischen, sozialstrukturellen und sozialökologischen Sozialisationsforschung sowie der strukturell-funktionalen Theorie und des Symbolischen Interaktionismus eingegangen, um ein umfassendes Verständnis von Sozialisationsprozessen zu schaffen.
3. Die primäre Sozialisationsinstanz: Die Familie: Dieses Kapitel analysiert die Familie als primäre Sozialisationsinstanz und beleuchtet deren Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Es untersucht den Wandel der Familienstrukturen und deren Auswirkungen auf die Sozialisation. Veränderungen in Erziehungszielen und -verhalten, die Folgen fehlender Geschwisterbeziehungen und die Rolle gleichgeschlechtlicher Eltern werden detailliert betrachtet. Der Vergleich von Heim- und Familienkinder verdeutlicht die zentrale Bedeutung des familiären Umfelds für die Entwicklung des Kindes. Die Zusammenfassung der Unterkapitel zeigt, dass die zunehmende Vielfalt an Familienformen neue Herausforderungen für die Sozialisation mit sich bringt, aber nicht zwangsläufig negative Folgen bedeutet.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Familie, Familienwandel, Erziehungsziele, Sozialisationsinstanzen, primäre Sozialisation, sekundäre Sozialisation, Persönlichkeitsentwicklung, Gleichgeschlechtliche Eltern, Schichtenspezifische Sozialisationsforschung, Symbolischer Interaktionismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Einfluss des Wandels der Familienstrukturen auf die Sozialisation von Kindern"
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht den Einfluss des Wandels der Familienstrukturen auf den Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz und wie Veränderungen wie Scheidungen, Patchwork-Familien und gleichgeschlechtliche Elternteile die Sozialisation beeinflussen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz, den Wandel der Familienstrukturen (Scheidungen, Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Eltern), die Auswirkungen des Familienwandels auf die Erziehung und Bildung von Kindern, den Einfluss verschiedener Sozialisationsfaktoren auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Rolle gleichgeschlechtlicher Eltern im Sozialisationsprozess.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, eine Einführung in den Begriff der Sozialisation, ein Kapitel über die Familie als primäre Sozialisationsinstanz mit detaillierten Unterkapiteln zu Veränderungen in der Familienstruktur und deren Auswirkungen, und abschließend einen Schluss und eine Quellenangabe. Es gibt auch eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird unter dem Begriff "Sozialisation" verstanden?
Der Text definiert Sozialisation als einen lebenslangen Prozess des Hineinwachsens in die Gesellschaft und das Erlernen von Verhaltensmustern. Es wird zwischen primärer Sozialisation (in der Familie) und sekundärer Sozialisation (durch Schule, Medien etc.) unterschieden.
Welche Rolle spielt die Familie im Sozialisationsprozess?
Die Familie wird als primäre Sozialisationsinstanz betrachtet, die eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Kindes spielt. Der Text untersucht, wie Veränderungen in der Familienstruktur (z.B. Scheidungen, Patchwork-Familien) die Sozialisation beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ.
Wie werden Veränderungen in der Familienstruktur behandelt?
Der Text analysiert verschiedene Veränderungen in der Familienstruktur, darunter Scheidungen, Patchwork-Familien und gleichgeschlechtliche Elternteile. Es werden die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Erziehungsziele, das Erziehungsverhalten und die Geschwisterbeziehungen untersucht.
Wie wird der Vergleich von Heim- und Familienkinder behandelt?
Der Vergleich von Heim- und Familienkinder dient dazu, die zentrale Bedeutung des familiären Umfelds für die Entwicklung des Kindes zu verdeutlichen und den Einfluss der primären Sozialisationsinstanz hervorzuheben.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Der Text erwähnt verschiedene theoretische Ansätze der Sozialisationsforschung, darunter die schichtenspezifische, sozialstrukturelle und sozialökologische Sozialisationsforschung, die strukturell-funktionale Theorie und der Symbolische Interaktionismus, um ein umfassendes Verständnis von Sozialisationsprozessen zu schaffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Sozialisation, Familie, Familienwandel, Erziehungsziele, Sozialisationsinstanzen, primäre Sozialisation, sekundäre Sozialisation, Persönlichkeitsentwicklung, gleichgeschlechtliche Eltern, Schichtenspezifische Sozialisationsforschung, Symbolischer Interaktionismus.
- Citar trabajo
- Charisma Capuno (Autor), 2002, Sozialisation in der Soziologie und die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30440