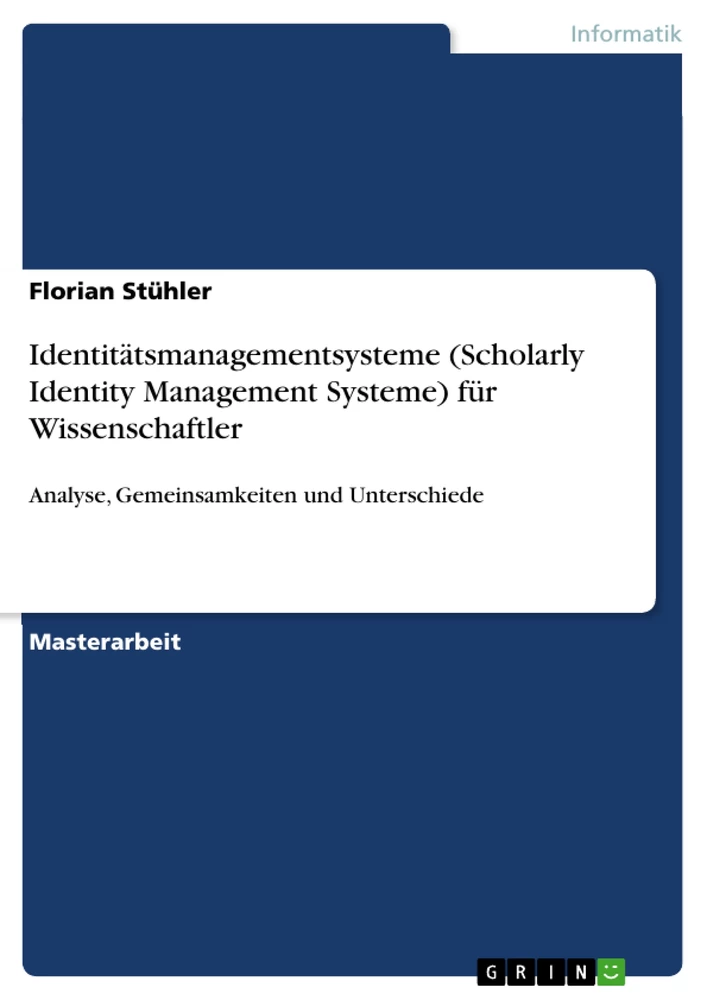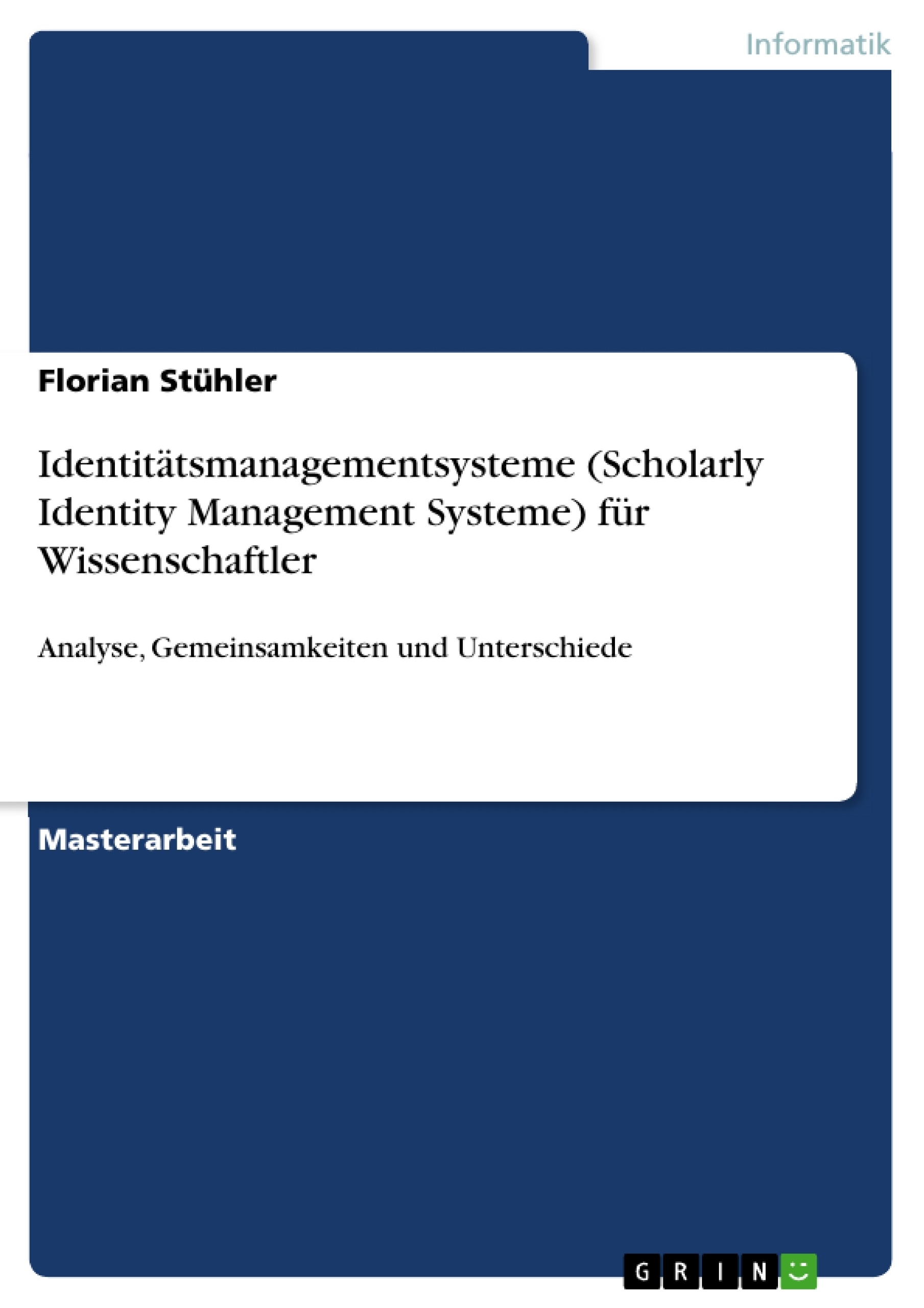Die Informatik hat die Gesellschaft durch die Entwicklung des Internets, die als eine der wichtigsten technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte betrachtet werden kann, erheblich verändert. Ausschlaggebend für den Erfolg und die schnelle Verbreitung des Internets war dabei in erster Linie das World Wide Web (WWW). Das World Wide Web ist ursprünglich entstanden, um einen Informationsaustausch zwischen verteilt arbeitenden Forschern zur verbessern und zu erleichtern. Dazu wurden verteilt vorliegende Informationen zu einem Ganzen (Hypertext) verknüpft. Durch diese grundlegende Idee erfolgte die substanzielle Prägung der Informationsgewinnung in der heutigen Informationsgesellschaft. Durch das Internet ist es einfacher als jemals zuvor, schnell und problemlos neueste Informationen zu erhalten. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen diverse Aspekte ihres Lebens zum Teil in die virtuellen und vernetzten Welten des Internets verlagern. „In Netzwelten wird gekauft und verkauft, ein großes Spektrum an Themen diskutiert, Wissen mit anderen geteilt und erworben, miteinander gespielt und vieles mehr. Das gilt sowohl für berufliche als auch private Belange.“ Auch für Forscher spielen die Möglichkeiten des World Wide Web heute eine immer größere Rolle. So verwenden Forscher, wie andere Internetnutzer auch, soziale Netzwerke, wie Facebook oder LinkedIn, um beispielsweise Kooperationspartner zu finden, sich und ihre Forschung zu präsentieren oder mit anderen Forschern zusammenzuarbeiten. Für Recherchen müssen keine Bibliotheken mehr aufgesucht werden, stattdessen können wissenschaftliche Suchmaschinen im Internet genutzt werden.
Mittlerweile existieren diverse, direkt an Forscher gerichtete Netzwerke, wie ResearchGate oder Academia. Das Spektrum derartiger Services umfasst sowohl kommerzielle als auch öffentlich geförderte Plattformen. Derartige Angebote bieten neue, innovative Ansätze für das Betreiben von Forschung. Sie ermöglichen es Forschern, institutionelle, geografische, kulturelle und disziplinäre Grenzen zu überwinden. Unabhängig davon, welchen Dienst oder welches Netzwerk Forscher nutzen wollen, müssen sie allerdings zunächst eine digitale Identität (auch Account) anlegen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Abgrenzung der Arbeit
- Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Soziale Netzwerke
- Abgrenzung des Forscher- bzw. Wissenschaftlerbegriffs
- Scholarly Identity Management
- Begriff
- Gründe für ein Scholarly Identy Management
- (Forscher)profile
- Ausgewählte (informationstechnische) Grundlagen zum Identitätsmanagement
- Arten von Identitäten
- Technische Anforderungen an ein Identitätsmanagement-System
- Aufbau/Bestandteile von IDM
- Föderatives Identitätsmanagement
- Aktuelle Problemfelder und Herausforderungen des Scholarly Identity Management
- Bewertung von Profildatenbanken anhand ausgewählter Kriterien
- Grundzüge der Erstellung von Kriterienkatalogen
- Konzeption eines Kriterienkatalogs für die Bewertung von Profildatenbanken
- Untersuchung ausgewählter Profildatenbanken anhand der entwickelten Kriterien
- RePEc Author Services (RAS)
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- Nature Network
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- VIAF/GND
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- ResearchGate
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- Mendeley
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- ORCID
- Kurzbeschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse
- Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse: Vergleich, Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Charakteristika der Systeme
- Funktionsweise der Systeme
- Umgang mit Problemen
- Erfüllung der Nutzeranforderungen
- Gestaltungsempfehlungen zum Scholarly Identity Management
- Empfehlungen im Hinblick auf allgemeine Systemcharakteristika
- Empfehlungen im Hinblick auf die Funktionsweise der Systeme
- Empfehlungen zum Umgang mit Problemfeldern
- Empfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung der Zielgruppenanforderungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Scholarly Identity Management. Sie analysiert verschiedene Systeme, die zur Verwaltung der wissenschaftlichen Identität von Forschern und Wissenschaftlerinnen dienen. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Systeme zu beleuchten und Gestaltungsempfehlungen für die Entwicklung von zukünftigen Scholarly Identity Management Systemen zu erarbeiten.
- Analyse verschiedener Scholarly Identity Management Systeme
- Bewertung der Systeme anhand eines Kriterienkatalogs
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Systemen
- Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen für die Verbesserung von Scholarly Identity Management Systemen
- Beitrag zur Diskussion über die optimale Gestaltung von Scholarly Identity Management Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar. Es wird erläutert, warum ein Scholarly Identity Management für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Bedeutung ist und welche Herausforderungen sich in diesem Bereich stellen. Des Weiteren wird die Vorgehensweise und der Aufbau der Arbeit beschrieben.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Scholarly Identity Management erörtert. Dazu gehören Definitionen von Begriffen wie „soziales Netzwerk", „Forscher" und „Wissenschaftler". Es werden die Gründe für ein Scholarly Identity Management sowie die Bedeutung von (Forscher)profilen im Kontext der wissenschaftlichen Arbeit beleuchtet. Zudem werden grundlegende Konzepte des Identitätsmanagements, wie Arten von Identitäten, technische Anforderungen und Aufbau von IDM-Systemen, vorgestellt. Abschließend werden aktuelle Problemfelder und Herausforderungen des Scholarly Identity Management diskutiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Profildatenbanken anhand ausgewählter Kriterien. Es wird ein Kriterienkatalog entwickelt, der zur Bewertung verschiedener Profildatenbanken genutzt wird. Anschließend werden sechs ausgewählte Systeme – RePEc Author Services (RAS), Nature Network, VIAF/GND, ResearchGate, Mendeley und ORCID – anhand des entwickelten Kriterienkatalogs untersucht. Die Ergebnisse der Analyse werden zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Charakteristika, Funktionsweise, ihres Umgangs mit Problemen und ihrer Erfüllung der Nutzeranforderungen verglichen.
Im vierten Kapitel werden Gestaltungsempfehlungen für die Entwicklung von Scholarly Identity Management Systemen abgeleitet. Es werden Empfehlungen im Hinblick auf allgemeine Systemcharakteristika, die Funktionsweise der Systeme, den Umgang mit Problemfeldern und die Verbesserung der Unterstützung der Zielgruppenanforderungen erarbeitet.
Schlüsselwörter
Scholarly Identity Management, wissenschaftliche Identität, Profildatenbanken, Kriterienkatalog, Bewertung, RePEc Author Services (RAS), Nature Network, VIAF/GND, ResearchGate, Mendeley, ORCID, Gestaltungsempfehlungen, Forschungsdatenmanagement, Open Science.
- Citar trabajo
- Florian Stühler (Autor), 2013, Identitätsmanagementsysteme (Scholarly Identity Management Systeme) für Wissenschaftler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304611