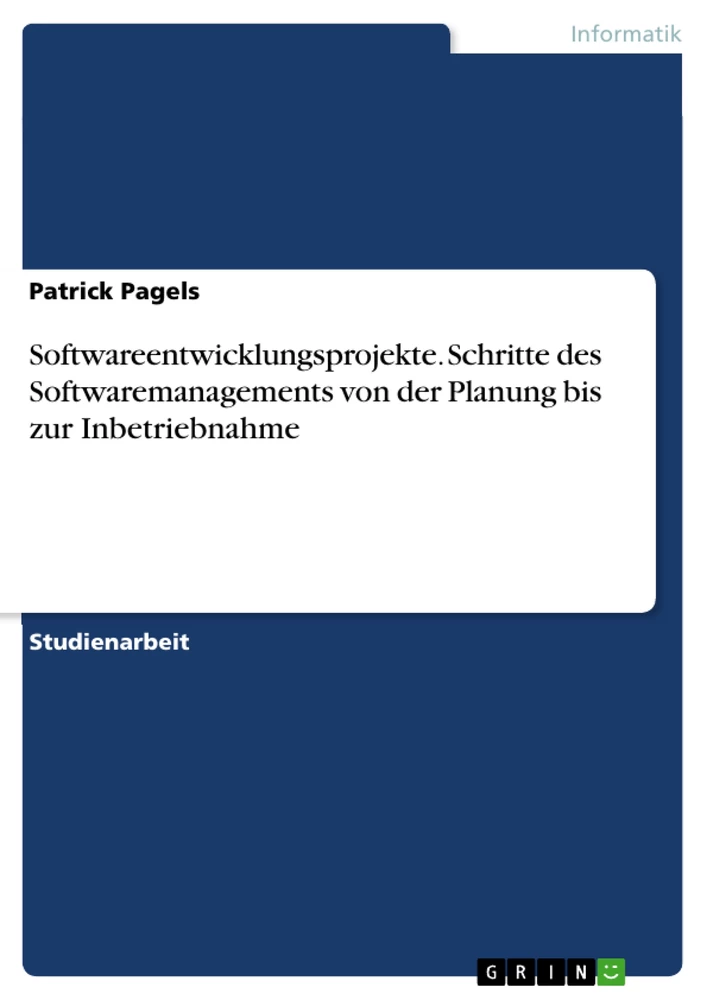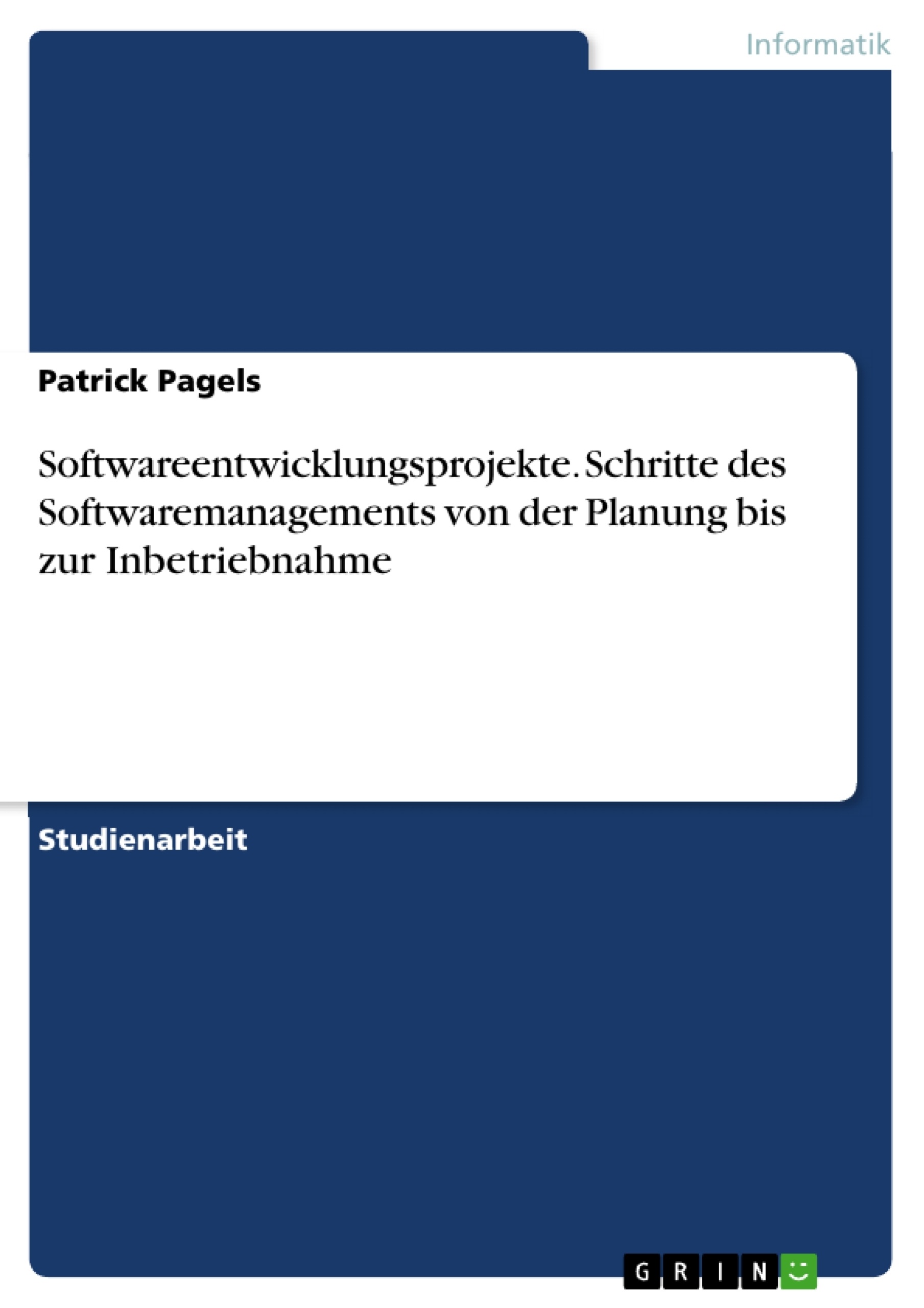Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte eines Softwaremanagements erläutert werden. Dazu werden die verschiedenen Phasen von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme beschrieben. Auf Grund der begrenzten Länge des Assignments wird insbesondere der fachliche bzw. formelle Teil des Softwaremanagements beschrieben, nicht personelle oder organisatorische Aspekte. Ziel ist es, dem Leser einen Eindruck über die einzelnen Phasen des Softwaremanagements zu geben.
Das Softwaremanagement beschäftigt sich insbesondere mit der theoretischen Seite eines Softwareentwicklungsprojekts. Dazu zählen Aufgaben wie die Planung, Zielsetzungen, Steuerung und Kontrolle des konkreten Projekts. Softwaremanagement ist speziell bei größeren Entwicklungsprojekten unabdingbar. Erfolgreiche Projekte benötigen ein ebenso erfolgreiches Softwaremanagement.
Eine Forsa Studie kam zu dem Ergebnis, dass 59% aller Softwareprojekte das geplante Budget überschreiten, 46% die geplanten Termine um durchschnittlich sieben Monate überschreiten und die Fluktuationsrate der Projektleiter bei 68% liegt. Dieser Zustand kann durch ein ganzheitliches, gutes Softwaremanagement verbessert werden.
Aufbau der Arbeit:
Die Aufgabenstellung lautet: „Ausgehend von den im Modul erlernten Techniken sind für unterschiedliche aktuelle Softwareentwicklungsprojekte ein vereinfachtes Projektmanagement zu entwickeln und durchzuführen.
Die Arbeit sollte dabei folgende Schritte umfassen: Planung, Lastenheft, Projektplan, Kalkulation und Aufwandsabschätzung, Ist-Analyse, Soll-Konzept, Modellierung der Anforderungen, Entwurfsphase, Realisierungsphase, Test, Inbetriebnahme“. Nach telefonischer Rücksprache wurde entschieden, keine konkreten Beispiele zu beschreiben, sondern die einzelnen, in der Aufgabenstellung aufgezählten, Phasen zu erläutern.
Aufbau der Arbeit:
Das Assignment beschreibt alle in der Aufgabenstellung vorgegebenen Schritte des Softwaremanagements in der Reihenfolge wie sie in der Regel auch in einem konkreten Projekt durchgeführt werden.
Zum Schluss wird noch ein kurzes Fazit über die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines guten Softwaremanagements anhand eines eigenen Beispiels gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgabenstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Softwaremanagement
- Planungsphase
- Lastenheft
- Projektplan
- Kalkulation und Aufwandsabschätzung
- Analysephase
- Ist-Analyse
- Soll-Konzept
- Modellierung der Anforderungen
- Entwurfsphase
- Realisierungsphase
- Test
- Inbetriebnahme
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Assignment befasst sich mit den einzelnen Schritten eines Softwaremanagements und beleuchtet die verschiedenen Phasen von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme. Der Fokus liegt dabei auf dem fachlichen und formellen Teil des Softwaremanagements, nicht auf personellen oder organisatorischen Aspekten. Ziel ist es, dem Leser einen Überblick über die einzelnen Phasen des Softwaremanagements zu geben.
- Die Bedeutung der Projektplanung für den Erfolg von Softwareprojekten
- Die verschiedenen Phasen des Softwaremanagements und ihre Aufgaben
- Die Erstellung von wichtigen Dokumenten wie Lastenheft, Projektplan und Modellierung der Anforderungen
- Die Herausforderungen und Risiken bei der Entwicklung von Softwareprojekten
- Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Softwaremanagements für die Verbesserung der Projektperformance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Aufgabenstellung, die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Im Kapitel „Softwaremanagement“ werden die einzelnen Phasen des Softwaremanagements detailliert beschrieben. Dazu gehören die Planungsphase mit den Unterpunkten Lastenheft, Projektplan und Kalkulation und Aufwandsabschätzung, die Analysephase mit den Unterpunkten Ist-Analyse, Soll-Konzept und Modellierung der Anforderungen, die Entwurfsphase, die Realisierungsphase, der Test und die Inbetriebnahme. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Punkte des Assignments zusammen.
Schlüsselwörter
Softwaremanagement, Projektplanung, Lastenheft, Projektplan, Kalkulation, Aufwandsabschätzung, Ist-Analyse, Soll-Konzept, Modellierung, Entwurf, Realisierung, Test, Inbetriebnahme, Softwareentwicklungsprojekt, Softwareentwicklung, Projektmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Aufgaben des Softwaremanagements?
Dazu zählen die Planung, Zielsetzung, Steuerung und Kontrolle eines Softwareentwicklungsprojekts, insbesondere bei größeren Vorhaben.
Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?
Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen des Auftraggebers (Was?), während das hier im Rahmen der Planung erwähnte Soll-Konzept die technische Umsetzung (Wie?) vorbereitet.
Warum scheitern viele Softwareprojekte?
Laut Studien überschreiten 59 % das Budget und 46 % die Termine; ein mangelhaftes Softwaremanagement und fehlende Aufwandsschätzungen sind oft die Ursachen.
Welche Phasen durchläuft ein Projekt bis zur Inbetriebnahme?
Die Phasen umfassen Planung, Analyse (Ist/Soll), Modellierung, Entwurf, Realisierung, Test und schließlich die Inbetriebnahme.
Was geschieht in der Analysephase?
In dieser Phase werden der Ist-Zustand analysiert, das Soll-Konzept erstellt und die fachlichen Anforderungen für die spätere Modellierung präzisiert.
- Citar trabajo
- Patrick Pagels (Autor), 2015, Softwareentwicklungsprojekte. Schritte des Softwaremanagements von der Planung bis zur Inbetriebnahme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304624