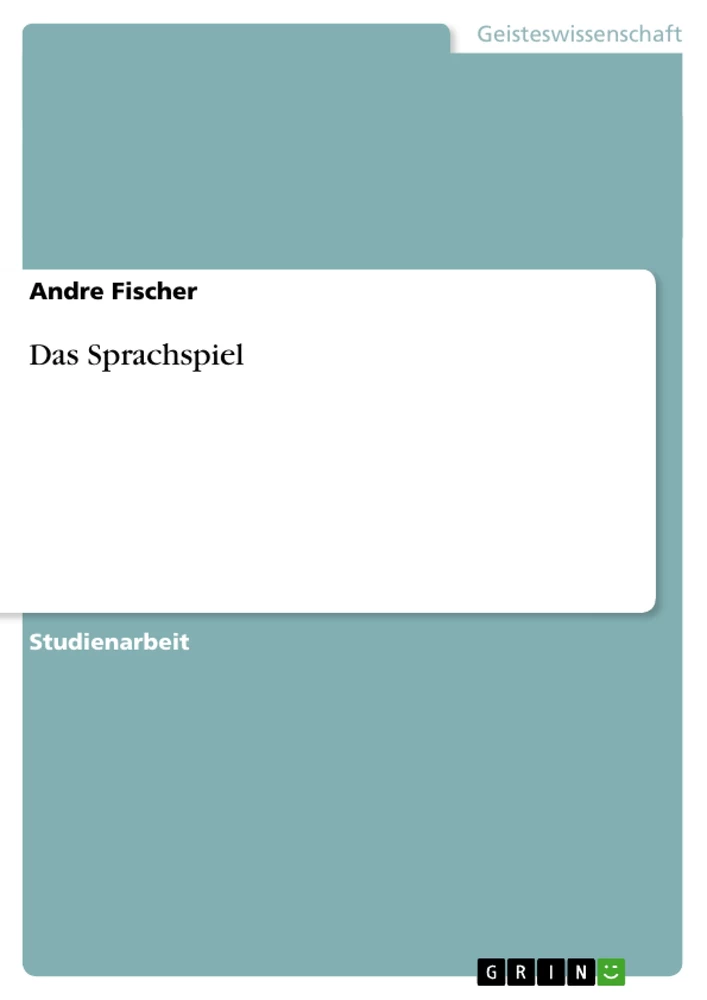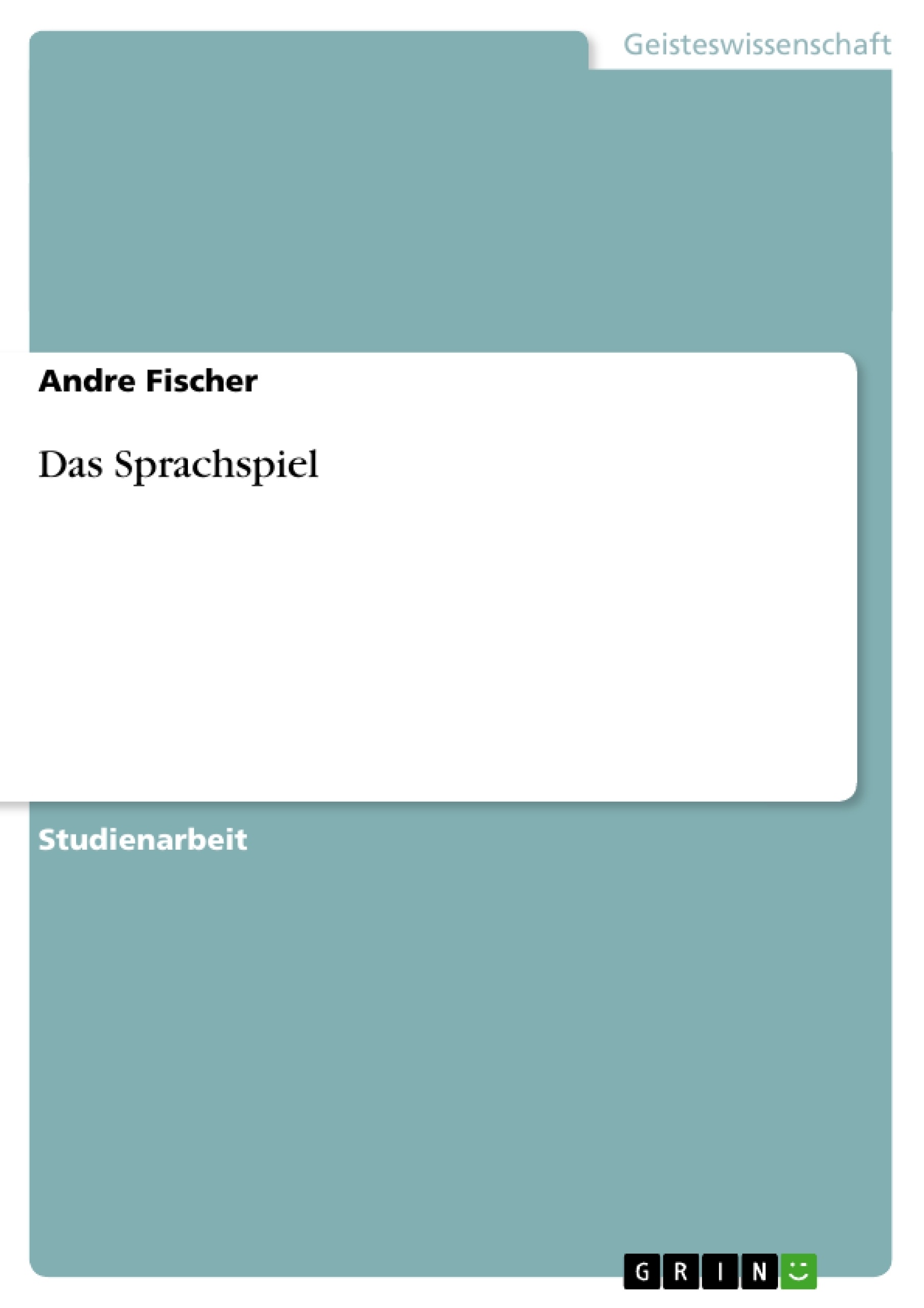„Wittgenstein hat in der Philosophie einen neuen Anfang gewagt.“1 Er hat seinen bohrenden
Scharfblick von den systematischen Denkgebäuden, in denen die Philosophen seit jeher versuchten
die Welt zu erfassen, abgelenkt und sich wie kein anderer Philosoph vor ihm dem
menschlichen Sprachgebrauch zugewandt, wodurch er der Sprachphilosophie als philosophischer
Fundamentaldisziplin des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch verhalf. Die formale Logik,
von Frege und Russell entwickelt, schien Wittgenstein in seinem Frühwerk die neue und geeignete
Methode zu sein, um Ordnung in die philosophischen Verwirrungen seiner Zeit zu
bringen. Die Ursache der philosophischen Probleme lag für Wittgenstein im falschen
Gebrauch unserer Sprache, „er hatte den Verdacht, dass viele Probleme der Philosophie im
Grunde Verknotungen des Denkens seien, Selbstfesselungen, Verschlingungen und gordische
Knoten der Sprache, nicht aber der Welt“2. In seinem einzigen zu Lebzeiten veröffentlichten
philosophischen Werk, dem Tractatus logico-philosohicus, untersucht und beschreibt Wittgenstein,
wie „Sprache und Wirklichkeit ineinandergreifen“3 und versucht eine Zeichensprache
zu entwerfen, die durch ihre Klarheit alle philosophischen Probleme beseitigen sollte.
Von diesem Vorhaben distanziert sich Wittgenstein jedoch in seinem Spätwerk und stellt nun
die Alltagssprache in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Sein 1953 posthum veröffentlichtes
Hauptwerk trägt den Namen Philosophische Untersuchungen. In ihm führt Wittgenstein
den Begriff des „Sprachspiels“ ein, der fortan sein gesamtes Denken prägt. Ich möchte in der folgenden Arbeit darstellen, was unter diesem Begriff zu verstehen ist und welche Wichtigkeit Wittgenstein diesem beimisst. Dazu ist es unerlässlich einen Überblick
über Wittgensteins Vorstellungen von sprachlicher Bedeutung zu geben. Ich werde dies in
Abgrenzung zur repräsentativen Zeichentheorie tun. Zum Schluss meiner Arbeit möchte ich
beschreiben, wie Wittgensteins sprachphilosophische Einsichten seinen Blick auf die Philosophie
beeinflussten. 1 Vossenkuhl, Wilhelm: Ludwig Wittgenstein, 2. Aufl., München 2003, S. 11. 2 Lem, Stanislaw: Also sprach GOLEM, Frankfurt am Main 1986, S.80. 3 Lutz, Bernd (Hg.): Metzler-Philosophen-Lexikon, 2.Aufl., Stuttgart 1995.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Das Sprachspiel“ - Allgemeine Begriffsbestimmung
- Bedeutung von Wörtern und Sätzen im Sprachspiel
- Die traditionelle Bedeutungstheorie
- Das „hinweisende Lehren“
- Wittgensteins Kritik an der traditionellen Bedeutungstheorie
- Wittgensteins Auffassung von sprachlicher Bedeutung
- Sprache als Lebensform
- Schluss: Philosophische Konsequenzen aus Wittgensteins Sprachspieldenken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, Wittgensteins Konzept des „Sprachspiels“ in seinen Philosophischen Untersuchungen darzustellen und dessen Bedeutung für sein gesamtes Spätwerk zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Wittgensteins Gedanken über die sprachliche Bedeutung im Kontext seiner Kritik an der traditionellen Bedeutungstheorie und zeigt, wie sich diese Einsichten auf seinen Blick auf die Philosophie selbst auswirken.
- Das „Sprachspiel“ als zentrales Konzept in Wittgensteins Spätwerk
- Kritik an der traditionellen Bedeutungstheorie und die Entwicklung einer neuen Auffassung von sprachlicher Bedeutung
- Die Rolle der Alltagssprache in Wittgensteins Philosophie
- Die philosophischen Konsequenzen aus Wittgensteins Sprachspieldenken
- Die Bedeutung des Sprachspielbegriffs für das Verständnis der menschlichen Lebensform
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die philosophische Relevanz von Wittgensteins Werk ein und beleuchtet dessen Abkehr von systematischen Denkgebäuden hin zu einer Analyse des menschlichen Sprachgebrauchs. Sie stellt die Bedeutung des Tractatus logico-philosohicus und der Philosophischen Untersuchungen für Wittgensteins Entwicklung dar und skizziert den Inhalt der vorliegenden Arbeit.
,,Das Sprachspiel“ - Allgemeine Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel erklärt den zentralen Begriff des „Sprachspiels“ in Wittgensteins Spätwerk. Unter Verwendung der Analogie des Spielbegriffs wird gezeigt, dass es keine allgemeingültige Definition für Sprache gibt, sondern vielmehr eine Vielzahl von „Familienähnlichkeiten“ zwischen verschiedenen Sprachspielen. Das Kapitel verdeutlicht Wittgensteins Ansatz, die Sprache als ein flexibles und offenes System zu betrachten, dessen Regeln nicht starr festgelegt sind.
Bedeutung von Wörtern und Sätzen im Sprachspiel
Dieser Abschnitt beleuchtet Wittgensteins Kritik an der traditionellen Bedeutungstheorie, die von der Vorstellung ausgeht, dass Worte für Gegenstände der Wirklichkeit stehen. Er beschreibt Wittgensteins Auffassung von sprachlicher Bedeutung als eine dynamische und kontextuelle Angelegenheit, die sich durch das „hinweisende Lehren“ in einem sozialen Kontext entwickelt.
Sprache als Lebensform
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Sprache für die menschliche Lebensform. Er diskutiert, wie Sprache nicht nur ein Werkzeug zur Kommunikation ist, sondern auch unser Denken und Handeln formt.
Schluss: Philosophische Konsequenzen aus Wittgensteins Sprachspieldenken
Dieses Kapitel diskutiert die weitreichenden Auswirkungen von Wittgensteins Sprachspieldenken für die Philosophie. Es beleuchtet, wie seine Einsichten zu einer Neubewertung der traditionellen philosophischen Probleme und Methoden führen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter und Fokuspunkte des Textes umfassen das „Sprachspiel“, die Bedeutungstheorie, die Alltagssprache, der Sprachgebrauch, Familienähnlichkeiten, die Lebensform, die Philosophie und die philosophischen Probleme.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Wittgenstein unter einem „Sprachspiel“?
Ein Sprachspiel bezeichnet die Einheit aus Sprache und den Handlungen, mit denen sie verwoben ist. Es verdeutlicht, dass Sprache kein starres System ist, sondern flexibel in sozialen Kontexten gebraucht wird.
Wie unterscheidet sich Wittgensteins Spätwerk von seinem Frühwerk?
Im Frühwerk (Tractatus) suchte er nach einer idealen Logiksprache. Im Spätwerk (Philosophische Untersuchungen) rückt er die Alltagssprache und deren tatsächlichen Gebrauch in den Fokus.
Warum kritisiert Wittgenstein die traditionelle Bedeutungstheorie?
Er lehnt die Vorstellung ab, dass jedes Wort für einen festen Gegenstand steht. Stattdessen argumentiert er, dass sich die Bedeutung eines Wortes erst aus seinem Gebrauch im jeweiligen Sprachspiel ergibt.
Was bedeutet der Begriff „Familienähnlichkeiten“?
Wittgenstein nutzt diese Analogie, um zu zeigen, dass Dinge, die unter einem Begriff fallen, kein gemeinsames Wesen haben müssen, sondern durch sich überschneidende Ähnlichkeiten verbunden sind.
Inwiefern ist Sprache eine „Lebensform“?
Für Wittgenstein ist das Sprechen einer Sprache Teil einer Tätigkeit oder einer Lebensform. Sprache ist untrennbar mit unseren sozialen Praktiken und unserer Kultur verbunden.
Was ist das „hinweisende Lehren“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem die Bedeutung von Wörtern durch Zeigen auf Gegenstände vermittelt wird, was Wittgenstein als Teil des Einstiegs in ein Sprachspiel analysiert.
- Citar trabajo
- Andre Fischer (Autor), 2003, Das Sprachspiel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30497