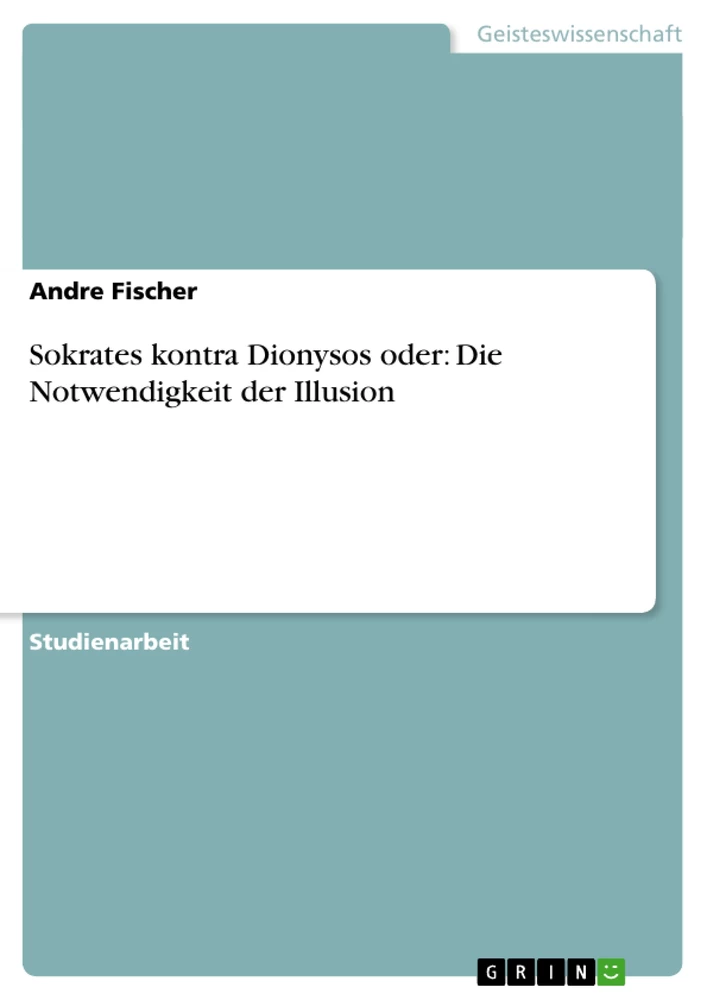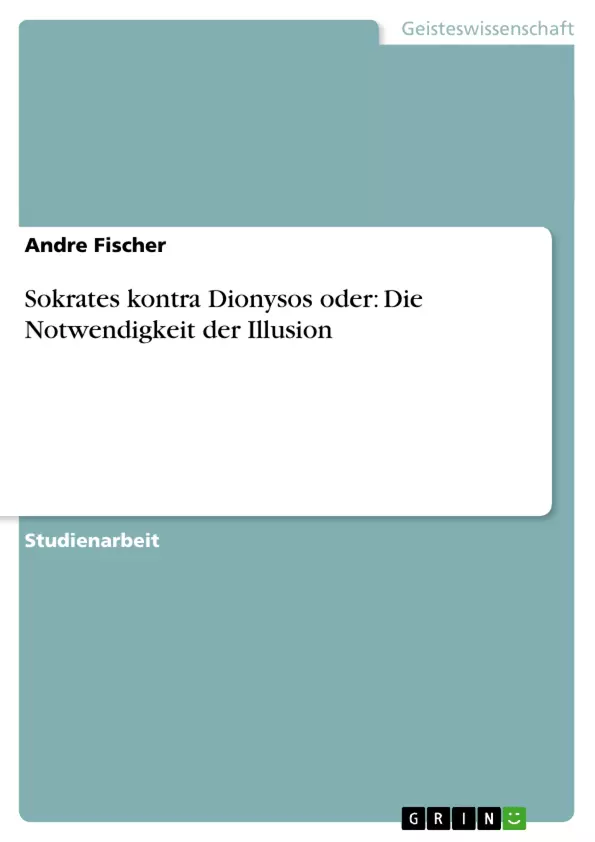Als im Januar 1872 Nietzsches Erstlingswerks Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik erscheint, ist dieser Inhaber eines Lehrstuhls für klassische Philologie an der Universität Basel. Auch der Titel lässt vermuten, dass es sich hier um eine philologische Schrift handelt. Dies ist die Geburt der Tragödie mit i hren kunst- und literaturtheoretischen Reflexionen in weiten Teilen auch. Darüber hinaus jedoch finden wir in ihr die grundlegenden und zentralen Gedanken von Nietzsches philosophischem Werk. Nietzsche begnügt sich in der Geburt der Tragödie nicht mit eine r Beschreibung der Entstehungsgeschichte der Tragödie als Kunstgattung, sondern richtet seinen Blick auf das gesamte Griechentum und die moderne Kultur, die für ihn nur „die in den Zustand der Verwesung übergangenen Reste der (...) griechischen Kultur repräsentieren“ 1 . Die Grundfrage, die Nietzsche in seinem Werk umkreist, ist von existenzielle Natur: Wie kann man trotz der Einsicht in die Grausamkeit und der offensichtlichen Sinnlosigkeit des Daseins das Leben bejahen? Diese Frage sieht Nietzsche im Griechentum beantwortet. Die Griechen schufen in einem künstlerischen Prozess die Welt der olympischen Religion und des Mythos, in der sie die entsetzliche und lebensfeindliche Wahrheit des Daseins im apollinischen Glanz „verklärten“. „So rechtfertigen die Götter das Menschenleben, indem sie es selbst leben“ 2 Die beiden Kunsttriebe, die diese Schöpfung der Griechen ermöglichten, sind in den Gottheiten Apollon und Dionysos versinnbildlicht. Diese miteinander in Konkurrenz tretenden Triebkräfte sind für Nietzsche a uch für die Entstehung der griechischen Tragödie verantwortlich und bilden in der Geburt der Tragödie das zentrale Begriffspaar. Diese beiden Kunsttriebe und ihre illusionären Schöpfungen möchte ich in der folgenden Arbeit beschreiben und deren Bedeutung für die Kunst, die Kultur und Nietzsches Sichtweise auf das Dasein erklären. Im zweiten Teil dieser Arbeit möchte ich Nietzsches Stellung zu Sokrates, den er für das Ende der griechischen Tragödie verantwortlich macht, und die damit eng verbundene Kulturkritik an der Moderne analysieren. Einige philologische Elemente der Geburt der Tragödie und die Überlegungen zur Erneuerung der Kultur durch die Musik Richard Wagners werde ich bewusst vernachlässigen, da sie den Rahmen meiner Arbeit überschreiten würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Apollon und das Apollinische
- Dionysos und das Dionysische
- Die notwendige Duplizität des Apollinischen und Dionysischen
- Die tragische Kunst
- Der Untergang der klassischen griechischen Tragödie
- Sokrates und der Typus des theoretischen Menschen
- Wissenschaft und tragische Erkenntnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit Friedrich Nietzsches "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" auseinander und analysiert dessen zentrale Gedanken zur Entstehung und Bedeutung der griechischen Tragödie. Sie befasst sich mit der Rolle der beiden Urkräfte Apollon und Dionysos, die Nietzsche als prägend für die griechische Kultur und die Kunst der Tragödie sieht. Darüber hinaus untersucht die Arbeit Nietzsches Kritik an Sokrates und dessen Einfluss auf den Untergang der klassischen griechischen Tragödie sowie die damit verbundene Kulturkritik an der Moderne.
- Die Bedeutung der Apollinischen und Dionysischen Prinzipien für die Entstehung der griechischen Tragödie
- Nietzsches Kritik an der modernen Kultur und die Rolle von Sokrates im Untergang der griechischen Tragödie
- Die "tragische Einsicht" in die Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Daseins und die Frage der Lebensbejahung
- Die Rolle der Kunst und des Mythos in der Bewältigung des Leidens und der Sinnlosigkeit des Lebens
- Nietzsches Grundfrage: Wie kann man trotz der Einsicht in die Grausamkeit und die Sinnlosigkeit des Daseins das Leben bejahen?
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Werk "Die Geburt der Tragödie" und Nietzsches zentrale Fragestellung ein: Wie kann man trotz der Einsicht in die Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Daseins das Leben bejahen?
Das Kapitel über Apollon und das Apollinische beleuchtet den Gott Apollon als Symbol für Ordnung, Form, Klarheit, Strenge und Schönheit. Seine künstlerische Kraft ermöglicht die „bildnerischen Kräfte“ und den „schönen Schein der Traumwelten“.
Das Kapitel über Dionysos und das Dionysische beschreibt Dionysos als Gott der Frauen, des Weines und des Rausches, dessen Symbole eine Ambivalenz zwischen Sexus und Tod, Lebenden und Toten aufzeigen. Er verkörpert die dunklen Mächte der Natur und des Triebhaften, die in rauschhaften Zuständen, in denen die Individualität zerbricht, empfundenen werden.
Das Kapitel über die notwendige Duplizität des Apollinischen und Dionysischen analysiert die einmalige Situation im Griechentum, in der die beiden gegensätzlichen Kräfte eine Versöhnung erreichten und eine Balance zwischen Ordnung und Chaos geschaffen wurde.
Das Kapitel über die tragische Kunst erläutert die Kunst der griechischen Tragödie als Ergebnis der Synthese von Apollon und Dionysos. Diese Kunstform bietet einen Raum für die künstlerische Verarbeitung der „tragischen Einsicht“ in die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Daseins.
Das Kapitel über den Untergang der klassischen griechischen Tragödie analysiert die Kritik Nietzsches an Sokrates, den er für das Ende der Tragödie verantwortlich macht. Durch Sokrates sei der Vernunft und dem Verstand eine Vorrangstellung eingeräumt worden, was zu einer Verdrängung der „tragischen Einsicht“ in die Sinnlosigkeit des Lebens geführt habe.
Das Kapitel über Sokrates und den Typus des theoretischen Menschen untersucht die Folgen der Verdrängung des Dionysischen für die griechische Kultur. Nietzsche sieht Sokrates als den „theoretischen Menschen“ , der sich der Vernunft und dem Denken verschrieben hat und dadurch die „tragische Einsicht“ in die Sinnlosigkeit des Lebens verdrängt.
Das Kapitel über Wissenschaft und tragische Erkenntnis befasst sich mit der Kritik Nietzsches an der modernen Wissenschaft, die sich in ihrem strengen Rationalismus der „tragischen Einsicht“ in die Sinnlosigkeit des Lebens verweigert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Werkes lassen sich mit folgenden Schlüsselbegriffen zusammenfassen: Apollon, Dionysos, tragische Einsicht, Sinnlosigkeit des Daseins, Lebensbejahung, Kunst, Mythos, Kulturkritik, moderne Kultur, Sokrates, theoretischer Mensch, Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Urkräfte Apollon und Dionysos bei Nietzsche?
Apollon steht für Ordnung, Form, Schönheit und den "schönen Schein". Dionysos verkörpert Rausch, Chaos, das Triebhafte und die Auflösung der Individualität.
Wie entstand laut Nietzsche die griechische Tragödie?
Die Tragödie entstand aus der Synthese und Balance beider Kräfte: der dionysischen Einsicht in das Leiden und der apollinischen Verklärung durch die Kunst.
Warum macht Nietzsche Sokrates für den Untergang der Tragödie verantwortlich?
Sokrates steht für den "theoretischen Menschen", der durch übermäßigen Rationalismus die dionysische Tiefe und den Mythos verdrängt hat.
Was ist die zentrale existentielle Frage des Werkes?
Nietzsche fragt: Wie kann man das Leben trotz der Einsicht in seine Grausamkeit und Sinnlosigkeit bejahen?
Welche Rolle spielt die Illusion für den Menschen?
Illusionen (der apollinische Schein) sind laut Nietzsche notwendig, um die entsetzliche Wahrheit des Daseins zu ertragen und das Leben lebenswert zu machen.
- Citation du texte
- Andre Fischer (Auteur), 2002, Sokrates kontra Dionysos oder: Die Notwendigkeit der Illusion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30499