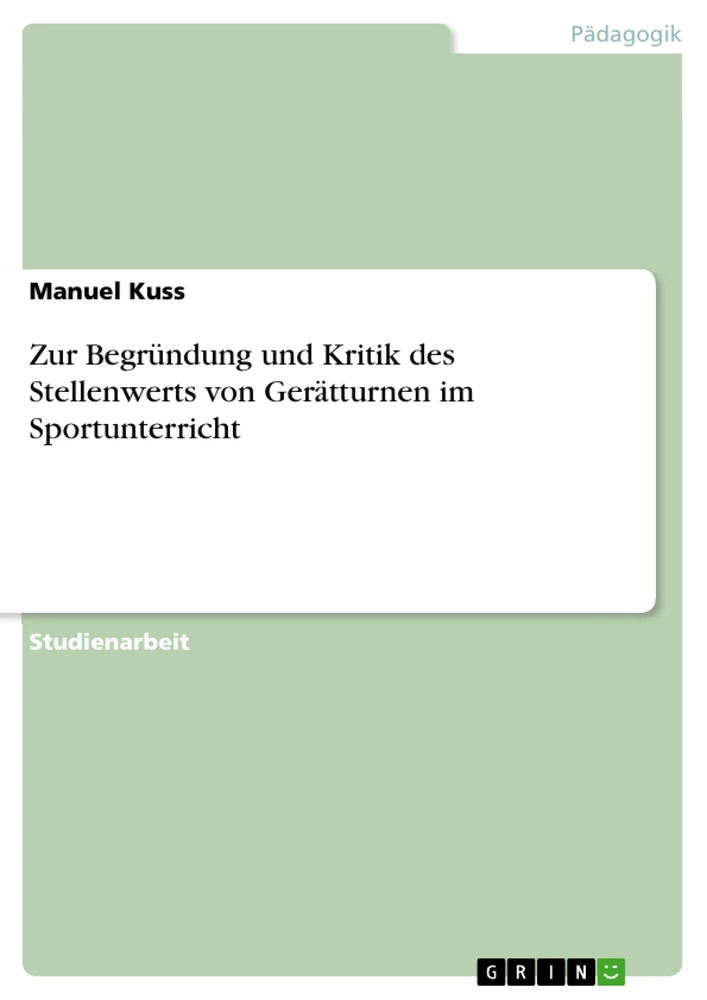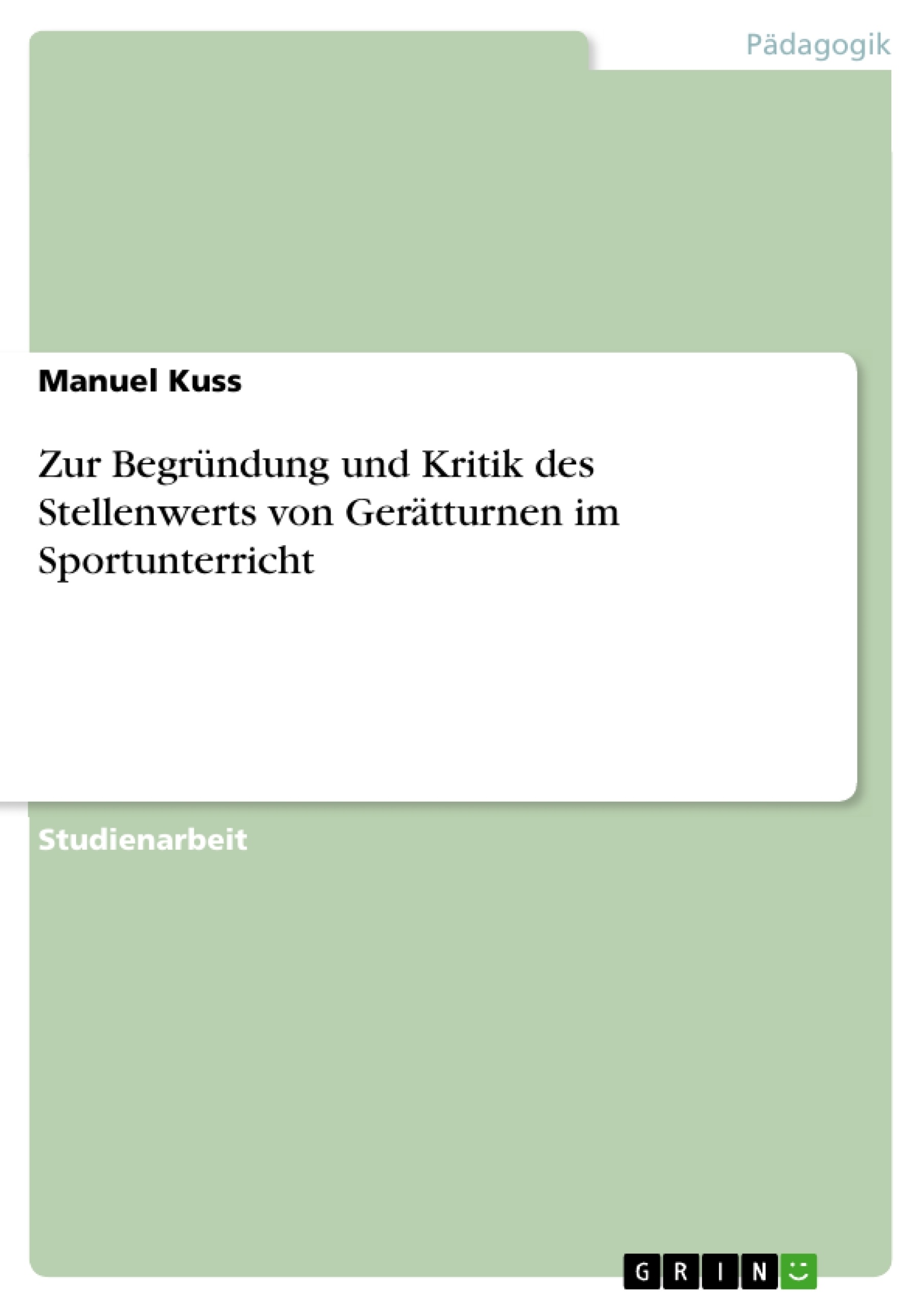Objektiv betrachtet befindet sich das Gerätturnen in der Schule in einer Art Dauerkrise. So stellt das Gerätturnen oftmals eine Art Gratwanderung zwischen Lust und Unlust dar. Es besteht eine vielfach ablehnende Haltung der Schüler gegenüber dem traditionellen Turnen. Viele Schüler zeigen motorische sowie konditionelle Defizite auf, und die unzulängliche Lehrerqualifikation bzw. Lehrermotivation und auch die mangelnde Geräteausstattung der Schulen beeinflussen diesen Werdegang (diese Misere) negativ mit.
Die Aufgabe des Lehrers besteht nun darin, sich diesem Problem zu stellen, die augenblickliche „Turnwirklichkeit“ als eine Herausforderung anzunehmen und zu versuchen, das Gerätturnen wieder zu beleben. Der Lehrer sollte sich hierbei an der Leitidee orientieren, ein Gerätturnen für alle Schüler zu veranstalten, also auch für die Übergewichtigen, die Schmächtigen, die Ängstlichen, die Langgewachsenen, aber auch die Talentierten Schüler. Hier bietet sich die Möglichkeit, das sogenannte „Freie Turnen“ in der Schule zu etablieren und den Weg, weg vom strengen Leitbild des Kunstturnens zu suchen. Hierbei muss der Lehrer versuchen, aus den schlechten Voraussetzungen und Gegebenheiten möglichst das optimale zu erreichen, nach dem Motto: „Aus wenig viel machen!“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Bildungswert des Gerätturnens
- Die konstitutiven Prinzipien des Gerätturnens
- Bildungswert des Gerätturnens
- Austauschbarkeit des Gerätturnens
- Problembereich des Gerätturnens in der Schule
- Das Gerätturnen in der Praxis
- Das Konzept des „Freien Turnens“
- Das Freie Turnen in der Schule
- Die Vielfalt des Turnens - Ordnungsmöglichkeiten
- Ausgangspunkte für die Planung des Gerätturnunterrichts
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Begründung und Kritik des Stellenwerts von Gerätturnen im Sportunterricht. Er analysiert die aktuelle Situation des Gerätturnens in der Schule, die sich in einer Art Dauerkrise befindet, und beleuchtet die Gründe dafür. Der Text befasst sich mit der Frage, welchen Bildungswert das Gerätturnen hat und ob dieser von anderen Sportarten übernommen werden kann. Dabei werden die konstitutiven Prinzipien des Gerätturnens und deren Bedeutung für die Entwicklung von Bewegungskompetenzen untersucht.
- Die aktuelle Krise des Gerätturnens in der Schule
- Der Bildungswert des Gerätturnens und dessen Austauschbarkeit
- Die konstitutiven Prinzipien des Gerätturnens
- Die Herausforderungen des Gerätturnens in der Praxis
- Das Konzept des "Freien Turnens" als Alternative
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die aktuelle Situation des Gerätturnens in der Schule dar und beschreibt die Gründe für die Krise, die sich durch eine ablehnende Haltung der Schüler, motorische Defizite, mangelnde Lehrerqualifikation und unzureichende Ausstattung ergibt. Im zweiten Kapitel wird der Bildungswert des Gerätturnens anhand der konstitutiven Prinzipien analysiert. Es wird herausgestellt, dass Gerätturnen durch die Nutzung von Geräten dem Menschen Bewegungsmöglichkeiten eröffnet, die in der natürlichen Umgebung nicht möglich wären. Die qualitative Perfektionierung der Bewegung und die Entwicklung von Fähigkeiten wie Koordinationsvermögen und Bewegungssteuerung werden ebenfalls als wichtige Bildungsziele des Gerätturnens hervorgehoben. Im dritten Kapitel werden die Schwierigkeiten des Gerätturnens in der Praxis beleuchtet und die Problematik von "verspieltem" oder zu einfachem Turnen als Ersatz für das traditionelle Gerätturnen diskutiert.
Schlüsselwörter
Gerätturnen, Sportunterricht, Bildungswert, Bewegungskompetenz, konstitutive Prinzipien, Freies Turnen, Schülermotivation, Lehrerqualifikation, Geräteausstattung, Praxis, Schulsport, Bewegungskultur, Koordinationsvermögen, Bewegungssteuerung.
Häufig gestellte Fragen
Warum befindet sich Gerätturnen in der Schule in einer Krise?
Gründe sind die Ablehnung durch Schüler, motorische Defizite, mangelnde Lehrerqualifikation und unzureichende Geräteausstattung.
Was ist der Bildungswert des Gerätturnens?
Es ermöglicht Bewegungserfahrungen an Geräten, die in der Natur nicht vorkommen, und fördert Koordination sowie die Perfektionierung von Bewegungsabläufen.
Was versteht man unter "Freiem Turnen"?
Ein Konzept, das sich vom strengen Kunstturnen löst und allen Schülern – unabhängig von Talent oder Körperbau – einen spielerischen Zugang ermöglicht.
Ist Gerätturnen durch andere Sportarten ersetzbar?
Der Text untersucht kritisch, ob die spezifischen Bildungswerte des Gerätturnens durch alternative Sportarten vollständig übernommen werden können.
Wie kann ein Lehrer Gerätturnen wieder attraktiv machen?
Indem er die "Turnwirklichkeit" als Herausforderung annimmt und nach dem Motto "Aus wenig viel machen" kreative Lernanreize schafft.
- Quote paper
- Manuel Kuss (Author), 2004, Zur Begründung und Kritik des Stellenwerts von Gerätturnen im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305245